Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit
Vorwort
„Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit“ ist ein literarischer Blog über Menschlichkeit in Zeiten der Medizin – und darüber, wie das Leben selbst in seinen Bruchstellen leuchtet.
Was bleibt, wenn das große Wort Krebs den Raum betritt? Eine Diagnose verändert den Blick – nicht nur auf den Körper, sondern auf das Leben selbst. In seinen Aufzeichnungen beobachtet der Autor mit leiser Ironie und präziser Zärtlichkeit, was bleibt, wenn Gewissheiten verschwinden. Zwischen Klinikfluren und Gesprächen mit Freunden entsteht ein Protokoll des Weiterlebens – berührend und überraschend hell.
Dieser Blog ist kein Ratgeber und kein Heldenepos. Er ist eine exakte, hingebungsvolle Vermessung der Gegenwart. Was hilft, wenn nichts hilft? Wie spricht man mit Ärztinnen und Ärzten, mit Freunden, mit sich selbst? Wo wohnt Mut an schlechten Tagen – und wie klingen dankbare Tage? Wer mitliest, findet keine fertigen Antworten, aber eine Haltung: realistisch, neugierig, liebevoll. Eine Liebeserklärung an das Leben selbst.
Der Erzähler begleitet sich durch Diagnosen, Therapien und Gesprächszimmer – und entdeckt dabei ein unerwartetes Inventar: Humor, der entkrampft. Freundlichkeit, die trägt. Medizin, die staunen lässt. Und eine neue Langsamkeit, die gewöhnliche Tage in kostbare verwandelt. Seine Texte sind medizinisch genau, literarisch geschliffen, zutiefst menschlich – eine Mischung aus Tagebuch, Essay und stillem Gebet.
Ein Blog, der tröstet, ohne zu beschönigen. Ein literarischer Beweis, dass man das Leben nicht neu erfinden muss – nur bemerken.
Einleitung
Am 25. April 2015 ereignete sich am Himalaja, genauer gesagt in der Region des Mount-Everest-Basislagers, ein schweres Erdbeben. Die durch das Erdbeben ausgelöste Lawine, die ein Dorf am Fuße des Berges traf, forderte tausende Todesopfer. Jost Kobusch, ein damals 22-jähriger deutscher Bergsteiger, filmte die Katastrophe, kurz nachdem das Beben die Lawine ausgelöst hatte. Ich sah ihn später in einem Interview, als er gefragt wurde, warum er nicht weggerannt sei, um sich in Sicherheit zu bringen. Er antwortete damals sinngemäß: Mit 22 ist Sterben keine Option. Das nenne ich klares Sehen.
Ja, wenn man so knapp vier Dekaden mehr im Lebensrucksack hat, kommt einem dieser Satz dann nicht mehr so leicht über die Lippen. Die Gesundheitsvorsorge stand wieder mal auf dem Programm. Der Arzt Christoph Wilhelm Hufeland brachte es schon vor gut 250 Jahren auf den Punkt: Vorbeugen ist besser als heilen. Von ihm stammt auch das Buch Makrobiotik oder Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Also, los geht’s. Long live longevity!
Ende April 2025
Mein komplettes Blutbild wurde gecheckt und für gut befunden. Die 0,3 ng/ml über dem PSA-Normalwert von 4,0 ng/ml beeindruckten dabei weder mich noch den Urologen. Ich fahre ja auch täglich ausgiebig mein Rennrad und im Herbst des Lebens breitet sich die Vorsteherdrüse eben gerne auch mal räumlich ein wenig aus. Platzhirschen. Als Sahnehäubchen obendrauf gab es noch eine transrektale Ultraschallsonde und dazu gestochen scharfe und detaillierte Schnittbilder. Im Prinzip war alles in guter Ordnung.
Auf Anraten des Doktors ließ ich auch noch die Tumormarker bestimmen:
Karzinoembryonales Antigen (CEA) = 2,6 ng/ml [< 5]
Antigen CA 19-9 = 3,0 U/ml [< 37]
Das sah doch schon mal gut aus.
Ich sollte in drei bis vier Wochen erneut einen PSA-Wert-Test machen lassen und vorher zehn Tage Fahrradfahren vermeiden. Das Ergebnis sei sonst möglicherweise verfälscht, denn die wallnussgroße Prostata ist etwas druckempfindlich. Das schmeckte meinem Radlerego überhaupt nicht und generell hatte ich das Gefühl, nicht wirklich wahrgenommen worden zu sein. Na ja, mir ging es ja auch nicht zu 100 %. Die leichten Schmerzen in der linken Leistengegend, die ich schon seit Wochen spürte, fanden während der Untersuchung kaum Beachtung. Also machten sie anschließend weiter auf gesellig und stichelten, wann immer sie konnten.
Anfang Mai 2025
Auch deshalb ein paar Tage später der nächste Termin. Diesmal bei der Hausärztin. Nun wurde auch der gesamte Beckenbereich mit Ultraschall untersucht. Dem Resultat des bildgebenden Verfahrens konnte nicht wirklich eine Diagnose entlockt werden. Am Ende der Untersuchung stand ein Verdacht auf einen Mikroleistenbruch bzw. eine leichte Entzündung des Hüftbeugermuskels. Ibuprofen war angesagt. Zehn Tage lang 4 x 600 mg und zusätzlich jeden Tag eine Pantoprazol-Tablette, die die Magensäure im Magen reduziert, denn Ibuprofen schwächt gerne mal die Magenschleimhaut. Voilà. C’est ça.
Dumm nur, dass sich die Symptomatik danach nicht verbesserte. Die Leistengegend fühlte sich immer noch leicht gereizt an und eine meiner Familienjuwelen, mein linkes Nüsschen, machte jetzt auch auf Entzündung und warb so ebenfalls um Aufmerksamkeit.
Anfang Juni 2025
Also auf ein Neues. Diesmal lautete die Diagnose bei der Hausärztin: Verdacht auf Divertikulitis. Also eine Entzündung von Ausstülpungen (Divertikel) in der Darmwand, die man ebenfalls im linken Leistenbereich spürt. Der neue Therapieansatz: Antibiotikum. Für die nächsten zehn Tage war zweimal täglich Augmentan 875 mg/125 mg auf der Verordnung. Danach war ich zwar im Supermarkt der mit Abstand beste Kunde für alle Kefirprodukte, trotzdem schwenkte mein Magen-Darm-Trakt jetzt ab und zu die weiße Fahne. Die Schmerzen im Leistenbereich machten es sich weiterhin gemütlich.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Ende Juni 2025
Auch meine Hausärztin schwenkte zu diesem Zeitpunkt das Fähnchen und riet mir, doch eine Darmspiegelung durchführen zu lassen. Mit 60 Jahren stand dies ohnehin wieder mal auf der To-do-Liste. Die Koloskopie sollte endlich Aufschluss bringen.
Am 23.06. fuhr ich dann brav in die Klinik zum Gastroenterologen. Als ich im Untersuchungszimmer auf dem Behandlungstisch lag, fragte mich der Doktor, ob ich mich bezüglich der leichten Narkose entschieden hätte. Ja, das hatte ich und lehnte dankend ab. Irgendwie hat er mich dann doch recht charmant überredet und ich fiel in einen unfassbar angenehmen Propofol-Dämmerschlaf. Vielleicht sollte ich meine Einstellung zu Drogen ein wenig überdenken. Wo bitte kann man dieses Zeug online bestellen?
Als ich aus meinem entspannten Zustand wieder erwachte, war alles bereits vorbei und der Doc erklärte mir, dass alles in bester Ordnung sei. Die beiden Gewebeproben (Biopsien), die er sicherheitshalber genommen hatte, würden untersucht und mir das Ergebnis dann schriftlich mitgeteilt. Eine Woche später kam der Befund: negativ. Mein Ego applaudierte.
Meine Beschwerden im linken Oberbauch applaudierten ebenfalls. Die offensichtlich komplizierte Ursachenschnitzeljagd ging also weiter.
Anfang Juli 2025
Ich lag wieder einmal bei meinem Osteopathen auf der Folterbank und bat ihn um Rat. Nach einer einstündigen Behandlung legte er sich auf ein Lendenmuskelsyndrom fest. Der Musculus iliopsoas ist für alles Mögliche im Beckenbereich zuständig, ist daher gerne mal überlastet und neigt ebenfalls zu entzündlicher Symptomatik. So 100 % war er sich allerdings nicht sicher und empfahl mir einen Urologen, mit dem er sehr gute Erfahrungen gemacht hatte. Wer braucht schon Hobbys, wenn man sich im Vorsorgeuntersuchungsrad befindet? Schon am nächsten Tag bekam ich einen Termin.
Uro Nummer zwei war ein sehr freundlicher und geduldiger Arzt. Er hörte meiner Anamnese aufmerksam zu und bat mich anschließend in den Untersuchungsraum. Bevor er anfing, wollte er noch eine Urinprobe. Ergebnis: negativ. Keine Entzündungen. Er tastete meinen Unterleib ausführlich ab und führte auch noch eine digitale rektale Untersuchung durch.
Für die geneigten Lateiner unter uns: Digitus = Finger.
Er war sich seiner Sache absolut sicher. Meine Beschwerden kämen von einer Samenleiter- und Nebenhodenentzündung. Alles andere wurde ja bereits ohnehin ausgeschlossen. Im Abschlussgespräch erklärte er mir auch noch sehr genau die Anatomie und Funktion und verschrieb mir dann ein Antibiotikum. Ciprofloxacin. Antibiotikum laut Wikipedia: Früher auch Antibioticum, von griechisch ἀντί (anti) „gegen“ und βίος (bios) „Leben“. Ich nehme es vorweg: Genauso fühlte sich die Therapie dann auch an.
Und warum auf den Wirkungseintritt der weißen Tabletten warten? Obendrauf gab es auch noch eine Die-wirkt-sofort-Spritze mit Gentamicin 240 mg. Sozusagen als magenschonendes Antibiotikumdepot in meinem Gesäß. Ha, und mal ganz ehrlich, wer liest schon gerne den kleingedruckten Beipackzettel durch: Aufgrund seiner potenziell starken Nebenwirkungen wird es nur bei schweren bakteriellen Infekten eingesetzt. Die Nebenwirkungen von Ciprofloxacin erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Minus mal Minus ist ja bekanntlich Plus.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich sollte das Antibiotikum erstmal vierzehn Tage lang einnehmen. Eine Tablette mit 500 mg morgens und abends. Allerdings sollte ich mir keine allzu große Hoffnung auf eine schnelle Besserung machen. Die Heilung würde wohl mehrere Wochen in Anspruch nehmen, und der Urologe berichtete von Patienten, die die Therapie bis zu zwölf Wochen durchführen mussten.
Ich beschloss den Supermarkt zu umgehen und die gesamte Kefir-Produktpalette direkt bei Müllermilch zu bestellen.
Mitte Juli 2025
Das fermentierte Milchprodukt leistete diesmal ganze Arbeit und nach zwei Wochen hatte ich nicht eine Antibiotika-Nebenwirkung verspürt. Allerdings hatte sich meine SL- & NH-Entzündungsgesamtsituation nicht verbessert. Leider. Ich musste also wieder zum Facharzt. Nach einer weiteren eingehenden Untersuchung hielt der Doktor an seiner Primärdiagnose fest, und ich bekam die nächste Spritze in den Allerwertesten und noch ein Rezept für weitere vierzehn Tage Antibiotikum. Mittlerweile war ich Anteilseigner bei Müllermilch. Alles Müller – oder was?
Ende Juli 2025
Der langersehnte Frankreichurlaub stand in den Startlöchern. Das entzündliche Befinden war allerdings noch immer im Aufmerksamkeitserhaschungsmodus. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, bevor ich ins Land der unbegrenzten Baguettes aufbrach, und daher vorher noch einen Check-up-Termin haben. Uro Nummer zwei war offensichtlich unpässlich, denn ich wartete schon seit drei Tagen auf eine Terminbestätigung. Also musste wieder mal Google ran. Uro Nummer drei war schnell ausfindig gemacht und ich bekam noch am selben Tag einen Termin. Ein sehr freundlicher und aufmerksamer Facharzt. Ich erläuterte ihm meine Situation. Er sagte, wenn er mich jetzt auch nochmal ultraschallen soll, würde das 150 Euro kosten, und meinte, das könne man sich sparen. Er bestätigte die Diagnose von Uro Nummer zwei, verschrieb mir jedoch ein anderes Antibiotikum. Levofloxacin 500 mg. Das sollte ich alternativ und für zwei Wochen einnehmen. Na dann …
Als ich aus der Apotheke wieder herauskam, klingelte mein Telefon. Uro Nummer zwei war am anderen Ende. Er entschuldigte sich für das verspätete Rückmelden und bat mich das Levofloxacin nicht zu nehmen, nachdem er vernommen hatte, was Uro Nummer drei verschrieben hatte. Die Nebenwirkungen seien noch ungünstiger. Daher verschrieb mir der Bauch- und Unterleibs-Inspektor zum dritten Mal Ciprofloxacin. Das Rezept kam per E-Mail. So geht schnell. Frankreich, ich komme …
Nach ein paar Tagen hatte ich das Gefühl, dass ich mich seit Wochen ausschließlich von Antibiotika ernähren würde. Na ja, Antibiotika sind ja auch „Bioprodukte“ von Mikroorganismen (Pilze) oder sie werden von Menschen in Laboren gebastelt.
So gesehen …
Anfang August 2025
Schließlich warf jetzt auch der Kefir das Handtuch. Kann man wirklich alle Nebenwirkungen haben, die im Beipackzettel beschrieben sind? Ja, man kann. Ich hatte Schwindelanfälle, einen Blähbauch, stärkste Rücken- und Knieschmerzen. Ich konnte nur noch rückwärts die Treppe runterlaufen, während ich mich am Handlauf festhielt, und alle positiv gesinnten bakteriellen Mitarbeiter meines Magendarmtrakts befanden sich nach der Urabstimmung im unbefristeten Streik. So fühlt man sich also, wenn man sich so richtig scheiße fühlt.
Ich kontaktierte den Urologen Nummer zwei und bat um ferndiagnostische Hilfe via E-Mail. Ich beschrieb ihm meine oben geschilderte Situation und bekam die folgende Antwort:
Ich möchte hier einige Punkte klarstellen:
1. Die Diagnose ist bestätigt, und diese Erkrankung hat neben den notwendigen Medikamenten auch Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt. Ich empfehle die Einnahme eines Probiotikums wie Lactibiane Reference oder Toleranx.
2. Heilung braucht Zeit, Geduld und positive Einstellung, was für Patienten nicht immer einfach ist, weil es dauert.
3. Orale Medikamente dringen nur teilweise in die betroffenen Organe ein, insbesondere in die Samenbläschen und den Samenleiter.
In jedem Fall ist eine Heilung eingetreten. In der Hoffnung, Ihnen damit weiterhelfen zu können, wünsche ich Ihnen alles Gute.
Er schrieb dann noch, dass ich das verschriebene Antibiotikum zu Ende nehmen sollte und danach würde mein Körper den restlichen Heilungsprozess übernehmen.
Verbum tuum in aure Dei.
Vielleicht hätte ich doch den Latein-LK in der Oberstufe wählen sollen.
Mitte August 2025
Ich war froh, dass ich keine Medikamente mehr zu mir nehmen musste. Nach zwei, drei Tagen verbesserte sich meine Nebenwirkungssituation und ich fühlte mich etwas wohler. Das entzündliche leichte Brennen des Samenleiters und der linken Nuss war tatsächlich etwas abgeflacht. War das die Trendwende?
Ab dem vierten Tag meldeten sich dann meine beiden Lymphknoten in der Leistengegend. Plop. Beide waren ordentlich raumgreifend und fühlten sich recht hart an. Allerdings komplett schmerzfrei. Heutzutage googelt man ja nicht mehr, sondern nutzt den persönlichen ChatGPT-Assistenten. Das tat ich dann auch und fütterte ihn mit allen medizinischen Daten der letzten Wochen. Seine vorbehaltliche und medizinisch unverbindliche Diagnose: Das hänge wohl mit der noch nicht ganz abgeklungenen Entzündung zusammen und damit, dass die Lymphozyten im Hochtourenmodus die Krankheitserreger bekämpften. Danach war ich entspannter.
Auf mein Immunsystem war bis dato immer Verlass.
Ab dem sechsten Tag gesellten sich dann plötzlich auch die Lymphknoten oberhalb des linken Schlüsselbeins dazu. Hmmm!? Die Lymphknotenaktivität im Leistenbereich hatte ja einen örtlichen Zusammenhang, aber warum nun weit weg vom eigentlichen Geschehen?
ChatGPT kam auch ein wenig ins Grübeln, sah allerdings durchaus eine mögliche Konnektivität. Ich beobachtete die lymphatischen Organe noch ein paar Tage und beschloss am zehnten Tag nach der Absetzung des Antibiotikums meine Hausärztin anzurufen.
Ferndiagnostisch könne sie dazu natürlich wenig sagen, indes stimmte sie ein wenig in den ChatGPT-Chor ein und bestätigte einen möglichen Zusammenhang. Ich solle nicht mehr googeln, mir keine großen Sorgen machen und auch meinen persönlichen ChatGPT-Assistenten in den Urlaub schicken. Sobald ich wieder zurück sei, sollte ich mich melden, um eventuell weitere Untersuchungen durchzuführen zu lassen. So richtig geholfen hatte mir die liebgemeinte Hilfestellung allerdings nicht. Das Gedankenkarussell drehte sich nachdenklich weiter. Ich spürte, dass etwas nicht in Ordnung war.
Tage später telefonierte ich mit einer guten Freundin und wir hatten ein kurzweiliges Gespräch. So etwas ist immer eine schöne Ablenkung. Jedoch erfuhr ich, dass eine ihrer Töchter an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war und glücklicherweise erfolgreich behandelt werden konnte. Als ich ihr dann von meiner Situation erzählte, wurde sie hellhörig und haute mehrfach hörbar mit dem Alarmglockenhämmerchen auf die Alarmglocke. Das war nicht zu überhören. Sie gab mir ein paar wichtige Ratschläge und bat mich nichts schleifen zu lassen. Das müsse untersucht werden. Das versprach ich ihr dann auch.
Ende August 2025
Die restlichen Urlaubstage verliefen ohne weitere Veränderung meiner lymphatischen Situation und so machte ich mich auf den Heimweg. Kurz vor der Abfahrt organisierte ich noch einen Termin bei einem Labor für Blutanalysen und hatte Glück, denn schon am Tag nach meiner Rückkehr durfte ich Blut spenden. Ich ließ das komplette Blutbild analysieren und mir wurde gesagt, dass ich die Ergebnisse so in drei bis vier Tagen erhalten werde.
Alles in allem sah das Ergebnis ganz gut aus. Hier und da ein leicht über der Grenze erhöhter Wert, der wohl mit der ganzen Antibiotika-Therapie zusammenhing. Der PSA-Wert sah allerdings rekordverdächtig aus: 15,3 ng/ml. Eine fast vierfache Erhöhung innerhalb von vier Monaten. Beim Lesen der Zahlen wurde mir ein wenig schlecht und danach noch schlechter.
Ich kontaktierte sofort den Urologen Nummer zwei, beschrieb meine Situation und bat um eine schnellstmögliche Antwort. Die kam dann auch prompt:
Vielen Dank für Ihre E-Mail, die ich gerne beantworte.
Wie ich Ihnen bereits immer mitgeteilt habe, handelt es sich um eine langjährige, tiefe Infektion der unteren Harnwege.
Ich denke, unter Berücksichtigung Ihrer Angaben gibt es derzeit drei mögliche Optionen:
– Abwarten und die Behandlung mit pflanzlichen Naturheilmitteln (Viacare, Tiobec Dol) fortsetzen.
– Beispielsweise Genta Gobens jetzt dreimal intramuskulär verabreichen, im Abstand von drei bis fünf Tagen.
– Abwarten und später eine kombinierte Genta-Gobens-Therapie durchführen, ggf. lokal in Kombination mit z.B. 1 Gramm Ceftriaxon, 3- bis 4-mal.
Wir müssen die beste Option besprechen, am besten telefonisch. Vielleicht können wir dies telefonisch besprechen, ggf. per WhatsApp. Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie herzlich.
Mit anderen Worten: erneut mit Antibiotikum draufhauen.
Ich rief meine Hausärztin an und wollte sie dringend sehen. Am nächsten Tag hatte ich einen Termin. Mir schwante nichts Gutes.
Ich wurde wieder mit Ultraschall untersucht und die vergrößerten Lymphknoten über dem linken Schlüsselbein kamen auch ihr sehr suspekt vor. Mittlerweile war es eine richtige Anhäufung von geschwollenen Lymphknoten. Nach weiteren Standarduntersuchungen, die alle ohne Befund verliefen, und der Besprechung der Blutbildanalyse empfahl mir meine Hausärztin ein CT durchführen zu lassen. Freundlicherweise konnte sie mir einen zeitnahen Termin in einer Radiologie vereinbaren. Eine Woche später lag ich in der Röhre.
Anfang September 2025
Krankenhäuser heißen ja nicht ohne Grund Krankenhäuser. Abgesehen von einer Sportverletzung im Jahre 1988 hatten mich Krankenhäuser immer nur als Besucher gesehen.
Ich gebe gerne zu, das Wort Hospital klingt freundlicher. Gastfreundschaft, hospitalitas, hat etwas Positives. Das wäre doch mal ein Regierungsauftrag. „Lauterbach, übernehmen Sie!“
02. September 2025 – Ground Zero
Ich sollte mich meines Beinkleides entledigen und mich auf den CT-Tisch legen. Danach gab es noch einen Venenzugang für das Kontrastmittel und es ging los. Die Röhre war großzügig gestaltet und wenig klaustrophobisch. So hab ich das gerne. Nach 30 Minuten war alles vorbei. Ich bekam noch eine CD mit den Aufnahmen der Untersuchung und radelte direkt zur Hausärztin. Sofortbefriedigung war angesagt. Dort angekommen sahen wir uns beide die verschiedenen Computertomographie-Schnittbilder an. Ich war von der Technik tief beeindruckt, konnte allerdings nur Bahnhof erkennen. Meine Hausärztin hatte einen wesentlich besseren Überblick, indes konnte sie nicht genau erkennen, ob da auch noch andere Lymphknoten aus der Reihe tanzten. Sie war da ganz offen und ehrlich, sie sei keine Radiologin.
Ich bat sie freundlich mir die Bilder via E-Mail zu schicken. Ein guter Freund von mir hat eine eigene radiologische Praxis, und ich erhoffte mir von ihm mehr und vor allem schnelleren Durchblick, denn die freundliche Rezeptionistin der Radiologie sagte mir am Morgen, dass der Befund so in fünf bis sechs Tagen automatisch an die Hausarztpraxis geschickt werde. So viel Zeit haben Schützen nicht. Ungeduld ist eine Tugend.
Ich bekam die Bilder am Nachmittag, leitete sie sofort weiter und bat meinen Freund um Unterstützung. Er meldete sich umgehend und versprach mir die Aufnahmen am Abend zu checken.
Gegen 18 Uhr klingelte das Telefon. Ich sei ja ein Spaßvogel, ich hätte ihm 2.400 Einzelbilder von meiner Untersuchung geschickt, die könne er sich jetzt ja nicht einzeln anschauen. Er bräuchte natürlich das dazugehörige Programm der CD. Hallo?! 2025! CDs? Ein CD-Laufwerk? Der nachvollziehbare Wunsch überforderte mich etwas. Ich konnte ihm da wenig helfen. Er wollte im Internet checken, ob es da ein Programm bzw. eine Applikation gibt, und würde sich wieder melden. Innerlich hatte sich mein ungeduldiger Sagittarius damit von einer schnellen Diagnose ein wenig verabschiedet.
Ich verschaffte ihm und mir eine angenehme Ablenkung. Abendessen mit guten Freunden stand auf dem Programm. Das Dinner war lecker und kurzweilig und danach gab es noch ein sahnecremiges Bourbon-Vanilleeis auf die Hand. Wir schlenderten ziellos durch die Straßen und genossen die laue Sommernacht, als plötzlich mein Handy klingelte. Es war 22:37 Uhr. Im Display leuchtete der Name meines Freundes, des Radiologen. Er sagte den folgenden Satz: „Ich habe jetzt erstmal eine Flasche Wein getrunken, bevor ich dich anrufen konnte …“.
Im Englischen heißt das „Sucker Punch“. Google übersetzt das wie folgt: Sucker Punch {m} [überraschender, hinterhältiger Angriff]. So richtig konnte oder wollte ich nicht verstehen, was er mir anschließend am Telefon erläuterte. Gefühlt lag ich hilflos auf meinem Rücken im Ring und bekam nicht mal mehr mit, dass mich der Ringrichter bereits bis 10 angezählt hatte.
Ich bat ihn noch mir eine kurze schriftliche Zusammenfassung zu schicken, damit ich diese der Hausärztin schicken konnte. Hier seine WhatsApp-Nachricht im Wortlaut:
– Große pathologische Lymphknotenpakete links supraclavikulär und abdominell paraaortal, geringer auch mediastinal.
– Rechte Niere und Harnleiter mäßig gestaut, Entlastung durch Harnleiterschiene notwendig.
– Verdacht auf Knochenmetastasen.
– Große Prostata mit kräftiger Samenblase.
– In Zusammenschau mit dem deutlich erhöhten PSA: Prostatakarzinom möglich. Abklärung dringend erforderlich durch Prostata MRT oder Stanzbiopsie.
Sorry für den Scheiß-Befund!! 😔😘
Er bat mich schnellstmöglich zu ihm in die Radiologie zu kommen, um ein MRT durchführen zu lassen. Eine exakte und verlässliche Analyse war jetzt das Wichtigste. Er wollte absolute Gewissheit.
Wahrscheinlich in einer Art Übersprungshandlung rief ich wahllos mir nahstehende und wichtige, liebgewonnene Menschen an und teilte ihnen die vorläufige Diagnose mit. Ich glaube, das hat mir in dieser Situation geholfen und mir auch das Gefühl gegeben, dass ich noch die Zügel in den Händen hielt. Ich spürte jedoch, wie die Ohnmacht sich ganz langsam breit machte.
So fühlt es sich also an, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
Meine Freunde standen ca. 30 Meter von mir entfernt. Sie sahen nun auch irgendwie besorgt aus. Ich ging zu ihnen und teilte ihnen meine Diagnose mit.
05. September 2025
Bereits drei Tage später war ich zur MRT-Untersuchung in der radiologischen Praxis meines Freundes. MRT bedeutet ja eigentlich „Magnetresonanztomographie“. In meinem Fall wäre allerdings „Maximales Röhren-Trauma“ die treffendere Bezeichnung gewesen.
Sicherheitshalber fragte ich vor der Untersuchung noch, ob ich nicht ein Beruhigungsmittel bekommen könnte, denn meine Beine waren beim Anblick der Röhre bereits in den Quarkmodus übergegangen. „Ja klar, das können Sie haben – aber dann dürfen Sie anschließend kein Auto mehr fahren“, erklärte mir die freundliche Mitarbeiterin. Na gut, 45 Kilometer zu Fuß nach Hause waren dann auch keine wirkliche Alternative. Also biss ich die Zähne zusammen: Augen zu und durch. Es sollte ja auch nur 40 Minuten dauern.
Spoileralarm: Es wurden 60 Minuten.
Ich hätte da übrigens noch einen Vorschlag, um den sich der Gesundheitsminister a.D. Karlchen Überall kümmern könnte: Bitte MRT offiziell in LBS umbenennen. „Lebendig-Begraben-Syndrom“ trifft es einfach besser. In einem Sarg hat man auch nicht mehr Platz, um sich zu bewegen. Während der Untersuchung gibt es dann obendrauf noch Klopf-, Säge- und Knarrgeräusche zu hören, die bis zu 130 Dezibel erreichen. Alternativ kann man sich allerdings auch gleich eine Schlagbohrmaschine ans Ohr halten. Kopfhörer nicht vergessen!
Das ich Radio FFH hören musste, machte die Sache nicht besser.
Die Primärdiagnose wurde bestätigt. Ohne Zweifel. Ich hatte ein synchron metastasierendes, hormonsensitives Prostatakarzinom im Stadium 4. Ich starrte mechanisch auf den Monitor, während mir mein guter Freund und Radiologe die Bildsequenzen erläuterte. Ich verstand weiterhin nur Bahnhof. Ich nahm das Ganze noch mit meinem Handy auf Video auf, und wir sprachen ein wenig über mögliche nächste Schritte. Allerdings sei er kein Urologe bzw. Onkologe und könne mir daher nicht wirklich weiterhelfen. Wir umarmten uns, und ich machte mich auf den Heimweg.
Während der fast zweistündigen Im-Stau-Steh-Rückfahrt – dank Innenstadtsperrung wegen eines Bombenfunds – telefonierte ich ausführlich mit meinem Hausarzt. Er hatte gute Kontakte zu einem bekannten Facharzt für Urologie in Frankfurt und wollte diesen kontaktieren, um mit ihm meine Situation und das mögliche Prozedere zu besprechen. Ich überlegte derweil, ob ich nicht einfach an der Polizeisperre vorbeifahren und die Bombe selbst entschärfen sollte.
Ich spürte, wie sich in mir etwas Unangenehmes zusammenbraute, und war fassungslos, dass ich monatelang falsch behandelt worden war. Warum hatte niemand früher die diagnostische Reißleine gezogen? Mein Immunsystem mit Antibiotika so herunterzufahren, konnte nicht gut gewesen sein. Hätte, könnte, wäre. Das Handy klingelte. Der Facharzt war informiert und wollte sich melden. War das der erste Babyschritt?
Ich fühlte, wie ohnmächtig – sprichwörtlich ohne Macht – ich war. Warten bekam für mich eine neue Dimension. Minuten wurden zu Stunden. Ich dachte an einen Song von Herbert Grönemeyer und textete ihn ein wenig für mich um:
„Verwegen in mein Leben gestartet
Mit bedingungslosem Urvertrauen
Mich ganz unverschämt in Deine Hand gegeben
Hier bin ich, jetzt kommst du
Du hast mich so gewollt, ja
Jetzt sieh zu, was du mit mir tust“
Ich summte ein wenig vor mich hin und nahm gedanklich auf dem Beifahrersitz Platz. Mein Lenkrad hielten jetzt andere in der Hand.
Den Abend verbrachte ich im Garden Eden. Offensichtlich lag ich nun unter dem Apfelbaum und schlug mir den Bauch mit Äpfeln voll. Das Paradies war für mich erst einmal geschlossen. So fühlt sich also Vertreibung an. Die Sauna und das Dampfbad taten mir sehr gut. Ich konnte entspannen und mich ein wenig sammeln. Ich bestellte mir noch Bratkartoffeln mit Kräuterquark und genoss jeden Bissen. Zuhause angekommen, war ich angenehm müde und konnte erstaunlich gut ein- und durchschlafen.
06. September 2025
Mein Hausarzt informierte mich, dass der Urologe weiterhelfen konnte und die Chefärztin der Urologie eines Krankenhauses über meinen Fall informiert worden war. Sobald er etwas Konkretes von ihr hören würde, gäbe er Bescheid. Tick, tock, tick, tock.
Das ganze Wochenende über hatte ich schöne Ablenkung mit Freunden und Familie und sog jeden Moment in mich auf. Ich war immer noch erstaunlich gefasst. Vielleicht auch ein wenig ignorant. Ich war wohl noch im Autopilotschutzundignorierungsmodus.
07. September 2025
Am Sonntag schrieb mir mein Hausarzt, dass ich am Montag bereits um 13 Uhr einen Termin bei der Urologin im Krankenhaus hätte. Uff. Mir fiel ein Stein vom Herzen und ich war sehr, sehr froh und dankbar, dass ich so schnell einen Termin bei ihr bekommen konnte. Babyschritt Nummer zwei.
Auch eine Schnecke kommt irgendwann mal ins Ziel.
08. September 2025
Ich holte meinen Hausarzt, mit dem ich schon seit fast 30 Jahren befreundet bin, in seiner Praxis ab, und wir fuhren gemeinsam zur Klinik. Das war eine sehr schöne und wichtige Unterstützung für mich. Meinen Koffer fürs Krankenhaus hatte ich gepackt und im Kofferraum verstaut. Gut fühlte sich die Vorstellung, ins Krankenhaus eingewiesen zu werden, nicht an. Korrektur: Es fühlte sich überhaupt nicht gut an. Für den Fall der Fälle bot mir mein empathischer Begleiter auch noch an, mein Auto wieder nach Hause zu fahren. Freundschaft ist die Fortsetzung der Familie mit eigenen Mitteln. Das empfand ich als sehr beruhigend.
Mit den sehr freundlichen Rezeptionistinnen der urologischen Abteilung wurde ich schnell warm und die Anmeldung verlief wie im Flug. Wir nahmen im Wartezimmer Platz. Mit etwas Verspätung holte uns die Ärztin ab und wir folgten ihr in das Besprechungszimmer. Sie wirkte in sich ruhend, vollkommen klar und angenehm neutral in ihren Erläuterungen. Ein sehr angenehmer Mensch. Auch sie bestätigte die MRT-Diagnose und besprach mit uns das weitere Vorgehen: eine 3-fach-Therapie aus Tabletten (ein Androgenrezeptor-Antagonist), Hormonspritzen (der Wirkstoff verringert die Produktion von Geschlechtshormonen – in meinem Fall Testosteron) und eine Chemotherapie (insgesamt sechs Zyklen im Abstand von jeweils drei Wochen). Zusätzlich sollte ich ein Medikament zur Behandlung von Osteoporose erhalten, da die Metastasen meine Knochen bereits in Mitleidenschaft gezogen hatten. Sie erläuterte mir ausführlich mögliche Nebenwirkungen der Therapie und fragte, ob ich noch etwas wissen wolle. Auf meine Frage, ob ich meinen Lebensstil ändern sollte, sagte sie:
„Vor mir sitzt ein 60-jähriger Patient, der topfit und eigentlich auch sehr gesund ist. Gleichzeitig sind Sie auch schwer krank. Vergessen Sie einmal kurz die Krebsdiagnose. Sie sind deshalb so gut in Form, weil Sie offensichtlich vieles richtig gemacht haben. Leben Sie bitte genauso weiter wie bisher. Um den Krebs kümmern wir uns.“
Ich hätte das gerne als Kompliment aufgefasst und wollte mich schon geschmeichelt fühlen, da wurden bereits weitere Maßnahmen für den nächsten Tag besprochen. Ich sollte am Dienstag eine Biopsie durchführen lassen, außerdem sollte ein Katheter zwischen der rechten Niere und der Blase gelegt werden – ein sogenannter Doppel-J-Katheter –, da die Niere bereits ein wenig gestaut und in ihrer Funktion eingeschränkt war. Das Karzinom hatte sich im Bauchraum schon deutlich ausgebreitet. Sie wünschte mir für den nächsten Tag und die beiden Eingriffe viel Erfolg und wir verließen die Klinik.
Meine Krankenhausweste blieb also rein. Alle Behandlungen sollten ambulant erfolgen. Meinen Koffer konnte ich wieder auspacken. Ein schwacher Trost, dennoch fühlte es sich in dieser Situation gut an. Wenigstens in den eigenen vier Wänden sein, Freunde treffen und lecker essen. Carpe diem bekam für mich eine völlig neue Bedeutung.
09. September 2025
Als ich 1988 das erste und bis heute einzige Mal im Krankenhaus verweilen musste, hatte ich das einer Knieverletzung zu verdanken. Wenn schon, denn schon, dachte ich mir wohl damals – und zog mir gleich eine vordere Kreuzbandruptur sowie Knorpel- und Meniskusschäden zu. Hockeyspielen war erstmal nicht mehr.
Etwa drei Tage nach der OP kam ein Assistenzarzt zu mir ans Bett und erklärte, er würde nun die Kniedrainage entfernen, da die Wundflüssigkeitsbildung aufgehört habe. Ich wartete auf die örtliche Betäubung, doch der nette Herr in Weiß hatte anderes im Sinn. Eine Lokalanästhesie sei nicht nötig, meinte er, es würde lediglich kurz etwas brennen, wenn er den Drainageschlauch aus meinem Unterschenkel ziehe.
Ich war mir ziemlich sicher, dass die Nervenfunktionen vorübergehend blockiert werden sollten, denn der Schlauch schien mir schon ziemlich fest eingewachsen zu sein. Ich hatte gutes Heilfleisch. Ihn interessierte das nicht. Mit einem kräftigen Ruck zog er die Drainage aus meiner unteren Extremität – und ich wurde kurz ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, verpasste ich ihm eine heftige Ohrfeige und fragte, ob er sie eigentlich noch alle hätte.
Rückblickend würde ich den damals empfundenen Schmerz heute auf der Schmerzskala bei 2 bis 3 einordnen. Vor 37 Jahren war er jedoch eine glatte 10. Damals wusste ich noch nicht, was es bedeutet, an ein und demselben Tag sowohl eine Prostatastanzbiopsie nach einer Prostatakarzinom-Diagnose als auch eine Harnleiterschieneneinlage (DJ-Schiene) aufgrund einer Harnstauungsniere über sich ergehen lassen zu müssen. Wohlgemerkt: bei Lokalanästhesie.
Wie war das noch gleich? Nur die Harten kommen in den Garten.
Die begleitende Dokumentation mit dem Titel „Die schlimmsten Stunden meines Lebens“ hätte garantiert eine FSK-18-Einstufung und dürfte nur nach vorheriger Qualifikationsselektion angeschaut werden. Und ich versuche hier noch gnädig zu sein.
Ich erspare allen Lesern weitere Details, auch deshalb, weil ich befürchte, sonst diesen traumatischen Tag noch einmal durchleben zu müssen. Die Definition eines medizinischen Traumas: durch Gewalteinwirkung entstandene Verletzung des Organismus.
Fairerweise möchte ich an dieser Stelle betonen, dass alle Ärztinnen und Ärzte, Assistentinnen und Assistenten sowie alle Helferinnen und Helfer ihr Bestes gegeben und alles versucht haben, die Prozeduren so schmerzfrei wie möglich durchzuführen. Am Ende bin ich dankbar, dass beides gelungen ist. Für mich war das eine grenzwertige Erfahrung, die ich bitte nicht wiederholen möchte. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte …
Am späten Nachmittag wurde ich entlassen und durfte nach Hause. Die freundliche Rezeptionistin hatte großes Mitgefühl mit mir und gab mir eine Frei-Parken-Karte. „Aber pst! Die sind sonst nur für Mitarbeiter“, flüsterte sie mir ins Ohr. Ich werde sie beim nächsten Mal umarmen. An diesem Tag war ich zu schwach.
10. September 2025
Um es im Social-Media-Sprech auszudrücken: Der Beziehungsstatus meiner neuen Harnleiterschienenfreundin und mir war „kompliziert“. Da ich glücklicherweise all die Jahre ohne Ersatzteile im Körper ausgekommen war – der ein oder andere Zahnersatz mal ausgenommen – musste ich nun feststellen, dass mein Innenleben das auch gerne so beibehalten hätte. Der Katheter jedoch stand mit dem extra großen Salzstreuer am Herd und versalzte uns kräftig die Suppe. Die ersten Tage waren extrem unangenehm. Darüber hinaus dachte ich bei jedem Ziehen und Bewegungsschmerz sofort, dass „sicher“ etwas Schlimmes passiert sei. Der rot verfärbte Urin machte die Angelegenheit auch nicht einfacher. Na ja, selbst wenn alles gut oder sogar sehr gut verlaufen sollte, hätten meine derzeitige Lebensabschnittspartnerin und ich ohnehin nur eine Kurzfristbeziehung. Der Katheter soll nämlich spätestens nach sechs Monaten wieder entfernt werden – diesmal dann definitiv unter Gabe von Propofol.
Nach der Biopsie war das Sitzen auf meiner Kehrseite ebenfalls nicht gerade die erste Wahl und so klickte ich mich wenig lustvoll durch die Angebote für Druckentlastungskissen bei einem bekannten Onlinehändler. Dabei erinnerte ich mich an die Worte einer guten Freundin, die vor ein paar Jahren leider an Brustkrebs erkrankt war. Sie sagte, dass sie bis zur Biopsie des Tumors eigentlich recht guter Dinge gewesen sei, ihr jedoch in diesem Moment schlagartig bewusst geworden sei, wie krank sie nun wirklich war. Der Schmerz der Stanzung war auch für sie traumatisch. Das Beste zum Schluss: Ihr konnte geholfen werden und sie gilt als geheilt.
Genau dieses Gefühl hatte ich jetzt auch. Mir war plötzlich klar, wie sehr krank ich wirklich war.
Ich hatte zwei untersuchungsfreie Tage vor mir und ließ es mir im Rahmen der Möglichkeiten gut gehen: lecker frühstücken, die warmen Sonnenstrahlen genießen, Kompensationsshopping. Ich gönnte mir eine Thai-Massage und traf mich mit meinen Lieblingsmenschen zum Schnacken und Tratschen. Das Leben ist schön, wenn es schön ist. Am zweiten Abend nach meinem „11. September“ traute ich mich wieder in die Sauna. Das war wunderbar entspannend und das kühle Nass des Außenschwimmbads war herrlich erfrischend und schmerzlindernd.
Am Freitag erwartete mich eine PET-CT-Untersuchung. Ich wollte ja schon immer mal auch von innen heraus strahlen. Ich sollte eine schwach radioaktive Flüssigkeit in die Armvene injiziert bekommen, damit sich das markierte Medikament in Geweben mit hoher Stoffwechselaktivität anreichert – wie beispielsweise in Tumoren – und so eine präzise Lokalisierung der Befunde ermöglicht.
Atomkraft – ja, bitte.
12. September 2025
Stadt, Land, Fluss. Zur PET-CT-Untersuchung musste ich nach Hochheim. Gut 32 Kilometer Landstraße, Felder, Natur. Alles sehr schön anzuschauen. Nach all den Jahren, die ich im Rhein-Main-Gebiet gelebt habe, wusste ich jedoch nicht einmal, dass es Hochheim gibt. Also tippte ich selbstbewusst „Frankfurter Straße 94, Hofheim“ in mein Navi – und los ging’s.
Irgendwie hatte ich allerdings eine Eingebung und schaute, während ich an einer roten Ampel wartete, noch einmal auf den Folder der radiologischen Praxis. Ähm, da stand: Frankfurter Straße 94 in Hochheim. Ups. Der Rechtsfreund liest bekanntlich immer bis zum Ende. Na ja, die generelle Richtung war doch schon mal richtig. Zum Glück war ich rechtzeitig und mit viel Zeit im Gepäck losgefahren, sodass der Umweg zu verschmerzen war. Ich kam 20 Minuten früher an.
Die Praxis hatte bereits alle meine Daten und ich musste mein Autogramm lediglich unter ein paar Einverständniserklärungen setzen. Danach bekam ich vom diensthabenden Arzt eine Ablaufbeschreibung und wurde in ein Spezialwartezimmer gebracht. Eine sehr freundliche Mitarbeiterin, ausgestattet mit einem Personendosimeter, legte mir einen Venenzugang und verabreichte mir das Radiopharmakon. Die gegebene Menge entspreche der Höhenstrahlung eines Nordatlantikflugs. Eine an sich gute Analogie. So richtig beruhigt hatte sie mich aber nicht, denn die medizinisch-technische Radiologieassistentin erklärte mir eindringlich, dass ich diesen Bereich nicht mehr verlassen dürfe, da ich sonst andere im Wartezimmer oder an der Rezeption kontaminieren könnte – speziell Schwangere. Ich wollte mir lieber nicht vorstellen, was das dann für sie selbst bedeutete. So richtig zuträglich für die Gesundheit kann das sicherlich nicht sein. Das nächste Mal bringe ich meinen Geigerzähler mit.
Damit es mir nicht langweilig wurde und ich während der einstündigen Einwirkzeit des radioaktiven Arzneimittels auch in Bewegung blieb, verabreichte mir die MTR zusätzlich ein Diuretikum und bat mich, mindestens einen halben Liter Wasser zu trinken. Zum Glück war das stille Örtchen nur ein paar Schritte vom leicht radioaktiv verseuchten Wartezimmer entfernt. Mit meinen sieben Entwässerungen in 60 Minuten sei ich angeblich in die Top 10 aufgenommen worden. Ich lächelte erleichtert.
Die PET-CT verlief problemlos und nach 30 Minuten durfte ich mich wieder ankleiden. Die Daten würden direkt an die Klinik übermittelt und die Mitarbeiterin wünschte mir aufrichtig viel Erfolg bei meiner Behandlung. Damit hatte ich die vorerst letzte Untersuchung hinter mich gebracht. Am Montag stand das Abschlussgespräch in der Klinik an. Nun hatte ich das Wochenende, um mich ein wenig von den physischen und psychischen Strapazen der letzten zwei Wochen zu erholen. Meine Tankfüllung blinkte bereits auf Reserve.
13. September 2025
Vorfreude war angesagt. Der gesamte Samstag war randvoll mit Begegnungen, Verabredungen und Gesprächen mit Menschen, die mir wichtig sind. Freunde, die zu Begleitern geworden sind. Weggefährten, die mir in den letzten Tagen ihre Herzen geöffnet hatten. Jetzt, da die unfassbare Anspannung der vergangenen zwei Wochen langsam von mir abfiel, wurde mir mit voller Wucht bewusst, wie außergewöhnlich dieses Netz aus Zuneigung, Wärme und Nähe ist, das mich trägt. Ich spürte tiefe Dankbarkeit. Und Liebe. Und den Trost, nicht allein zu sein. Das war überwältigend. Ich hatte zudem das unbeschreibliche Glück, in meinem Freundeskreis etliche Ärzte und medizinische Berater zu wissen. Nur dank ihrer Hilfe und ihres unermüdlichen Einsatzes war es überhaupt möglich, dass ich innerhalb von nur zwei Wochen von der ersten Computertomographie bis hin zum Abschlussgespräch und dem Beginn der Therapie gelangte.
Wie formulierte es Albert Einstein so treffend: „Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast.“
Ich legte mich zufrieden und liebe-voll ins Bett und begann, vor mich hin zu summen. La le lu.
14. September 2025
Da war er nun: mein Zusammenbruch. Im Französischen klingt das gleich viel eleganter und weniger dramatisch: rien ne va plus.
Der Sonntag begann sonnig und entspannt. Frühstück mit einem guten Freund: Rosinenzopf mit frischer Butter und aromatischem Kaffee. Wir übten uns im internationalen Frühshoppen mit zwei Journalisten aus vier Ländern und so ging es einmal quer durch den relevanten Themenwald. Von rien ne va plus war da noch keine Spur. Anschließend steuerte ich mein Lieblingscafé im Frankfurter Nordend an, bestellte einen Ingwer-Zitrone-Minze-Honig-Tee und beobachtete das gemächliche Sonntagstreiben. Alles war sehr relaxt.
Am Nachmittag fuhr ich in den Günthersburgpark, um einem guten Freund einen Besuch abzustatten. Eines seiner Kids feierte seinen Geburtstag nach und lud zum Spielen und Verweilen im Park ein. Ich sagte kurz Hallo und Happy Birthday und freute mich, alle wiederzusehen. Gerne wäre ich länger geblieben, doch plötzlich überfiel mich eine Welle aus Schwermut, Trübsinn, Wehmut, Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit und Betrübnis – genau in dieser Reihenfolge. Ich kündigte kurz an, dass ich mich wieder verabschieden wollte, und tat das stilecht auf Französisch. Mein Freund bot mir an, mich noch bis zum Auto zu begleiten, und so schlenderten wir plaudernd durch den Park zum Parkplatz zurück. Mein melancholisches Gefühl hatte offensichtlich Gefallen an der Gesellschaft gefunden und machte es sich bequem. Sein Bedarf an Egozentrismus war offensichtlich noch nicht gedeckt.
Wir redeten über meine „Hätte durchaus besser sein können“-Kindheit und über meine mittlerweile erwachsenen Kinder, als ich – kaum wahrnehmbar – meine Traurigkeits- und Kummerprotagonisten im Oberstübchen die Anweisung geben hörte: „Schleusen auf – Wasser marsch!“, oder so ähnlich. Wer jetzt wissen möchte, wie sich ein heulendes Elend anfühlt, darf mich gerne fragen. Ich bin seitdem der absolute Spezialist. Ich glaube, ich habe locker eine halbe Stunde durchgeheult und dabei sogar die allerletzte Träne aus mir herausgeholt. Ich konnte einfach nicht mehr. Das war alles zu viel. Viel zu viel. Das brachte mich auf die Knie. Ich bin froh, dass mein unglaublich empathischer Freund nicht unter Klaustrophobie leidet — so konnte ich ihn unentwegt umarmen und festhalten.
Danach ging es mir deutlich besser. Weinen: ein Stressabbau-Mechanismus, der Stresshormone aus dem Körper schwemmt und so zur Entspannung beiträgt.
So ist es.
15. September 2025
Ich traf pünktlich um 10 Uhr zur vorläufigen Abschlussbesprechung in der Klinik ein. Der Befund stand ja bereits fest; nun ging es um das weitere Vorgehen.
Mein neuer Therapieplan:
Es sollte jetzt richtig losgehen. Die Chefärztin entschied sich für eine sogenannte Triple-Therapie – der Krebs wird gleichzeitig von drei Seiten angegriffen. Sie erklärte mir alles sehr klar und ausführlich.
– Darolutamid (Tabletten): morgens und abends je zwei Stück. Die Tabletten blockieren die Wirkung von Testosteron – dem Hormon, das meinen Krebs füttert.
– Trenantone (Spritze): wird alle drei Monate verabreicht. Damit wird die körpereigene Testosteronproduktion nahezu vollständig heruntergefahren – gewissermaßen der Benzinhahn abgedreht.
– Docetaxel (Chemotherapie): ab dem 06.10. alle drei Wochen als Infusion und maximal sechs Anwendungen. Das Medikament wirkt direkt in den Zellen, verhindert ihre unkontrollierte Teilung und – hoffentlich – zerstört die Metastasen vollständig.
Parallel ging es auch um die Knochengesundheit, weil Metastasen Knochen instabil machen können und dadurch eine Bruchgefahr besteht. Vorgesehen sind:
– Denosumab (Prolia-Spritze): alle sechs Monate, damit die Knochen stabil bleiben.
– Täglich Calcium plus Vitamin D3 – sozusagen Knochenwiederaufbau-Futter.
Falls einzelne Metastasen besonders kritisch sind und die Stabilität gefährden, kommt zusätzlich eine gezielte Strahlentherapie in Betracht, um die betroffenen Knochen zu stützen.
Ich bekam noch ein Rezept für die Testosteronblocker sowie das hochdosierte Calcium plus Vitamin D3. Die Chefärztin verabschiedete mich sehr herzlich und wünschte mir viel Erfolg. Den wünschte ich mir auch – und überlegte, ob ich meinen Krebs Napoleon Bonaparte nennen sollte, und ihn gleich auf sein bevorstehendes Waterloo hinzuweisen. Gedanklich saß ich schon auf meinem arabischen Schimmelhengst und ritt zur Schlacht.
In diesem Fall war das allerdings erstmal nur der Ritt in die Apotheke um die Ecke, wo ich die beiden verordneten Medikamente kaufen wollte. Dort erklärte man mir, sie seien nicht vorrätig und ich solle doch gegen 16 Uhr wiederkommen, um die Arzneimittel abzuholen. Man gab mir noch einen Abholschein mit. „48,50 €“ stand dort gut lesbar. Ich fragte, was die sechsstellige Zahl oberhalb des Betrags bedeute – die Abholnummer? Die Apothekerin betrachtete den Beleg und meinte beinahe nebenbei, das sei der Preis für den Testosteronblocker und ob ich das später bar oder mit Karte zahlen wolle. Dort stand: 3.526,39 €.
Ich fragte sie, wer denn so viel Bargeld mit sich herumtragen würde. Sie sah mich an, als hätte sie die Frage nicht ganz verstanden.
Um 16 Uhr holte ich die verschriebene Medizin ab und nahm die ersten beiden Tabletten.
„Aux armes, citoyens!“
19. September 2025
Dienstag: nichts
Mittwoch: nichts
Donnerstag: nichts
Freitag: nichts
So darf das gerne weitergehen. Bis dato hatte ich keine Nebenwirkungen. Umso erfreulicher war die Beobachtung, dass sich das vergrößerte Lymphknoten-Ensemble oberhalb meines Schlüsselbeins merklich verkleinert hatte. Freu! Das ging erstaunlich schnell.
Am kommenden Montag standen dann die nächsten beiden wichtigen Termine an: morgens bei der Onkologin, nachmittags beim Urologen. Bei der Onkologin sollte es um die weitere Therapie und speziell die Chemotherapie gehen, beim Urologen um die wichtigste Säule meiner Dreifach-Therapie: die Trenantone-Spritze. Und tschüss, Testosteron.
Bis dahin vertrieb ich mir die Zeit mit schönen Dingen und war froh, wieder so etwas wie Alltag zu haben. Meine neue Routine hatte begonnen. Draußen Rennradeln war vorerst nicht mehr drin – die Gefahr eines Sturzes und einer damit verbundenen Fraktur war einfach zu hoch. Also wurde im Gym geradelt. Nicht ganz so abwechslungsreich, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. In die Sauna durfte ich dafür weiterhin gehen. Ein kleiner Schritt, noch ein kleiner Schritt – und noch einer.
So kommt man auch ans Ziel.
20. September 2025
Am Wochenende stand die Marie-Kondo-Methode auf dem Programm. Ich hatte bereits Oma 1, Opa 1 und Oma 2 auf ihren letzten Metern fürsorglich begleiten dürfen – und durfte mich danach jeweils auch um ihren verbliebenen Hausstand kümmern. Das war jedes Mal im sprichwörtlichen Sinne „Containern“. Und mit einem Entrümpelungscontainer von 10 m³ war es nie getan.
Der Durchschnittseuropäer besitzt laut Schätzungen rund 10.000 Gegenstände. Vor 100 Jahren kam ein Haushalt mit etwa 180 Dingen aus. Etwas weniger als heutzutage. Werden dabei eigentlich Messer und Gabel einzeln gezählt? Socken? Egal.
Ich bin in meinem Leben bereits 16-mal umgezogen und hatte dadurch mehrfach Gelegenheit, mich von unnützem Ballast zu trennen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Da es so aussah, als hätte jemand ein wenig an meiner Lebensuhr geschraubt, wollte ich schon mal damit beginnen, meinen Hausstand merklich zu verringern. Motto: „Weißt du, wofür Papa das gebraucht hat? – Was ist das eigentlich? – Ich glaube, das ist eine Schallplatte. – Ach, und was macht man damit?“. Also legte ich los und lichtete ein paar Schubladen. Ergebnis der ersten Session: nur noch 9.912 Gegenstände.
Dabei fiel mir ein, dass ich mich auch noch um mein Testament kümmern sollte. Meinen letzten Willen. Hatte ich überhaupt einen? Und natürlich auch eine Patientenverfügung sowie einen digitalen Nachlass, der den Umgang mit meinen Daten nach dem Tod regelt. Ja … das mache ich beim nächsten Mal. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut. Übrigens: Rom wurde 753 v.Chr. gegründet. Am heutigen Rom wird also bereits seit 2.772 Jahren gebaut. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Mein notwendiger Papierkram konnte somit auch noch ein paar Tage warten. Ich gesellte mich lieber wieder zu Marie und räumte weiter aus.
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes gelangt.
21. September 2025
Da mich bisher noch niemand gefragt hat, was der Titel meines Blogs eigentlich bedeutet, beantworte ich die Frage einfach selbst. In der englischen Übersetzung wird es übrigens auch nicht viel klarer: Ohnhoff despair lack of deception. Den Versuch, das DeepL-Ergebnis wieder zurück ins Deutsche zu übersetzen, spare ich mir gleich.
Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit ist eine Wortschöpfung aus:
Ohnmacht
Hoffnung
Verzweiflung
Enttäuschung
Hilflosigkeit
Dieses Wort beschreibt genau das Gefühl, das ich empfand, als ich zum ersten Mal die niederschmetternde Diagnose am Telefon erfuhr. Aus dieser dunklen Ausweglosigkeit ist inzwischen immerhin ein zaghafter Sonnenaufgang geworden. Na gut – ich will nicht übertreiben. Sagen wir: ein paar vorsichtige Sonnenstrahlen am Horizont.
„Es werde Licht – und es ward Licht.“
Der Autor ist nicht wirklich bekannt.
22. September 2025
Auf der Therapieleiter ging es heute gleich zwei Stufen nach oben. Um 12:30 Uhr hatte ich den Besprechungstermin mit meiner Onkologin, einer Fachärztin für Krebs, und am Nachmittag fand mein Urologe noch ein Plätzchen im ausgebuchten Kalender. Er sollte mir die erste Hormonspritze verabreichen.
Mit der Onkologin besprach ich die anstehende Chemotherapie. Am 6. Oktober sollte es losgehen: Erst Blutabnahme, dann eine Stunde auf die Ergebnisse warten, anschließend etwa zwei Stunden Therapie – intravenös, direkt über die Armvene. Ich sollte mich darauf einstellen, dass ich an den beiden Tagen danach eher keine Bäume ausreißen könnte. Selbst Grashalme könnten zu viel sein. Aber: Schritt für Schritt würde es danach wieder besser gehen. Ich hätte ja dann drei Wochen Regeneration bis zur nächsten Sitzung.
Ich hatte mich in den letzten Tagen häufig mit meinen Medizinern und auch mit Betroffenen unterhalten. Die Entwicklung, die die Medizin in den letzten Jahrzehnten genommen hat, ist unfassbar. Auch wenn der Begriff eigentlich das Gegenteil ausdrücken soll, benutze ich ihn trotzdem: Das sind Quantensprünge – speziell in der Krebsbehandlung. Ein Toast auf den Fortschritt!
Um das Ganze mal mit einer Fußballanalogie zu erklären: Früher war Krebs der FC Übermächtig (warum wollte ich reflexartig „FC Bayern“ schreiben?!). Ein Gegner, der unbesiegbar schien. Unsere medizinische Mannschaft war damals spärlich besetzt – ein einsamer Stürmer (Operation) und vielleicht noch ein Verteidiger (Strahlentherapie). Keine Auswechselspieler, keine Taktik, nur „lange Bälle nach vorne und hoffen“. Ein Hail-Mary-Pass auf dem Fußballfeld.
Heute sieht das anders aus: Auf dem Platz steht eine komplette Elf. Hormontherapie im Mittelfeld, die den Ballfluss des Gegners stoppt. Immuntherapie als quirliger Flügelspieler, der permanent nervt. Smarte Tabletten mit GPS als Spielmacher, der punktgenaue Pässe verteilt. Und wenn es sein muss, kommt die Chemotherapie als bulliger Innenverteidiger rein, der aufräumt – nicht elegant, aber kompromisslos effektiv. Ein echter Juan Antonio Goicoechea. Hieß der wirklich der Schlächter von Bilbao? Autsch.
Die Medizin hat also längst aus einer „Abwehrschlacht gegen den Abstieg“ ein Champions-League-Spiel gemacht. Klar, der Gegner bleibt stark. Aber er ist schlagbar – notfalls mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Ich schnürte mir gedanklich schon mal die Fußballschuhe und prüfte die Stollen. In diesem Fall die aus Stahl.
Am Nachmittag wurde dann noch der Stürmer eingewechselt – sozusagen der Cristiano Ronaldo unter den Hormonspritzen. Meine Bauchdecke fragte mich zwar mit leicht schmerzverzerrtem Unterton, was das nun schon wieder soll, aber ich war einfach froh, dass damit der zweite und wichtigste Teil der Therapie gestartet war.
Zum Abschluss ging’s noch einmal zum Blutspendedienst – so hält man auch seinen milden Bluthochdruck etwas in Schach. Und um es gleich vorwegzunehmen: PSA 4,02 ng/ml.
Am frühen Abend erreichte mich die Nachricht, dass ich am Donnerstag einen Termin in der Radiologie hätte. Weniger erfreulich: Die Metastasen hatten meine beiden Oberschenkelhälse und den rechten Oberarmknochen doch deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Man müsse rasch mit einer perkutanen Strahlentherapie gegensteuern, um das Risiko von Knochenbrüchen und weiteren Komplikationen zu verringern.
Gerade noch wollte ich alkoholfreien und leberschonenden Champagner entkorken, um meinen PSA-Wert zu feiern – da rauschte die Achterbahn schon wieder nach unten. Seit dieser Nachricht laufe ich ein wenig wie auf Watte. Und trainiere fürs Erste meine linke Hand.
25. September 2025
Um 9 Uhr saß ich in der Sprechstunde der Radiologin. Mit meinen Ärztinnen hatte ich wirklich großes Glück. Sowohl meine Hausärztin, meine Urologin, meine Onkologin als auch meine Fachärztin für Strahlentherapie waren Helferinnen, Beistand, Unterstützerinnen – und vor allem sehr gute Zuhörerinnen. Das gilt natürlich genauso für die männlichen Vertreter der Zunft, die in dieser schweren Zeit an meiner Seite stehen. Fortuna meinte es bislang sehr gut mit mir.
Am nächsten Dienstag stand also mal wieder eine Computertomographie an und am darauffolgenden Tag sollte die Bestrahlung erfolgen. Über Abwechslung in meinem Terminkalender konnte ich mich wirklich nicht beklagen.
26. September 2025
Die meisten aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis wissen, dass ich mich schon seit Jahrzehnten vegetarisch ernähre. Irgendwann hatte ich damals die Schnauze voll. Ein Fleischskandal jagte den nächsten: Schweinepest, Salmonellenausbruch in industriell angelegten Hühnerställen, Massentierhaltung, BSE – auch als Rinderwahnsinn bezeichnet. Die Liste ließe sich endlos weiterführen. Erst verzichtete ich auf Fleisch, später ließ ich auch die Fische in Ruhe weiterschwimmen. Fun Fact: Einer der stärksten Menschen auf unserem Planeten ist Patrik Baboumian – und er ernährt sich sogar vegan. So viel zum Thema Man muss Fleisch essen, um leistungsfähig zu sein.
Am Montag saß ich bei meiner Onkologin in der Besprechung, während sie mir mögliche Folgen der Chemotherapie erläuterte. Bei einer Chemotherapie kann es zu einem Eisenmangel und einer damit verbundenen Anämie (Blutarmut) kommen. Das könnte man allerdings mit Eisen- und Mineralpräparaten behandeln. Oder – ich sollte einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch essen.
Mein Magenwächter schwenkte sofort die rote Flagge und erhob Einspruch. Nachvollziehbar. Ich muss ebenfalls ein wenig verdutzt dreingeschaut haben. Allerdings – eines muss man ihr lassen: Sie war humorvoll kreativ. Sie sagte: „Robert, Sie essen doch dann kein Fleisch, Sie nehmen lediglich eine Medizin zu sich.“
Chapeau!
Da fiel mir sofort wieder die Entstehungsgeschichte der Maultaschen (in Italien sagt man dazu Ravioli) ein. Ein findiger Laienmönch namens Jakob aus dem schwäbischen Kloster Maulbronn versteckte während der Fastenzeit Fleisch in Teigtaschen, um es vor dem Verzehr zu tarnen – so erhielten Maultaschen den schwäbischen Spitznamen Herrgottsbescheißerle. Im Mittelalter, besonders während der Fastenzeit, war der Verzehr von Fleisch nämlich verboten.
Ich werde dann demnächst beim Italiener um die Ecke ein Bistecca al Ferro bestellen und die Rechnung bei meiner Krankenkasse als Rezept einreichen. Meinem Pförtner der Feinkostverarbeitungsstation gebe ich dann an diesem Tag frei.
Und da ich einige Jahre in der Medizinfortbildungsfilmbranche gearbeitet habe (sind die Schachtelworte, die wir im Deutschen bilden können, nicht einfach klasse?), ging mir das eine oder andere medizinische Wort leichter in den Gehörgang und in meine Sprachzentren als anderen, die mit dem Heilkundewortschatz eher weniger anfangen konnten. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis klingt doch auch viel eindrucksvoller als einfach nur „eine Lungenkrankheit“.
Ich wollte endlich mal Ordnung in den Papierstapel aus Befunden, Analysen und Rechnungen bringen. Der Bürokrat in mir bat um Aufmerksamkeit. Dabei fiel mir auch der Befund der PET-CT-Untersuchung in die Hände. Diesem hatte ich bis dato noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Mit meinem medizinischen Duolingo-Wortschatz kam ich allerdings nicht weiter und bat schwachsinnigerweise ChatGPT um Unterstützung. Hätte ich wohl besser bleiben lassen.
Hier die Antwort:
Die Knochen sind durch die Tumorherde so geschwächt, dass sie instabil werden. Das bedeutet ein hohes Risiko für Knochenbrüche (pathologische Frakturen), insbesondere an den genannten Stellen. In solchen Fällen empfehlen Ärzte oft eine operative Stabilisierung (z.B. Verplattung, Marknagel, Prothese) oder eine Bestrahlung, um die Stabilität zu verbessern und Schmerzen vorzubeugen. Bettruhe sollte in Betracht gezogen werden.
Motto: Wie versaue ich mir den Tag ohne Notwendigkeit. Mein Großvater pflegte zu sagen: „Wer lange fragt, geht lange irr.“
Allerdings war die bildhafte Darstellung der Radiologin auch nicht viel besser: „Hm, wie kann ich Ihnen die Instabilität am besten erklären? Stellen Sie sich vor, Sie hätten an einigen Stellen in den betroffenen Knochen kleine Wattebällchen …“
Ich beschloss, mich bei mittlerer Temperatur ins Bett zu legen und zu warten, bis der letzte Schlag kommt.
27. September 2025
Ein kleiner Allgemeinbildungstest am Morgen: Wer ist „Schlafes Bruder“? Na? Und? Klingt zumindest schon mal wesentlich ohrenwohlwollender als „der Tod“. Der Tod und der Krebs (beide maskulin – vielleicht liegt es auch daran) sind in unserem Sprachgebrauch und in unserer Gesellschaft eher schlecht beleumundet. Der Krebs muss dann häufig auf den „rebs“ verzichten und wird auf das „K“ reduziert. Das K-Wort. Der Tod hat einen ähnlich schweren Stand. Wir vermeiden die drei Buchstaben und benutzen stattdessen lieber Umschreibungen wie: entschlafen, seine letzte Reise antreten, das Zeitliche segnen oder die ewige Ruhe finden. Warum heißt es eigentlich „über die Wupper gehen“? Wim Thoelke würde jetzt fragen: „Umschlag eins, zwei oder drei?“
Goethe sah den Tod als „Kunstgriff der Natur“, der das Leben ermöglicht, und beschrieb die Verliebtheit als „das angenehme Gefühl, als wenn man bei Sonnenaufgang stürbe“. Sokrates stellte die Frage, ob der Tod nicht das größte Geschenk überhaupt sei.
Die deutsche Übersetzung des Buchtitels von Ruth Picardie (im englischen Original: Before I say goodbye) lautet: „Es wird mir fehlen, das Leben“. Ich möchte diesen wunderschönen Titel für mich etwas modifizieren: „Es würde mir fehlen, das Leben“. Auch Christoph Schlingensief gab seinem Buch einen bemerkenswerten Titel: „So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein!“.
Ich saß vor ein paar Wochen mit meinem guten Freund und langjährigen Wegbegleiter wieder mal beim Frühstück und wir podcasteten uns durch für uns relevante Themen. Aus aktuellem Anlass stand Schlafes Bruder auf dem Programm. Er hatte (wieder mal) einen unfassbar klaren Moment und gab folgende Analogie zum Besten:
Geboren zu werden und zu leben, ist wie auf eine Party eingeladen zu werden, die um 22 Uhr beginnt und um 6 Uhr morgens endet. Acht Stunden – stellvertretend für acht Jahrzehnte Lebenszeit, die wir im Schnitt haben. Er schaute mich mit einem Blick aus Dankbarkeit und Traurigkeit an und sagte: „… und du hast bereits bis um 4 Uhr morgens durchgetanzt und hattest bis jetzt eine absolut geile Party“.
Er pauschalisierte weiter und erklärte, dass es keine Garantie dafür gäbe, dass die Lebensparty zwischen 4 Uhr und 6 Uhr morgens überhaupt noch gut sei. Den wahrscheinlich besten Teil der Veranstaltung hätten wir bereits hinter uns. Ein anderes Gleichnis von ihm: Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Wir sitzen jetzt auf der überdachten Tribüne und genießen die Nachspielzeit. Eine kuschelige Decke auf den Knien, die Movie-Night-Giant-Popcorn-Box auf dem Schoß.
Vielleicht schaffen wir es ja ins Elfmeterschießen.
Hier mal eine (nicht ganz ernstzunehmende) Statistik für die letzten beiden Stunden der Party:
– 30 von 100 Personen landen irgendwann beim Orthopäden und entdecken, dass es neben der Brille auch andere hilfreiche Gelenk-Ersatzteile gibt.
– 20 von 100 Personen machen Bekanntschaft mit der Demenz-Lotterie.
– 15 von 100 Personen müssen lernen, dass das Wort „Hörgerät“ nichts mit Apple oder Bluetooth-Lifestyle zu tun hat.
– 40 von 100 Personen haben irgendwann den Clubausweis für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Tasche – Bonuspunkte für Bypass oder Stent.
– 25 von 100 Personen ziehen sich eine Krebserkrankung ins Lebensgepäck – nicht schön, aber die Medizin spielt mittlerweile Champions League.
– 50 von 100 Personen haben mindestens eine chronische Zipperlein-Baustelle: Diabetes, Bluthochdruck, Arthrose … die Klassiker eben, kurzweilige Themen fürs nächste Treffen mit Freunden.
– 30 von 100 Personen lernen, dass die Blase nachts nicht mehr so kooperativ ist wie früher.
– 100 von 100 Personen entdecken, dass das Wort „Rente“ nichts mit einer Luxus-Karibik-Kreuzfahrt zu tun hat, sondern mit einem neuen Volkssport: Warten – auf Arzttermine, Medikamente, Pflegekräfte, den Enkelanruf.
Und am Ende gilt: 100 von 100 Personen verabschieden sich – irgendwann, irgendwo, irgendwie.
„Wer müsste nicht erkennen, wie überflüssig er/sie trotz seltener Talente und großer Verdienste war, wenn er/sie bedenkt, dass er/sie sterbend eine Welt verlässt, die ihn/sie nicht vermisst, und wo sich viele finden, die ihn/sie ersetzen möchten?“
(Bruyère – gendergerecht modifiziert)
28. September 2025
Kognitive Dissonanz. Warum etwas mit einfachen Worten ausdrücken, wenn es auch komplizierter geht. Eigentlich müsste ich es sogar kognitiv-physische Dissonanz nennen. Zack – und schon wieder ein neues Schachtelwort. Dreifacher Wortwert beim Scrabble. Weiter unten mehr dazu.
Vor zwei Tagen erhielt ich eine sehr liebenswerte Nachricht vom Dach des Himalaja. Na ja, nicht von ganz oben, sondern aus Ladakh, bekannt für seine malerischen Bergpanoramen. Immerhin noch auf einer Höhe von gut 3.500 Metern. Meine Hausärztin urlaubte mal wieder durch die Welt. Gut so.
Das Wort „liebenswert“ sagt sich ganz schnell und einfach so dahin. Es bedeutet: wert, etwas zu lieben. Genau das war ihre Nachricht. Sie fragte mich, wie es meiner Seele gehen würde, weil diese gerne im Agieren der Schulmedizin vergessen wird, und fügte hinzu, dass ich mich – wenn es für mich möglich wäre – nicht krankreden lassen solle. Vor allem, wenn ich mich nicht krank fühle. Dazu schickte sie mir noch ein kurzes Video, das sich im Uhrzeigersinn drehende tibetische Gebetsmühlen zeigte. Om mani padme hum. Dieses Mantra steht für universelles Mitgefühl und die Erlangung der Erleuchtung. Einfach liebenswert. Ich Glücklicher.
Womit ich wieder bei der Dissonanz angelangt wäre. Über drei Wochen nach der Erstdiagnose fühle ich mich ziemlich fit und gesund – den Katheter lassen wir mal außen vor. Vor zwölf Tagen habe ich mit der ersten Therapiestufe begonnen. Vor fünf Tagen mit der zweiten. Keine Nebenwirkungen. Der PSA-Wert hat sich sehr verbessert und die geschwollenen Lymphknoten haben sich fast ganz zurückgebildet. Ich weiß zwar um die Bruchgefahr meiner Knochen, aber ich spüre nichts. Ich laufe wie auf rohen Eiern, und meine Schaltzentrale fragt mich die ganze Zeit: „Was machst du da und warum?“ Genau das fühlt sich so verrückt an. Dissonant. Die maximale Diskrepanz zwischen Kognition – also der Informationsverarbeitung in meinem Gehirn – und meiner körperlichen Empfindung. Irre.
Wenn man eine schwere Grippe hat, liegt man in der Regel mit erhöhter Temperatur im Bett, hat Gliederschmerzen und Kopfweh. Alles schmerzt. Man ist und man fühlt sich krank und hat zu nichts Lust. Ich fühle mich zurzeit wie vor fünf Jahren, als ich dreimal positiv getestet wurde und jedes Mal keine Symptome entwickelt hatte. Ich hatte damals positive Covid-19-Diagnosen, fühlte mich aber gesund. Ich habe heute eine Prostatakarzinom-Diagnose, aber ich fühle mich gesund. Das ist (fast nicht) zu verstehen.
Meine leitende Ärztin der Klinik sagte mir, dass ich nicht mehr geheilt werden könne, dass ich mich nun in palliativmedizinischer Betreuung befände. Verstanden – im logischen Sinne – habe ich das alles. Es fühlt sich allerdings so an, als wären meine Kognition und meine Physis nicht (mehr) verbunden. Körperlich, emotional kann ich dem logisch Berichteten (noch) nicht folgen.
Die Globetrotterin ergänzte noch, dass sie sich für mich freue, dass ich mich nicht krank fühle, und schrieb, das würde es jedoch für den Kopf nicht einfacher machen. Sie schloss mit: „Nimm’s als Geschenk.“ Happy birthday to me. Genau das werde ich tun.
Und hier auch noch, mal weil es so schön ist, als Lautschrift: [ˈaɪ̯nfax ˈliːbənsvʏʁt]
Love actually – actually love
Der Wie-auf-Eierschalen-gehen-Modus eröffnete meinem sonst auf der Überholspur des Lebens fahrenden Schützen eine völlig neue Erkenntnis: die Entdeckung der Langsamkeit. Oder, um es noch klarer auszudrücken: Meine Wahrnehmung änderte sich. Etwas wahr-nehmen – wieder so eine geniale Wortschöpfung. „Perzeption“ klingt dagegen eher wie eine trockene Fußnote im Beipackzettel. In den Worten eines englischen Schriftstellers: „Wie es Euch gefällt.“
Es gibt so ein paar Gewohnheitsstandards, die sich – warum auch immer – durchgesetzt haben. Früher war das am Sonntagabend: erst „Tatort“ um 20:15 Uhr und direkt im Anschluss „Sabine Christiansen“ schauen. Muss man nicht verstehen. Bis heute hat sich die „Tagesschau“ gehalten. Auch fragwürdig. Ich liebe die deutsche Sprache – würdig, hinterfragt zu werden. In die Liste der „Das haben wir schon immer so gemacht“-Klassiker gehört auch der Film Love Actually. Eine feste Institution zur Weihnachtszeit. Das modernere „Dinner for One“. Der Film selbst: extrem leichte Kost. Man darf beruhigt einen Großteil der Großhirnrinde in den Feierabend schicken – der Film funktioniert eigentlich auch ganz ohne. Aber: Die Anfangsszene hat mich schon immer sehr berührt. Hier meine freie Übersetzung des Off-Kommentars:
„Wenn mich mal wieder das Gefühl packt, dass die Welt komplett aus den Fugen gerät, denke ich sofort an die Ankunftshalle in Heathrow. Alle reden davon, dass alles nur Hass und Gier sei – aber ehrlich? Ich sehe das anders. Liebe ist überall. Oft unspektakulär, manchmal chaotisch – aber immer da. Bei Müttern und Vätern, die ihre Kids abholen. Bei Paaren, die sich nach Monaten wiedersehen. Bei alten Freunden, die sich in die Arme fallen. Selbst am 11. September, als die Flugzeuge ins World Trade Center krachten – die letzten Anrufe waren keine Worte voller Wut oder Vergeltung. Es waren Worte voller Liebe. Und wenn man genau hinschaut, merkt man: Liebe ist wirklich überall.“
Während die Erzählstimme das wiedergibt, sieht man Menschen, die sich herzlich begegnen – liebevoll, glücklich, überrascht. Und während ich diese Szene auf YouTube anschaue und ins Deutsche übersetze, kommen mir die Tränen. Von wegen „Nur die Harten kommen in den Garten“ und „Männer weinen nicht“. Ab mit den Klischees in die Mottenkiste.
Die Entschleunigung bewirkt, dass ich meine Umwelt anders, genauer, intensiver wahrnehme. Brauchte ich früher 5 Minuten bis zum Supermarkt, benötige ich jetzt fast doppelt so lange. Anstatt aufs Handy zu starren, schaue ich mich um, grüße Menschen, die ich vorher nicht einmal bemerkt hätte, und nehme Augenblicke wahr, die früher an mir vorbeigehuscht sind. Kleine Szenen wie aus dieser Heathrow-Szene: Kassiererinnen, die sich herzlich begrüßen. Mütter mit ihren Kindern. Obdachlose, die versuchen ihren Alltag zu meistern. Früher habe ich das sicher auch gesehen – aber nicht wahrgenommen. Und das fühlt sich erstaunlich gut an.
In den Worten von Louis Armstrong: „And I think to myself – What a wonderful world“.
Wie heißt es so treffend: „Eine Kerze, die doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lang.“ Ich pustete den zweiten Docht aus.
Nein, das ist keine Zeitlupe. Ich laufe jetzt wirklich so langsam.
29. September 2025
Johann Wolfgang von Goethe – Dichter, Politiker, Naturforscher und bedeutendster Schöpfer deutschsprachiger Dichtung – soll auf dem Sterbebett gesagt haben: „Mehr Licht …“. Die gängigste Interpretation: Goethe bat seinen Diener, den Fensterladen zu öffnen, damit mehr Licht in das Sterbezimmer kommt. Er wünschte sich mehr Helligkeit.
Nicht wenige Frankfurter – die vom Main – sehen das etwas anders und vertreten die Meinung, dass er „Me lischt … hia so schlescht“ sagen wollte. Zu „hia so schlescht“ kam es dann bekanntlich nicht mehr. Für alle Nicht-Hessen bzw. Nicht-Frankfurter hier die Übersetzung ins Hochdeutsche: „Man liegt … hier so schlecht“. Ich tendiere zur Mundartversion. Nachvollziehbar. Wer will schon im Sterbebett liegen und sterben.
In der Disney-Plus-Miniserie „Dying for Sex“ – ins etwas holprige Deutsch mit „Sterben für Sex“ oder „Unbedingt Sex wollen“ übersetzt – bekommt die im Sterben liegende Molly von der Palliativkrankenschwester Amy erklärt, was passiert, wenn man stirbt.
Hinweis: Wem das zu viel ist, der kann gerne beim nächsten Blogeintrag weiterlesen.
Hier die Übersetzung der Szene:
„Der Tod ist kein Mysterium. Er ist keine medizinische Katastrophe. Er ist ein körperlicher Vorgang, wie eine Geburt oder wie auf die Toilette gehen oder husten oder einen Orgasmus haben. Der Körper weiß, was zu tun ist. Der Körper weiß, wie man stirbt. Hier ist, was passieren wird:
Im letzten Monat des Lebens wird man nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Man wird viel weniger essen und trinken und viel mehr schlafen. Delirium ist sehr häufig, und manche Menschen sagen, sie hätten das Gefühl, die Zeit würde aufhören, real zu sein. In den letzten zwei bis drei Wochen wird man bei allen täglichen Aktivitäten Hilfe brauchen. Der Körper weiß, was kommt, und geht in einen Zustand der Ketose über, der Hunger und Schmerzen verringert und das Gefühl der Euphorie verstärkt. Man fängt an, aktiv zu sterben.
Aktives Sterben ist eine heilige Zeit – zumindest war es das früher. Und in einigen Teilen der Welt ist es das immer noch. Es ist der Moment, in dem man dem Tod sehr nahe ist und der Körper beginnt, sich abzuschalten. Im Sterbeprozess ist man nicht mehr bei vollem Bewusstsein, und die Kiefermuskeln entspannen sich. Die Atmung verändert sich, und es kann zu einem gurgelnden Geräusch im Rachen kommen, das durch etwas verursacht wird, das als „terminale Sekrete“ bezeichnet wird.
Und wenn man dem Tod sehr nahe ist, geht die Atmung in einen Zyklus aus tiefen, langsamen Atemzügen und langen Pausen über. Und schließlich gibt es einen Ausatemzug, auf den kein Einatemzug folgt. Und das war’s dann.
Genau diesen Vorgang habe ich bei Oma 1 und Opa 1 miterlebt, als ich beide auf ihrem letzten Lebensabschnitt begleiten durfte.
Ich möchte gerne noch sehr lange darauf warten, bis dieser Vorgang bei mir eintritt. Ich habe es überhaupt nicht eilig. Gar nicht.
Hallo? Ich wünsche mir, dass mich alle gehört haben.
Postskriptum zum heutigen Tage
Für den Fall, dass die letzten Posts einen eventuell zu morbiden Unterton hatten, hier mal – zur Abwechslung – etwas Erfreuliches.
Bei aller zuvor beschriebenen Dissonanz: Ich fühle mich gut. Nach wie vor keine Nebenwirkungen. Zumindest keine bemerkenswerten. Meine Hobby-Hypochondrie bricht sich zwar weiterhin an unvorhergesehenen Stellen Bahn, aber was soll’s. Ich notiere brav jedes Ziepen, Zwicken, Brennen – und mache trotzdem genau da weiter, wo ich zuvor unterbrochen wurde. Offensichtlich produziert mein Körper sein eigenes Ritalin.
Gestern waren gute Freunde zu Besuch. Chef Roberto schwang den Kochlöffel und sang dazu „Smørrebrød, Smørrebrød, Röm Töm Töm Töm …“. Es gab Cocktailtomaten-Bruschetta, mexikanische Nachos mit Käse und frischem Oregano überbacken sowie grillfrische Käse-Tomaten-Sandwiches. An Chilis wurde nicht gespart – und so saßen wir alle mit leicht tränenden Augen am Tisch und fächelten uns Luft zu. Capsaicin unterstützt bekanntlich die Herzgesundheit, wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend. Genau das Richtige für den Patienten. Gesundwerden durch Nahrungsaufnahme. Die Schlussnote: ein Thermomix-Früchteschaumtraum aus gefrorenen Bananen und Erdbeeren. Der Zuckeranteil wurde aus gegebenem Anlass drastisch reduziert. God appetit, Röm Töm Töm Töm.
Unter den Gästen war auch eine bezaubernde junge Dame. Mehr Neugier und Energie mit lediglich 9 Jahren geht nicht. Sollte das Duracell-Häschen je ein neues Werbegesicht benötigen: voilà. Ich sollte ihr erklären, was mit mir los sei – denn normalerweise waren wir immer am Rumalbern und Herumtollen, inklusive „Ich-bin-eine-Spinne-und-laufe-kopfunter-an-der-Zimmerdecke-entlang“. Ich hoffe, ich habe es kindgerecht hinbekommen. Ich erzählte von einem Krebs in mir, der nur Unsinn im Kopf hat, mich ärgern und mir ein bisschen wehtun will. Es würde ein paar Monate dauern, aber dann – versprach ich – wird wieder herumgetollt.
Heute sah ich sie kurz wieder. Sie fragte mich: „Wie geht’s deinem Krebs?“
Spätestens in solch einem Moment muss man sich verlieben.
Carpe diem
Im Alltag – sprich, wenn wir uns wieder mal im Modus der Mehrfachaufgaben-Performanz befinden – ziehen viele Dinge unbemerkt an uns vorbei. Natürlich kann man artistisch den Milchkaffee-to-go in der linken Hand halten und gleichzeitig das Lenkrad steuern, während man seinen Lieblingssongs auf Spotify lauscht, die gerade erhaltene WhatsApp neugierig liest und mit der rechten Hand die Antwort tippt. Wenn man dann dem Vordermann hinten drauf fährt, funktioniert hoffentlich der Airbag. Die Antwort der allermeisten lautet: „Na klar bin ich multitaskingfähig.“ Herzlichen Glückwunsch.
Eine von mir gerne gestellte hypothetische Frage im Coaching lautet:
„Angenommen, das hier wäre der letzte Milchkaffee Ihres Lebens. Sozusagen Endstation Espressobohne. Danach ist Schluss, kein Nachfüllen, kein ‚noch einen kleinen Cappuccino, bitte‘. Nur diese eine Tasse. Wie würden Sie ihn trinken?“
Eine mögliche Antwort, stellvertretend für viele schöne Beschreibungen, die ich gehört habe, klingt dann so:
„Also gut, angenommen, das wäre mein letzter Milchkaffee … dann würde ich ihn bestimmt anders trinken als sonst. Normalerweise trinke ich den Kaffee eher so nebenbei, während ich schon Mails checke, gedanklich im nächsten Termin hänge oder telefoniere. Vielleicht würde ich die Tasse bewusster in die Hand nehmen, das warme Porzellan spüren und den Duft wirklich einatmen – nicht nebenbei, sondern so richtig. Wahrscheinlich würde ich auch viel langsamer trinken, jeden Schluck schmecken: die Mischung aus kräftigem Kaffee und sanfter, cremiger Milch sowie den leichten Schaum auf der Zunge. Das Bouquet aus Röstung und Hafermilch würde ich viel bewusster wahrnehmen. Wahrscheinlich würde ich mir sogar denken: ‚So schmeckt also mein letzter Kaffee.‘
Und während ich da sitze, würde ich auch meine Umgebung stärker wahrnehmen: den Blick aus dem Fenster, das Licht im Raum, vielleicht die Menschen, die mit mir im Café am Tisch sitzen. Ich glaube, ich würde einfach kurz innehalten und dankbar sein, dass ich das erleben darf.
Am Ende, wenn die Tasse leer ist, würde ich sie wahrscheinlich noch einen Moment in den Händen halten und die Wärme spüren. Nicht, weil ich noch mehr will, sondern um diesen Augenblick nicht sofort loszulassen. Es wäre ein ganz bewusster Abschied – und gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass selbst so etwas Alltägliches wie ein Milchkaffee eine Bedeutung haben kann, wenn ich ihm Aufmerksamkeit schenke.“
Ich bin dann immer still und lasse das Gesagte wirken. Nach einer Weile sage ich dann: „Na ja, dann trinken Sie doch ab jetzt jeden Milchkaffee genau so.“
„Pflücke den Tag.“ Ich übersetze es für mich so: Danke sagen, dass der neue Tag da ist – und lächeln, weil mir noch einmal einer geschenkt wurde.
Cogito ergo sum
„Ich denke, also bin ich.“ Dieser berühmte Satz stammt vom französischen Philosophen René Descartes. Die meisten meiner Bekannten und Freunde würden diese philosophische Weisheit für mich wie folgt modifizieren: „Bicyclo, ergo sum.“ Das versteht sich dann ja von selbst.
Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, ob meine fast zehnmalige Erdumrundung mit meinen Drahteseln tatsächlich das Richtige war. Hatte ich meine Vorsteherdrüse am Ende überstrapaziert? Ist das Radfahren schuld daran, dass ich mich jetzt in dieser Situation befinde?
Angeblich soll Winston Churchill ja gesagt haben: „Sport ist Mord.“ Eine andere Theorie: Diese Aussage ist möglicherweise eine deutsche Erfindung von Sportmuffeln. Ich tendiere in diesem Fall zu den Muffeln. Also begab ich mich in die Untiefen des Internets, vermied ChatGPT und begann zu surfen. Interessant, was man da alles zu lesen bekommt.
Hier die Kurzfassung meiner Recherche: Nein, fürs Prostatakrebs-Risiko gibt’s keinen belastbaren Beweis. Radfahren ist nicht als Ursache belegt. Große Übersichten und Fachquellen sehen keinen sicheren Zusammenhang – Bewegung bleibt sogar eher Schutzfaktor für das Gesamtpaket Gesundheit.
Was aber stimmt: Der PSA-Wert (prostataspezifisches Antigen) kann nach dem Radeln kurzfristig hochgehen. Wer direkt nach einer langen Ausfahrt Blut abnehmen lässt, kann einen scheinbar „auffälligen“ Wert kassieren – der sich schnell wieder normalisiert. In einer PLOS-ONE-Studie stieg das Gesamt-PSA bei Männern über 50 Jahren im Schnitt um ca. 9,5 % – gemessen binnen 5 Minuten nach der Tour. Die Empfehlung, die daraus resultiert: Vor einem PSA-Test mindestens 48 Stunden kein Radeln und keine Ejakulation. Das senkt den Fehlalarm. Also: weg damit in die Schublade.
Der Druck aufs Perineum (Damm) ist der eigentliche Punkt. Wer viel fährt, sollte ihn durch einen passenden Sattel, eine Polsterhose, eine gute Sitzposition und regelmäßiges Aufstehen aus dem Sattel reduzieren. Das hilft, Beschwerden vorzubeugen; mit Krebs hat das nach heutigem Stand nichts Kausales zu tun.
Und die „Mehr Stunden = Mehr Risiko“-Theorie? Es gibt einzelne Beobachtungen mit deutlich mehr Diagnosen und Befunden bei Vielradlern (Testgruppe: 50 Jahre plus) – weil diese Gruppe sich auch häufiger checken lässt (sogenannter Detektions-Bias). Der PSA-Wert ist nach Belastung eher erhöht. Allerdings: Kein einziger Artikel rät vom Radfahren ab. Na dann …
„Veni, bicyclavi, vici.“
30. September 2025
Willkommen in der Menopause – und ich beziehe mich hier nicht auf die häufig übersehene und kaum wahrgenommene männliche Variante: die Andropause. Genau, dieses Wort hatte ich vorher auch noch nie gehört. Umgangssprachlich auch gerne Midlife-Crisis bzw. Tempus Porschius genannt. Ja, ja, immer auf die Babyboomer.
Mit einem anderen Wort: Herbsterwachen. Obwohl – im Online-Frauengesundheitsportal sprechen sie von „der natürlichen Übergangszeit in der Lebensmitte“. Also dann doch eher: Sommererwachen. Sommereinschlafen? Egal. Heute, Ende September, macht die Übersetzung aus dem Griechischen ja dann auch komplett Sinn: „meno“ für Monat und „pausis“ für Ende.
Und: so viel zum Thema „keine Nebenwirkungen“. So fühlen sich also angeblich Hitzewallungen an. In meinem Fall waren das gestern Nacht allerdings eher Brennwallungen. Ein Unter-der-Haut-Juckreiz. Ich hatte im ganzen Körper das Gefühl, unangenehm kurze, heiße Laserstrahlen zu spüren. Ein extrem unangenehmes Gefühl. An Weiterschlafen war nicht zu denken, und da ich nicht darauf vorbereitet war, lief meine Gedankendampflokomotive und offensichtlich auch meine Hormonumstellung auf Hochtouren. Da hatte ich mich wohl zu früh gefreut und bin absolut unerwartet tief gefallen. Um es einmal nicht ganz so eloquent auszudrücken wie der biblische König Salomon mit seinem Originalzitat. Zack – da lag ich nun, auf dem Sofa. 3:30 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Tofuwurm.
Um zu verstehen, was mit mir los war, las ich die Nebenwirkungen meiner Tabletten und der Hormonspritze. Hätte ich mal lieber sein lassen sollen. Ich gehe nicht in die Details, außer dass da überall zu lesen war: Schwere Nebenwirkungen: 1 von 10 Personen. Mittelschwere Nebenwirkungen: 1 von 10 Personen. Soll ich fortfahren? Zumindest war mir ein Top-10-Platz jetzt sicher. Es gibt Trophäen, die man wirklich nicht braucht.
Am frühen Morgen lag ich wieder mal im CT. Standardvorbereitungen für die Strahlentherapie, die morgen früh durchgeführt werden soll. „Nee, das dauert nur 5 Minuten …“, sagte der sehr freundliche Radiologieassistent. Nach knapp 30 Minuten spürte ich weder mein Steißbein noch meine Hände. Beide holten den nächtlich verlorenen Schlaf auf der fakirähnlichen Metalluntersuchungsliege nach. Allerdings half das kalte Metall beim Abkühlen meiner Menopausensymptomatik. Man muss alles immer ganzheitlich betrachten.
Obendrein gab es auch ein kostenloses Tattoo: symmetrisch angeordnete Punkte auf meinen Oberschenkeln und am Oberkörper. Damit gewährleistet man bei der Bestrahlung den exakten Ort der Metastasen. Also Referenzpunkte, um die Position des Patienten am Bestrahlungsgerät präzise einzustellen. Meine Einsicht nach der ersten Nacht mit Nebenwirkungen:
„Wenn Männer Kinder bekommen müssten, wäre die Menschheit schon ausgestorben.“ Und wenn alle Männer durch die Menopause gehen müssten … na, das überlasse ich gerne der Vorstellungskraft der Leserinnen und Leser.
„Ein Hoch auf die Damen: Sie schenken das Leben, ertragen die Wechseljahre – und uns gleich mit.“
30.000
Wer 1964 in Deutschland geboren wurde, hatte folgende Lebenserwartung: Frauen ca. 73,35 Jahre, Männer ca. 67,66 Jahre. Wenn die damals Geborenen die vielen Jahre überlebt haben, in denen die Mortalitätsraten wesentlich höher waren als heute, kann ein Männchen heute realistischerweise gut 80 Jahre und ein Weibchen gut 85 Jahre alt werden – immer unter Berücksichtigung von Überlebenswahrscheinlichkeiten, Lebensform, Zugang zu medizinischer Versorgung und modernen Therapien. Im Schnitt also gut 30.000 Tage.
Mit meinen knapp 61 Jahren habe ich ergo bereits 22.265 Tageskalenderblätter vom Lebenskalendarium abgerissen. Und um im Partyzeitansagemodus zu bleiben: „Beim nächsten Ton ist es: 4 Uhr – 6 Minuten – und 0 Sekunden – Biep!“ Ha, kann sich daran noch jemand erinnern? Ein Anruf bei der Zeitansage kostete damals 10 Pfennig. Und alles noch mit dem Wählscheibentelefon. Handys gab es damals nur bei Raumschiff Enterprise.
Mein Minutenzeiger hat also theoretisch noch fast zwei volle Runden vor sich. Die Divergenz zwischen Theorie und Praxis in Goethes Worten: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum.“ Oder mit den Worten von Franz Beckenbauer: „Schaun mer mal, dann sehn mer scho.“
Vor einiger Zeit hatte ich irgendwo folgenden Satz gelesen: „Älterwerden ist das Training für den Tod.“ Eine Metapher, die besagt, dass das Altern uns auf das Ende des Lebens vorbereitet und uns mit Vergänglichkeit und Sterblichkeit konfrontiert.
Ich glaube, gestern Nacht hatte ich eine erste zarte, flüchtige Begegnung mit meinem neuen Personal Trainer. Es fühlte sich auf dem Sofa liegend zumindest so an, als wolle er sich einfach mal vorstellen. Termine bzw. Trainingspläne wurden weder besprochen noch vereinbart.
01. Oktober 2025
„Unsere Kinder sollen lachen und nicht strahlen“ – so hieß der Slogan der Anti-Atomkraftbewegung in den 1980ern. Die Briten verwendeten die Tagline: „Children need smiles not missiles“. Auch nachvollziehbar. Da mir seit ein paar Wochen jedoch nicht so richtig zum Lachen war, begnügte ich mich heute früh mit dem Strahlen und begab mich in die nuklearmedizinische Radiologieabteilung. Nicht kleckern, sondern klotzen stand auf dem Programm. Den Metastasen-Wattebällchen sollte der Garaus gemacht werden. Ursprünglich eine Redewendung des Mittelalters, die das Ende des Tages und das Ende des öffentlichen Lebens markierte. Interessant, wie solch ein Ruf im Laufe der Zeit aus dem eigentlichen Kontext genommen und uminterpretiert wurde.
Interessant ist auch die Zeitwahrnehmung von Radiologen. Aus den 5 bis 10 Minuten, die für heute angesetzt waren, wurde eine Stunde. Auch der berühmte Fakir Musafa wäre heute an seine Grenzen gestoßen. Mal abwarten, wann ich mein Steißbein wieder spüre.
Bei der heutigen Bestrahlung wurde gezielt hochenergetische, ionisierende Strahlung auf meine Knochenmetastasen gerichtet. Die hauptsächlich verwendeten Photonenstrahlen schädigen vor allem die Krebszellen, weil diese sich ständig teilen und ausbreiten wollen – und nichts Gutes im Sinn haben. Gesunde Zellen in der Umgebung bekommen leider auch etwas Strahlung ab, können sich aber in der Regel wieder erholen.
Es ist schon faszinierend: Das Bestrahlungsgerät fährt über einen hinweg und trifft millimetergenau die markierten Stellen. Ziel der Behandlung: Schmerzen lindern und das Wachstum der Metastasen bremsen oder – am besten – ganz stoppen. Physik, die ziemlich zuverlässig wirkt. Da steht selbst der Robert mit staunendem Blick vor dem Linearbeschleuniger, auch CyberKnife genannt. Mann, bin ich froh und dankbar, dass heute 2025 ist.
Bei aller berechtigten Kritik am Homo sapiens: Einige Ergebnisse komplexer Wechselwirkungen verschiedener Hirnregionen unter der Regie des Großhirns sind wirklich atemberaubend. Also dann – mildernde Umstände bei der Gesamtbetrachtung der „weisen Menschen“. Es besteht Hoffnung.
So in drei bis vier Wochen sollte eine Art Heilungsprozess eingetreten sein. Das bestrahlte Gewebe bildet sich zurück und eine Narbenbildung entsteht. Zusammen mit der Chemotherapie, die nächste Woche beginnt, sollte ich in absehbarer Zeit wieder belastbarer werden. Im Moment bin ich ja ausschließlich im Handwaschgang ohne Schleudern unterwegs. Ich werde dann in ein paar Wochen die Unterlagen für den „Strongest Man“-Wettbewerb anfordern, ausfüllen und sicherheitshalber nicht abschicken.
Erstaunlich, wie zufrieden und glücklich man mit bereits wenigen Dingen sein kann. Mein hoffentlich nicht letzter Milchkaffee und ein ofenfrisches Croissant waren bereits bestellt und ich ließ derweil ein paar warme Sonnenstrahlen über mein Gesicht gleiten.
Minimūm est plūrum.
Vermutung im Vergleich zu Wissen
Für einen Verstehen-Woller wie mich ist nicht verstehen können die maximale Kastigation. Ha – ich habe mal ein Wort benutzt, das nicht gleich so leicht ins Ohr und ins Wernicke-Sprachareal im grauen Oberstubenschwamm geht. Qual hätte ich genauso gut nehmen können. Hey, Artikel 5, Absatz 1.
Ein Optimist sieht in jeder Baustelle schon die fertige Autobahn und zerschneidet gedanklich das Eröffnungsband.
Ein Pessimist sieht im selben Moment nur den Stau, Schlaglöcher und dass das Benzin sowieso gleich alle ist.
Und ein Realist? Der steckt mittendrin, schaut auf die Uhr und sagt trocken: „So ist es halt.“
Ich liebe klares Sehen und vermeide Vermutungen. Ich bezeichne mich als Realisten. Zu 98,785 % gelang mir das bis dato auch. Bis vor ziemlich genau vier Wochen. Eine Diagnose und all das damit verbundene Unwissen haben den langjährig aufgebauten Durchschnitt so richtig versaut. Gefühlt bin ich um 90 Prozentpunkte abgestürzt. Unfassbar, wie schnell das Kopfkino in den Endlosmodus schaltet und mit aller Macht versucht, Antworten und Erklärungen zu finden. Bezogen auf mein Befundverständnis saß ich sozusagen wieder in der Klasse 1A der Friedrich-Fröbel-Grundschule und versuchte meiner Klassenlehrerin zu folgen.
Ich hörte zwar „metastasiertes Prostatakarzinom“, aber verstanden habe ich „Quadraturamplitudenmodulation“. Also: gar nichts. Mein diensthabender Aufseher des Oberstübchens googelte derweil schon mal die Rufnummer des Bestattungshauses Nordend. Irgendwo aus dem Off hörte ich ihn noch sagen: „Ja, wir nehmen natürlich auch gerne das Blumenbouquet.“
Seit heute ist mein Wert wieder um einige Prozentpunkte gestiegen. Nach der Strahlentherapie hatte ich noch ein ausführliches Gespräch mit meiner Onkologin. Sie nahm sich Zeit, beantwortete meine Fragen, zeigte mir die Aufnahmen des CT vom Vortag und die Bilder des CyberKnife von heute. Ich sah zum ersten Mal die Metastasen und wo sie sich genau befanden. Sie erläuterte mir auch, dass die Kortikalis – also die äußere, stabile Schicht der Knochen – nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dass ich keine Schmerzen in diesen metastasierten Regionen hätte, sei ein gutes Zeichen. Außerdem hob sie hervor, dass mein tägliches Radfahren und Training mir jetzt zugutekomme, weil die ausgeprägte Oberschenkelmuskulatur ein starker Halt und eine Entlastung für die Knochen sei. In drei bis vier Wochen sollte eine Stabilisierung eintreten.
Das tat sooo gut. Endlich wieder ein wenig klares Sehen und Hoffnung. War ich am Ende doch ein Optimist?
Damit hatte ich die dritte Stufe der Therapie eingeläutet. In fünf Tagen dann Stufe vier: die Chemotherapie.
Es klingelte an der Tür meiner Kopf-Cloud. Ich nahm den Hörer der Gegensprechanlage in die Hand und fragte: „Ja, bitte?“ Am anderen Ende meldete sich wieder mal die Vermutung – sie hätte da ein paar Gedanken und bat um Einlass …
The Cyclone
Die berühmte Holzachterbahn The Cyclone, das Wahrzeichen von Coney Island, steht im Süden des Stadtbezirks Brooklyn in New York City, direkt an der Atlantikküste. Nach der Benutzung der Holzkonstruktion aus dem Jahr 1927 fühlt man sich anschließend ebenfalls wie fast 100 Jahre alt. Den Namen hat sie sich verdient: Der Wirbelsturm. Und dabei bezieht sich der Name des Fahrgeschäfts eigentlich nicht auf den Zustand der 33 Wirbel einer Wirbelsäule nach der Benutzung. Gleich neben dem obligatorischen Fotografen am Ausgang der Achterbahn steht übrigens auch ein Chiropraktiker.
Achterbahn war das richtige Stichwort. Kurz nach meinem gestrigen optimistischen Mini-Tsunami holten mich die Bedenken gleich wieder auf den Boden der Vermutungstatsachen zurück. War ich am Ende der Hummer aus einem meiner absoluten Lieblingscartoons? Hier mal der Versuch einer Beschreibung des Einbildwitzes.
Der Titel lautet: „Völlige Fehleinschätzung der aktuellen Lage eines Optimisten.“
Ein Hummer sitzt entspannt in einem Kochtopf, das Wasser brodelt fröhlich vor sich hin. Er schaut dabei erstaunlich zufrieden drein, fast so, als säße er nicht im Vorprogramm für die nächste Bouillabaisse, sondern in einem improvisierten Spa-Bereich mit Sprudelbad. Über ihm die Sprechblase: „Fehlen eigentlich nur noch die weiblichen Begleiter an meiner Seite …“
Am Abend bemerkte ich etwas vergrößerte Lymphknoten im Leistenbereich. Eventuell waren sie auch überhaupt nicht vergrößert – denn ich hatte mich seit Tagen keinem richtigen Selbst-Check-up unterzogen. Die letzten Tage war ich voll auf dem Lass-die-Therapie-mal-machen–Weg. Immer wieder bemerkenswert, wie einem dann solche Gedanken direkt in den Solarplexus des gerade erst erworbenen sonnigen Gemüts hauen können. Ein Schritt vorwärts. Ein Schritt zurück. Hatten die Lymphknoten etwas zu bedeuten? Verrichteten die Medikamente noch ihre Arbeit? Ich versuchte in meinen Klares-Sehen-Modus zu wechseln und schrieb direkt meinem Urologen eine E-Mail. Ich bat höflich darum, morgen kurz mit ihm zu telefonieren.
Verunsicherung hat nur eins im Sinn: dass man sich unsicher fühlt. Sie sät Zweifel und Misstrauen. Das beste Heilmittel gegen dieses unnötige Aus-der-Fassung-Bringen: ein Gespräch mit jemandem, der sich auskennt. Fakten schaffen – und falls nötig weitere Untersuchungen durchführen lassen. Dem Kopfkino den Stecker ziehen.
Krankenschwester: „Herr Doktor, der Hypochonder aus Zimmer 12 ist gerade verstorben.“
Oberarzt: „Na, na, na, jetzt übertreibt er wirklich ein wenig.“
Ode an den Post Homo erectus – 02. Oktober 2025
Der Vormittag fing schon mal vielversprechend an. Die freundliche Assistentin des Urologen hatte meine E-Mail umgehend beantwortet und mir einen Termin für morgen früh um 9 Uhr organisiert. Sich sehen sei besser als nur zu telefonieren. Ich stimmte dem zu und mein Durchblicken hatte sofort wieder etwas Oberwasser und schob die quengelnde Vermutung ein wenig aus dem Blickfeld.
Zudem rief mich mein guter Freund und Radiologe an und fragte nach meinem Befinden. Ich erzählte ihm von den radiologischen Neuigkeiten des Vortags und dass ich seit seinem Erstbefund vor genau einem Monat von den 30 vergangenen Tagen 26 gute und 4 graduell schlechtere Tage hatte. Freudig gestimmt sagte er: „Das ist doch ein richtig guter Schnitt.“ Gepaart mit meiner guten körperlichen Gesamtverfassung und dem Ausbleiben größerer Nebenwirkungen sei das alles eine sehr positive Entwicklung.
Wir unterhielten uns dann auch noch über CTs, MRTs und das CyberKnife, und ich gestand ihm, wie beeindruckt ich von dem medizinischen Fortschritt und den heutigen Behandlungsmöglichkeiten war. Bauklötze staunen – im Original aus dem Berliner Dialekt: „Glotzen machen“ – reicht da bei weitem nicht aus.
Er beschrieb mir, wie ein MRT grundsätzlich funktioniert. Ha – WIE kommt man auf so etwas, und WER hat sich derartiges ausgedacht? Gedanken können also durchaus nützlich und sinnvoll sein. Das ist alles schlicht sensationell und einfach großartig. Ganz großes IMAX-Kino.
Ich versuche mal, seine Erläuterung hier wiederzugeben:
Im MRT steckt ein Magnet, der es in sich hat: typischerweise 1,5 bis 3 Tesla stark – das ist etwa 30.000- bis 60.000-mal stärker als das Erdmagnetfeld. Dieser Magnet zwingt die Wasserstoffatome im Körper (und davon haben wir reichlich, weil wir zum größten Teil aus Wasser bestehen), sich alle in die gleiche Richtung auszurichten. Die Atome verhalten sich nämlich wie winzige Magnetnadeln – normalerweise sind diese Atome ungeordnet und zeigen in alle möglichen Richtungen. Im MRT-Magnetfeld richten sie sich jedoch gleichmäßig aus – alle parallel, wie Soldaten in einer Reihe. Dann werden kurze Radiowellenimpulse gesendet. Diese „stupsen“ die geordneten Atome an, die dadurch aus der Reihe tanzen. Sobald der Impuls endet, springen sie wieder zurück in ihre ursprüngliche Ordnung – und genau in diesem Moment senden sie messbare Signale. Diese Signale fängt das Gerät auf, der Computer berechnet daraus millimetergenaue Schnittbilder: Knochen, Organe, Muskeln, Flüssigkeiten, Tumoren – alles Schicht für Schicht.
Der Magnet im MRT ist so stark, dass er einen samt Schlüsselbund und Handy in der Hose direkt an die Röhre tackern würde – wenn man nicht vorher alles schön ablegt. Genau deshalb der ganze Sicherheitszirkus vor der Untersuchung.
Heute Abend zünde ich eine Kerze an und texte Beethovens Ode an die Freude ein wenig um. Hier schon mal die ersten Zeilen:
Homo sapiens, Götterfunke,
Ärzte aus Elysium,
Wir betreten hoffnungstrunken
Euer weißes Heiligtum.
03. Oktober 2025
35 Jahre Deutsche Einheit. Wohlsein. Ich weiß noch genau, wo ich am Tag des Mauerfalls war und was ich gerade gemacht habe, als am 9. November 1989 um 23:30 Uhr der Grenzübergang an der Bornholmer Straße überraschend geöffnet wurde. Ich saß vor dem Fernseher. So geht friedliche Revolution.
Ich weiß ebenfalls noch ganz genau, was ich am 11. September 2001 gemacht habe, als am frühen Nachmittag die ersten Bilder des World Trade Centers auf n-tv gesendet wurden. Ich saß wieder vor dem Flimmerkasten. Es war ein Dienstag.
Auch der 2. September 2025 ist für mich nun auf meiner Festplatte eingebrannt. Allerdings saß ich an diesem Dienstag mal nicht vor der Mattscheibe. Fast genau 24 Jahre nach den Terroranschlägen hatte ich vor einem Monat jedoch wieder das exakt identische Gefühl wie damals: Das war’s! Um es – etwas modifiziert – mit den berühmten Worten von Andy Möller zu sagen: „Ich hatte vom Feeling her ein Scheißgefühl.“
In dem Film Interstellar gibt es die berühmte Szene auf Miller, einem Wasserplaneten ganz nah am gigantischen Schwarzen Loch Gargantua. Weil die Gravitation Zeit dehnt (Einsteins Relativitätstheorie), vergeht die Zeit dort viel langsamer als für alle anderen weit weg vom Schwarzen Loch. Für Cooper, den Piloten, und seine Crew fühlt es sich so an, als seien sie nur ein paar Stunden auf Miller. In Wirklichkeit vergehen für ihren Kollegen Romilly, der draußen im Mutterschiff wartet, über 23 Jahre.
Ungefähr so fühlten sich für mich die letzten Tage an. Während der lediglich 768 Stunden seit dem Befund (also auf meinem Planeten Miller) habe ich emotional nochmal mein gesamtes Leben durchlebt (quasi wie Romilly im Raumschiff). Gut fünfhundertdreißigtausend Stunden. Genauer gesagt: Mir fielen im Schnelldurchgang schöne, lustige, bemerkenswerte und liebenswerte Momente ein, die ich – auch und vor allem mit anderen – erlebt hatte. Eine Erinnerung ergab die nächste. Meine Memory-Kiste wurde kräftig durchgeschüttelt und längst Verschollenes ans Tageslicht gebracht. Schön war’s. Sehr schön. Ich war am Dauergrinsen. Eine wunderbare Beschäftigung, wenn mal wieder nichts Gescheites im TV oder bei den Streamingdiensten läuft.
Mein Reminiszieren brachte ebenfalls ein Buch, das ich gelesen hatte, wieder ins Bewusstseinsrampenlicht: Chasing Daylight von Eugene O’Kelly. Der Autor, ein erfolgreicher CEO, erhielt mit 53 Jahren die Diagnose unheilbarer Hirntumor. O’Kelly beschreibt, wie er sich bewusst verabschiedete: von seinem Job, von Terminen und von seinen liebsten Menschen. Er verabschiedete sich nicht mit Trauer oder Grummeln, sondern mit Dank. Er schildert, wie er seine Kontakte – vom äußeren Bekanntenkreis bis hin zum innersten Zirkel der engsten Freunde und Familie – bewusst aufsuchte, um sich für die außergewöhnlichen gemeinsamen Momente zu bedanken. Keine langen Abschiedsreden, kein Drama. Einfach ehrliche, klare Worte: Danke, dass du Teil meines Lebens warst. So machte er das Unausweichliche zu einem Akt der Wertschätzung – und verwandelte das Ende in viele kleine, leuchtende Augenblicke.
Das ist die exakte Beschreibung dessen, was wir haben: Das Leben besteht aus Momenten, Augenblicken. Das Hier und Jetzt. Wir sammeln keine Punkte oder erhalten am Ende dafür ein Extraleben. Es gibt keinen Endgegner zu besiegen und auch kein finales Level. Möglichst viele (wunder)schöne Momente erleben zu dürfen – das ist die eigentliche Herausforderung.
In ihrem Buch 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen beschreibt Bronnie Ware, was am Ende wirklich zählt. Auf dem Sterbebett, wenn klar wird, dass sich das Leben dem Ende zuneigt. Sie begleitete Sterbende in den letzten Wochen ihres Lebens. In ihrem Buch erzählt sie von wunderbaren Begegnungen und berührenden Gesprächen – und davon, dass die Menschen, die sie traf, viel zu oft feststellen mussten, dass sie ihre eigenen Wünsche hintenangestellt hatten.
Hier ist ihre Liste:
- „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.“
- „Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.“
- „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken.“
- „Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten.“
- „Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.“
Das spricht dann für sich selbst. Frohes Fest.
Figaro
Da ich inzwischen wie ein Langhaardackel aussah, trieb es mich nach Monaten wieder mal in die Arme meines Coiffeurs. Sprichwörtlich. Dominique war spät dran und so vertrieb ich mir die Wartezeit mit einem leckeren Earl-Grey-Tee aufs Haus – und mit seinem Hund Nico. Ein Italian Greyhound. Der friert auch bei 32 Grad im Schatten. Kaum sitze ich auf dem Stuhl, liegt er auf meinem Schoß. Mit meinem Schützen im Sternzeichen und dem Drachen im chinesischen Tierkreis bin ich also so etwas wie ein Heizkissen für den extrem kurzhaarigen Wauwau. Im Winter in New York City würde er auf der Stelle schockerfrieren.
Während wir uns auf den neuesten Stand brachten, bemerkte Dominique, dass mein Haar zum Teil einen ganz leichten Gelbstich hätte – und ihm das bis dato noch nie aufgefallen sei. Er fragte mich, ob ich denn neuerdings rauchen würde. Das konnte ich mit bestem Gewissen verneinen. Also entschloss ich mich, ihm von meiner Diagnose zu erzählen, und mutmaßte, dass eventuell die begonnene Therapie bzw. die ganzen CTs, MRTs, PETs und die Strahlentherapie die Verursacher sein könnten.
Auf der nach oben offenen Betroffenheitsreaktionsskala all meiner geduldigen Zuhörer und Blogleser – von A wie Atemaussetzer bis Z wie Zerknirschung – wurde das „U“ heute durch Dominique umklassifiziert. Das ursprüngliche U wie Unbehagen ersetzte er nonchalant durch: „Und sonst? Was gibt es sonst so Neues?“
Wie geil ist das denn? Nachdem ich ihm von meiner Krebsdiagnose erzählt hatte, sagte er kurz und trocken: „Ja, mein Mann hat auch Prostatakrebs.“ Und fügte eher beiläufig hinzu: „Aber sieht ja so aus, als würdest du die Therapie gut vertragen.“ Herrlich. Ich war wieder in der Normalität angekommen.
Ja, ich habe Prostatakrebs – und sonst?
AFMH & R
Das fröhliche Wesen in mir übernahm die Regie und saß mal wieder am Lenkrad – besser gesagt: hinter dem Lenker. Diesmal jedoch nicht auf dem Stahlross im auf 14 Grad heruntergekühlten Gym mit unerträglicher Reggaeton-Dauerberieselung, sondern auf einem echten Fahrrad und ohne Stützräder. Der Übermut machte sich breit und ich fuhr die 4,8 Kilometer von meiner Höhle bis zur Abteilung für männliche Hydraulik & Rohrleitungstechnik mit meinem Stadtradl. Die neue – bzw. wiedergewonnene – Freiheit. Allerdings ausschließlich auf den dafür vorgesehenen Fahrradwegen. Schließlich stand ich noch immer unter dem Eindruck der Knochenmetastasen und der damit verbundenen Bruchgefahr. Rabiate Autofahrer konnte ich da nicht gebrauchen.
Ich gebe es ungern zu, aber die grün- und rotgestrichenen Fahrbahnen habe ich bis dato gemieden wie Politiker klare Antworten. Die Restarroganz in mir wollte gerade anfangen, deswegen mit mir herumzudiskutieren, da waren wir schon da. Das ging flotter als gedacht. Mein Hochmut hielt daraufhin die Klappe.
Um 9 Uhr war wieder einmal ein Untersuchungstermin angesetzt. So kurz vor meiner ersten Chemo wollte mein Urologe mich noch einmal genau unter die Lupe – also unter den Schallkopf – nehmen. Alles war in guter, neuer Ordnung. Der Katheter verrichtete seine Arbeit, die rechte Niere war dadurch entlastet und nicht mehr gestaut. Das Ersatzteil und ich werden allerdings keine sehr guten Freunde mehr. Umso froher war ich zu hören, dass mein Doc das Teil in ein bis zwei Monaten entfernen wollte – wenn sich alles im Bauchraum durch die Hormontherapie und die Chemo zurückgebildet hat.
Wir sprachen auch über eine mögliche Entfernung der Prostata, sozusagen der Krebsquelle. Indes passiert dies frühestens im nächsten Frühjahr, wenn ich mich wieder komplett von der Zellteilungsstopptherapie erholt habe. Er gab mir außerdem den Tipp, mir ein Kühlgel-Set für die Chemotherapie zu besorgen – Handschuhe und Schuhe –, um mögliche Schmerzen in Händen und Füßen zu lindern. Das könne eine Neuropathie und Nebenwirkungen wie Taubheit, Kribbeln, Schmerzen oder Muskelschwäche in Fingern und Zehen verhindern oder zumindest abschwächen. Die farblich abgestimmte Eiskappe für die noch echten Haare auf meinem Kopf habe ich gleich mitbestellt. Sollte ich die Chemo überleben, wird als Todesursache auf dem Totenschein wohl „Erfroren“ stehen.
Vielleicht kommen mir ja jetzt die fast elf Jahre New York City zugute. Von Dezember bis März lautete das Motto: Bo-Frost-Radeln – bei dauerhaften Minustemperaturen. Mein persönlicher Rekord: gefühlte minus 27 Grad Windkälte – auf der Brooklyn Bridge und über dem halb zugefrorenen East River.
Frobsty, the snowman.
Be-merkens-wert
Es gibt Situationen (siehe oben), die vergisst man einfach nicht. In grauer Vorzeit, als ich als junger Mann den Frankfurter Stadtteil Bornheim unsicher machte, verschlug es mich in die Postfiliale in der Saalburgallee. Warum auch immer – wahrscheinlich zeigen sich jetzt schon erste Anzeichen von präseniler Demenz –, ich musste ein Paket verschicken. Ich hatte zuhause alles vorbereitet: den Empfänger, den Absender und das Wort „Zerbrechlich“ mehrfach in Schönschreibkunst auf das Paket geschrieben und das Ganze mit 17 Metern Klebeband gesichert. Am nächsten Tag machte ich mich in der Firma etwas früher und unbemerkt aus dem Staub, um rechtzeitig im Postamt zu sein. Nichts geht über perfekte Zeitplanung.
Um 17:50 Uhr stand ich fast am Schalter. Die einzige Person vor mir wollte lediglich Briefmarken kaufen. Weiß hier noch jemand, wofür man die benötigt? Und was kostet heute eigentlich ein Standardbrief? Egal. 3 Minuten später war ich an der Reihe. Ich wuchtete das Paket auf den Tresen und fragte den freundlichen Postbeamten, was der Versand kosten würde. Er fragte nach dem Paketschein und einer Zollinhaltserklärung, falls das Paket ins Ausland ginge. 17:54 Uhr.
Ohne ging nichts. Ich musste eine ausfüllen. Er gab mir ein Warensendungsbeförderungsformular und bat mich, es vollständig auszufüllen. 17:55 Uhr. Die Kalligrafie entließ ich vorzeitig in den Feierabend und kritzelte in Windeseile die notwendigen Angaben auf das Formular. 17:59 Uhr …
Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie der nun nicht mehr ganz so freundlich dreinblickende Postbedienstete in den hinteren Teil des Paketannahmeraums ging – und das Radio lauter drehte. Gerade als ich das Paket samt ausgefülltem Dokument hochhob, tönte es aus dem Lautsprecher:
„Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist der Hessische Rundfunk – es ist 18 Uhr.“
Perfekt. Ich stand pünktlich vor dem Schalter. Genau das war das Schlüsselwort: pünktlich. Der inhäusige Brief- und Paketträger sagte nur ein Wort: „Feierabend.“ Und während er das nicht gänzlich ohne Genugtuung und mit einem Hauch von Schadenfreude sagte, zog er das Gitter herunter und verließ den Paketraum. Es gab in meinem Leben wirklich nicht viele Personen, die mich sprachlos zurückgelassen haben. Vielleicht gibt es ja noch einen Grund, warum heute kaum noch jemand Briefe schreibt.
In den letzten knapp fünf Wochen habe ich einige weitere bemerkenswerte Aussagen vernommen. Hier die wichtigsten, die mein Leben verändert haben – und liebevolle Hilfestellungen waren:
– Ich habe jetzt erstmal eine Flasche Wein getrunken, bevor ich Dich anrufen konnte …
– Vor mir sitzt ein 60-jähriger Patient, der topfit und eigentlich auch sehr gesund ist. Gleichzeitig sind Sie auch schwer krank. Vergessen Sie einmal kurz die Krebsdiagnose. Sie sind deshalb so gut in Form, weil Sie offensichtlich vieles richtig gemacht haben. Leben Sie bitte genauso weiter wie bisher. Um den Krebs kümmern wir uns.
– Sie fragte mich, wie es meiner Seele gehen würde, weil diese gerne im Agieren der Schulmedizin vergessen wird, und sie fügte hinzu, dass ich – wenn es für mich möglich wäre – mich nicht krankreden lassen solle. Vor allem, wenn ich mich nicht krank fühle.
– Sie erläuterte mir auch, dass die Kortikalis – also die äußere, stabile Schicht der Knochen – nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dass ich keine Schmerzen in diesen metastasierten Regionen hätte, sei ein gutes Zeichen.
– Und sonst? Was gibt es sonst so Neues?
– Umso froher war ich zu hören, dass mein Doc das Teil in ein bis zwei Monaten entfernen wollte – wenn sich alles im Bauchraum durch die Hormontherapie und die Chemo zurückgebildet hat.
„Worte sind die Medizin der Seele.“
– Sokrates
Rückblenden-Nostalgiepfad – 05. Oktober 2025
Da ich ohnehin gerade auf der Erinnerungsstraße hin- und herlief, machte ich einen gedanklichen Zwischenstopp im Jahr 1988. Genauer gesagt: im November. Für alle Genauwissenwoller: Samstag, der 12. Noch so ein Datum, dass sich mir eingebrannt hat.
Ich spielte bereits seit 14 Jahren Hockey, aber irgendwie konnte ich meinen besten Freund damals nie überreden, mir und meinem Team mal zuzuschauen. Gute Dinge brauchen eben Zeit. Er sagte schließlich zu – ich freute mich – und tatsächlich: Er erschien rechtzeitig zum Anpfiff. 10 Minuten später wurde ich vom Notarzt in die BG-Unfallklinik gefahren. Verdacht auf Kreuzbandriss. Ich hörte ihn noch sagen: „Ah, so geht also Hockey.“ That’s what friends are for.
Der Verdacht wurde bildgebend erhärtet und die freundlichen Mitarbeiter des Hospitals behielten mich gleich dort. Zweibettzimmer war angesagt – und ich teilte die Rekonvaleszenzkammer mit einem älteren Herrn. Die OP am nächsten Tag verlief ohne Komplikationen, und am Tag darauf durfte ich schon wieder Besuch empfangen. Am Tag des Eingriffs selbst lag ich allerdings noch recht mitgenommen und post-spinal-anästhesiert in meinem Bett – 24 Stunden später war mein Ego wieder komplett anwesend und machte einen auf Unteroffizier.
Wir riefen Freunde, Bekannte und Familie an und nutzten sie als improvisierte Lieferservicemitarbeiter – Lieferando gab es damals noch nicht. Ich wollte meine Gitarre, Lektüre und meinen CD-Ghettoblaster. Ein furchtbares Wort. Heute heißen die Dinger Boomboxen – auch nicht viel besser. Ich lehnte das Krankenhausessen rundheraus ab und organisierte mir zusätzlich eine 24/7-Versorgung. Mehr Egozentrismus ging nicht. Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei lagen damals zumindest ein bisschen falsch: Die Erde drehte sich nicht um die Sonne. Ich war in diesem Moment der Mittelpunkt. De revolutionibus orbium robertium.
Zwei, drei Tage später bemerkte ich dann meinen Zimmernachbarn. Bis dahin war er still – was anderes blieb ihm ja auch nicht übrig. Mein Zweitwohnungsequipment und die sich die Hände gebenden Robert-Besucher sorgten für durchgehende Unterhaltung und entsprechenden Lärmpegel. Wir kamen ins Gespräch, weil ich bemerkte, dass er nach einem Arztgespräch recht niedergeschlagen wirkte. Mein Ego ließ offensichtlich noch ein Stück Restempathie zu. Erstaunlich.
Mein Bettnachbar hieß wie ein sehr bekannter deutscher Dichter. Und da ich hier gerade Memory mit meinem Blog spiele, fiel mir wieder ein, dass ich ein Gedicht dieses besagten Schriftstellers einmal auswendig lernen musste:
Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da –
und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick grässlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri- od- Ameriko.
Warum hat sich mein Gehirn das gemerkt?
Zurück zu seinem Namensvetter. Er erzählte mir, dass seine Hüft-OP nicht erfolgreich verlaufen sei. Er hatte eine sogenannte zementierte Hüftprothese erhalten – und die sei nun nicht richtig zusammengewachsen. Er sei Taxifahrer und liebe Kegeln – beides dürfe er laut Aussage der Ärzte nicht mehr ausüben. Dann erzählte er mir noch, dass er als junger Mann eine Wirbelsäulenverletzung erlitten hatte und 27 Monate auf dem Rücken liegend – mit einem Schaumstoffkeil zwischen den Beinen – im Krankenhaus verbringen musste. Am Schluss sagte er noch, dass er dankbar sei, überhaupt noch laufen zu können.
Ich dachte nur noch: „Robert, halt’s Maul und krieg dich sofort wieder ein.“
Ich ließ alle Distraktionsgegenstände wieder abholen, bestellte den Essen-auf-Rädern-Service ab und wollte auch keinen Besuch mehr haben. Ich hatte für die nächsten zweieinhalb Wochen einen guten Freund und Zuhörer im Zimmer. Er liebte Charles Bukowski. Ich danach auch.
Christian Morgenstern – der zweite – war mein erster und wichtigster Wendepunkt.
In tiefer Dankbarkeit.
Für ihn und meine Zuhörer.
Einmal werde ich noch wach, heißa, dann ist Chemotag
Vielleicht sollte ich diese Kapitelüberschrift noch einmal überdenken und das „heißa“ besser durch „hurra“ ersetzen. Wie auch immer – ich bin sehr froh (klingt schon ein wenig schräg), dass die erste Chemotherapie morgen ansteht. Immerhin ist das die nächste wichtige Behandlungsstufe meiner Krankheit. Die Stufe 4.
Der Idealfall: Die Zytostatika, die bei der Behandlung eingesetzt werden, stören die Zellteilung von Krebszellen und töten diese ab. Sie greifen das Erbgut an und blockieren Stoffwechselabläufe. Die Chemotherapie erreicht so den Tumor in der Prostata und auch mögliche Metastasen. Die Tumortouristen dürfen dann langsam ebenfalls Abschied nehmen. Mit anderen Worten: mein Wunschkonzert.
Die Chemotherapie-Kühlgel-Produkte lagen bereits im Eisfach. Am Montag um 9 Uhr ist dann Mount-Everesten angesagt. Vorher werde ich noch zur Blutspende geschickt, um zu prüfen, ob die Werte passen.
Der Optimist in mir drängelte sich wieder ein wenig nach vorne, wollte ein bisschen Begeisterung verbreiten, und wurde dafür sofort vom wachhabenden Realisten ins Glied beordert. Der Pessimist versuchte es danach erst gar nicht. Klares Sehen war verordnet.
Während eines Meditationskurses in New York erzählte uns unser buddhistischer Kursleiter folgende Geschichte: Vor etlichen Jahren flog er mit zwei Kollegen zu einer 90-tägigen Meditationsveranstaltung nach Thailand. Drei Monate Schweigen, Sitzen, Meditieren, Niederwerfungen, Gehen, Essen, Trinken, Notdurften und Bettruhe – und dann alles wiederholen. Jeden Tag. Einmal pro Woche gab es einen sogenannten Dharma-Talk, also einen Beitrag über buddhistische Lehren vom Kursleiter. Fragenstellen war verpönt. Zuhören, Verstehen und Umsetzen war angesagt. Sozusagen: Just do it.
Nach 45 Tagen erwähnte der thailändische Dozent im Anschluss seines Dharma-Talks, dass ab morgen – wie jedes Jahr – wieder die einwöchige Phase ohne Schlaf beginnen würde, und wünschte allen viel Erfolg und vor allem Einsicht. Er verbeugte sich und verließ den Meditationssaal.
Unser Lehrmeister auf Reisen bekam direkt eine Panikattacke. Seine beiden amerikanischen Begleiter standen ihm in nichts nach. Die drei konnten sich nicht mehr beruhigen und stellten sich die folgenden sieben Tage schon mal bildhaft im Hier und Jetzt vor. Sie fühlten bereits Halluzinationen, Schwindel, Zuckungen, Kreislaufprobleme, Magen-Darm-Probleme und den Zusammenbruch des Nervensystems. Mit anderen Worten: körperlicher Ausnahmezustand mit akuter Lebensgefahr. Die Schlaflos-Woche hatte noch nicht einmal begonnen und alle drei saßen mit der komplett imaginierten Symptomatik im Lotussitz und hatten Schnappatmung.
Der thailändische Tutor bekam das mit und bat die drei zu sich und erklärte ihnen, dass dies natürlich kein Kinderspiel sei. Allerdings sei das eine jahrhundertealte Tradition und bis dato habe es noch nie Kollateralschäden gegeben.
Das Geheimnis sei ganz einfach:
Wenn du sitzt, sitz.
Wenn du gehst, geh.
Wenn du meditierst, meditiere.
Wenn du auf die Toilette gehst, geh auf die Toilette.
Alles hat seine Zeit. Atme eine Sache ein – und danach atmest du sie wieder aus. Dann widmest du dich der nächsten Sache. Sie sollten sich nicht schon in der Gegenwart das mögliche Leiden der Zukunft vorstellen. Sie sollten einfach im gegenwärtigen Moment bleiben.
Und wie die Amerikaner nun mal so sind – go big or go home – hängten sie noch einen achten Tag dran. So sind die Amis, man muss sie einfach mögen.
Ich ließ die Chemo Chemo sein und betrachtete die Uhr. Es war 22:23 Uhr. Die Chemo hatte noch nichts zu melden.
Der Kölner sagt dazu: Wat kütt, dat kütt. Am Montag gegen 11 Uhr weiß ich dann mehr.
Einmal ambulantes Chemobuffet, bitte …
Die ganze Zeit hatte ich versucht, ChatGPT zu umgehen und nicht in den Neugierigkeitsmodus umzuschalten. Aber ich bin einfach zu schwach und mein Widerstandslevel liegt offensichtlich auf Grasnarbenniveau. Also fütterte ich meinen persönlichen Online-Assistenten mit verschiedenen Fragen – und bekam auch prompt Antworten. ChatGPT war äußerst sachlich, nicht wertend, nicht interpretierend. Angenehm. Und offensichtlich hatte meine rechte Hand bereits ebenfalls in den Klar-Sehen-Modus gewechselt.
Hier die Zusammenfassung dessen, was mich morgen und in den darauffolgenden Tagen erwartet:
Meine Chemotherapie wird mit Docetaxel durchgeführt. Die 75 Milligramm pro Quadratmeter Körperoberfläche werden in 250 bis 500 Milliliter Kochsalzlösung oder Glukose verdünnt, die dann über den Tropf langsam in mich hineintröpfelt. Wie lautete gleich nochmal die Formel zur Berechnung? KÖFᴿ = 0,007184 × (Körpergröße in cm ÷ 0,725) × (Ego + Gewicht in kg ÷ 0,425). Egal – 75 Milligramm klingt nach wenig, wird aber sicher Eindruck machen. Die Infusion dauert eine gute Stunde. Also: abwarten und vertrauen. Die Chemo übernimmt das Kommando und greift die bösen Zellen an. Meine guten werden hoffentlich in Deckung gehen, um ungeschoren davonzukommen.
Ich werde also daliegen, der klaren Flüssigkeit zusehen, wie sie langsam in mich hineintropft – und versuchen, mich auf das zu konzentrieren, was hoffentlich nicht passiert. Kein Brennen, kein Schwindel, kein Drama. Nur dieses leise Gefühl, dass etwas in Bewegung kommt.
Was danach passiert? An Tag zwei bis fünf wird eventuell das große Überraschungspaket geliefert: Müdigkeit, Kribbeln, Geschmacksverlust – oder auch einfach gar nichts. Jeder Körper reagiert anders. Meiner hat sich bisher eher kooperativ gezeigt, also bleibe ich optimistisch. Leichte Aktivitäten sind erlaubt – ein Spaziergang, etwas Bewegung wie Fahrradfahren, solange der Kreislauf mitspielt. Sauna sollte ich in den ersten Tagen lieber sein lassen. Das Immunsystem hat dann genug zu tun. Ich nehme mir vor, das Ganze sportlich zu sehen – im wörtlichen Sinn.
Der Realist in mir wird die Tropfen zählen, der Optimist lehnt sich mit einem Gewinnerlächeln zurück – und der Pessimist? Der darf ausschlafen. Den braucht niemand.
D-Day – 06. Oktober 2025
Oft – und fälschlicherweise – auch als „Decision Day“ übersetzt. Die eigentliche Bezeichnung für die Militäraktion der Alliierten am 6. Juni 1944 lautet Operation Overlord. Ich nehme mir mal die schriftstellerische Freiheit und taufe diesen Begriff ab heute – und für mich – in Operation Cancerover um und blase, etwas unbeholfen und bemüht, das Angriffssignal in die Trompete.
Obwohl ich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten geboren wurde, bin ich trotzdem Pazifist geworden. Also einer dieser US-amerikanischen Lachse, die gerne – und eigentlich fast immer – gegen den Strom schwimmen. Hinzu kommt, dass ich vor 42 Jahren mal so richtig Schwein hatte und nicht zum Grundwehrdienst der Bundeswehr eingezogen wurde. Dieser 15-Monats-Kelch ist glücklicherweise an mir vorbeigegangen. Da die United States Armed Forces seit 1973 ohne Wehrpflicht sind, blieb es mir erspart, mit 40 Kilogramm Gepäck durchs Unterholz zu robben oder die friedlichen Zeilen der US-Nationalhymne, des Star-Spangled Banner, mitzusingen. Hier mal ein Auszug:
Und der rote Schein der Raketen,
die Bomben, die in der Luft explodierten,
bewiesen durch die Nacht hindurch,
dass unsere Flagge noch immer dort wehte.
Schätzungen zufolge befinden sich in den USA über 400 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz. Walk the talk. Da macht die Hymne wieder total Sinn. Ein Hoch auf den zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung.
Allerdings musste ich meinem motivierten Militaristen in mir doch ein klein wenig Bühnenpräsenz verschaffen. So ganz unmartialisch können wir den Krebs nicht besiegen. Als wir uns kurz darüber unterhalten wollten, stand er schon mit Tomahawk-Raketen unterm Arm in der Tür. So mag ich das – in die Vollen gehen. Den Drei-Tage-Bart-Rasierer habe ich auch schon bestellt, für den Fall, dass ich mir à la Demi Moore meine Mähne abrasieren muss. Die Onkologin erklärte mir heute vor der Untersuchung, dass sechs von zehn Chemopatienten anschließend mehr Körperfläche zum Bräunen haben.
Meine 51-prozentige Beteiligung an Müllermilch konnte ich heute ohne großes Aufsehen und Komplikationen in Shop-Apotheke-Anteile umtauschen. Ich freue mich schon, Günther Jauch persönlich kennenzulernen. Hier mal die Einkaufsliste der Medikamente, die ich die nächsten Wochen einnehmen darf:
Pantoprazol 20 mg – morgens nüchtern, 1 Tablette.
Levogastrol 25 mg – 30 Minuten vor Frühstück, Mittag- und Abendessen, 1 Tablette. Maximal alle 8 Stunden – nur wenn Übelkeit auftritt.
Ondansetron 4 mg – SP: 1 Tablette, nur wenn die Übelkeit nach Levogastrol nicht verschwindet.
Fortecortin 4 mg – SP: 1 Tablette, nur wenn auch nach Ondansetron noch Übelkeit besteht.
Fortasec 2 mg – SP: 2 Tabletten nach dem zweiten Durchfall des Tages. Maximal 6 Tabletten täglich.
Paracetamol 1 g – alle 8 Stunden, nur bei allgemeinem Unwohlsein und leichtem Fieber.
Enantyum 25 mg – alle 8 Stunden, wenn Paracetamol nicht hilft.
Dacortin 5 mg – 1 Tablette morgens nach dem Frühstück.
Ich habe dann wahrscheinlich kaum noch Zeit, zwischen der täglichen Medikation feste Nahrung zu mir zu nehmen.
Alle in der Klinik heute waren zuckersüß und maximal hilfreich. Mir wurde alles genau erklärt und ich durfte alle Fragen stellen und Bedenken äußern – sofern ich welche gehabt hätte. Nach der Blutabnahme (PSA 3,15 ng/ml!!!) wurde ich bettlägerig gemacht, bekam die Docetaxel-Tropfinfusion an den Venenzugang angelegt und zog meine auf minus 22 Grad heruntergekühlten Handschuhe und Füßlinge an. Die gefrorene Kältemütze rundete das Erscheinungsbild stilistisch ab. Ob meine Finger- und Fußnägel jetzt wegen der Chemo oder wegen Erfrierungen schwarz sind, konnte die diensthabende Ärztin nicht mit Sicherheit sagen.
Die Zeit verging im Flug. Ich lauschte Friedrich Merz, zu Gast bei Caren Miosga – beste Unterhaltung. Wie Pudding an die Wand nageln. Irre.
60 Minuten Chemo waren angesetzt und nach einer Stunde ertönte der Gong. Ich wurde abgekabelt und durfte nach insgesamt viereinhalb Stunden wieder gehen. Die nächste Sitzung habe ich in genau drei Wochen. Bis dahin darf der Wirkstoff bitte ganze Arbeit leisten. Bei den Nebenwirkungen darf er sich bitte komplett zurückhalten. Bis dato hat er das getan. Brav.
Die Intelligenz des Menschen ist grenzenlos
Bei Einstein klang das allerdings etwas anders: „Zwei Dinge sind unendlich – das Universum und die menschliche Dummheit; aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Ich wollte da mit ihm nicht im Unisono-Chor mitsingen und war – wieder einmal – komplett überwältigt von den schier grenzenlosen Kapazitäten des menschlichen Gehirns, Dinge zu erfinden.
Wer kennt noch die Story der Apollo 13?
Aus Plastiktüten, Pappe, Schläuchen, Klebeband, Socken und einem Raumanzug-Schlauch bastelten die Jungs – nach exakter Anleitung der Bodencrew – eine improvisierte Adapterlösung, um die quadratischen CO₂-Filter in das runde System einzubauen. Das Ergebnis: Der CO₂-Gehalt sank. Die Crew überlebte. Sie schufen aus dem Nichts etwas, das in die Geschichte der Ingenieurskunst eingegangen ist – eine Sauerstofffilter-Adapterkonstruktion aus Bordmitteln. Jim Lovell sagte später sinngemäß: „Wir haben mit Klebeband das Universum besiegt.“
Nachdem mir meine Onkologin heute den Wirkmechanismus der Docetaxel-Chemotherapie erklärt hatte – Motto: Onkologie für Dummies – dachte ich spontan: „Wir besiegen den Krebs auch mit Bordmitteln.“ Zum Glück mussten wir diesmal nicht kreativ werden und improvisieren – das haben andere schon vorher übernommen. Da ziehe ich den Hut. In diesem Fall sogar den Montecristi Panama-Hut.
Ich versuche mich mal in einer Dummy-Analogie. Ich erinnere mich noch an meine letzte Narkose – ist noch gar nicht so lange her. Der Darmdoktor verabreichte mir Propofol, das Wohlfühl-Wundermittel. „Bitte zählen Sie jetzt rückwärts von zehn“, sagte er. Ich schaffte es selbstbewusst bis sieben – danach war das Licht aus. Das Zeug braucht gerade mal ein paar Sekunden vom Venenanschluss ins Herz, dann zack – Aufzug ins Gehirn. Guten Abend, gute Nacht.
Und jetzt Docetaxel für Dummies: gleicher Weg, völlig anderes Tempo. Wenn Propofol ein 100-Meter-Sprinter ist, dann ist Docetaxel der strategische Marathonläufer. Das Chemotherapeutikum tröpfelte eine Stunde lang in mich hinein. 258 Milliliter machten sich auf den Weg – rein in die Vene, weiter zum Herzen, dann im Blutkreislauf auf Ganzkörper-Tournee. Docetaxel lässt sich dabei Zeit. Es sucht gezielt die Zellen, die sich dauernd teilen wollen – und genau da legt es los: Es blockiert die winzigen Strukturen, die eine Zelle braucht, um sich zu teilen. Ohne die bricht der Zellteilungsplan in sich zusammen – und das war’s dann mit dem Wachstum.
Währenddessen läuft mein Körper auf Hochtouren: Die Leber baut ab, die Nieren filtern und irgendwo im Inneren schaut mein Immunsystem erstmal neugierig zu, bevor es beim Aufräumen hilft. Die ersten Stunden nach der Infusion passiert noch nicht viel – der Wirkstoff verteilt sich, macht es sich häuslich. Nach einem Tag beginnt der Großreinemach-Modus: Zellen, die sich teilen wollen, werden blockiert, das Immunsystem fegt den Rest zusammen. Nach zwei bis vier Tagen ist der größte Teil der Substanz abgebaut – aber ihre Wirkung hält an, wie ein nachklingendes Echo im Körper. Bis zur nächsten Chemo in drei Wochen.
Das Thema Nebenwirkungen erklärte mir mein Urologe klar und einsichtig. Er fragte mich: „Soll ich Ihnen jetzt wirklich alle möglichen, zigtausenden Nebenwirkungen erklären?“ – und ergänzte: „Sie wissen ja, wie Sie sich normalerweise fühlen. Alles, was sich anders anfühlt, ist dann eine Nebenwirkung.“
Hat noch jemand eine Frage?
SINAMION – NOMASINI – INSONAMI – NOMIANIS – ASMINION – AIIONNOS
Alle Schäfchen waren durchgezählt und standen ordentlich in Reih und Glied. Die meckernden Ziegen mussten in die zweite Reihe. Ich konnte nicht ausmachen, ob das Vor- oder das Unterbewusstsein die Regie führte. Irgendwie lag ich gedankenlos da. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich war nicht wirklich müde. Um 4:36 fiel mir zudem auf, dass ich bis dato nicht einmal gegähnt hatte. Fun Fact: Beim Gähnen wird das Blut, das zum Gehirn fließt, abgekühlt – was das Gehirn selbst kühlt und seine Leistungsfähigkeit steigert. Die Häufigkeit des Gähnens nimmt abends zu, da die Gehirntemperatur dann am höchsten ist. Mal abgesehen davon, dass mein Gehirn auch ohne Gähnen im Hochleistungsmodus war – verstanden habe ich die Erklärung nicht. Danke, Google-KI. Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie.
Es gibt Nächte, die sind keine Nächte. Sie sind Bühnenstücke mit wechselnder Besetzung: Der Körper spielt Erschöpfung, der Kopf führt Regie. Während draußen die Welt leise wurde, schob mein Gehirn Sonderschichten. Da benötigt man überhaupt keine Sorgen oder Ängste – alleine über die Schlaflosigkeit nachzudenken reicht da völlig. Geil, jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, muss ich am laufenden Band gähnen. Rudi Carrell lässt grüßen. Ich zähle mittlerweile keine Schafe mehr, sondern Satzzeichen. Irgendwann beginne ich, aus meinem Erschöpfungszustand Buchstabensalat zu machen: Sinamiom, Nomasini, Insomani … neue Wörter für Wachphasen. Insomnia ist dann nur noch der medizinische Fachausdruck für Schlaflosigkeit, und meine kreativen Neuwortschöpfungen stehen für die verschiedenen Nicht-Schlafphasen. Ich war gerade in der Asminion-Phase. Vielleicht ist Insomnia auch gar keine Schlafstörung, sondern nur ein kreativer Overflow. Der Beweis: Ich bin hellwach, völlig übermüdet – und sitze am Computer und schreibe. Mein Denken hat also Nachtschicht.
Wer du denkst zu sein, ist, wer du denkst zu sein. Es ist ein Konstrukt; eine bildhafte Vorstellung. Sie kommt und geht, denn ein Gedanke ist einfach nur ein Gedanke – mehr nicht. Und der will trotzdem unentwegt Regie führen. Nervig.
Als ich gestern früh im Wartesaal der Onkologie saß, war ich der Erste. Deutsche Pünktlichkeit. Die medizinisch-wissenschaftliche Abteilung, die sich mit der Diagnose, Behandlung und Prävention von Tumorerkrankungen beschäftigt, war noch komplett dunkel. Nach und nach trudelten weitere Patienten ein und nahmen im weiträumigen Wartebereich Platz. Zu meinem Erstaunen sahen die alle völlig normal aus. Ein Querbeet durch die Gesellschaft – Jung und Alt. Auf dem Weg in die Klinik machte ich mir noch Gedanken – so viel zum Thema –, wie das wohl alles sein wird, was auf mich zukommt, und hatte offensichtlich eine völlig falsche Erwartungshaltung. Ich will es mal so sagen: Ich hatte erwartet, dass Chemotherapie sichtbare Spuren hinterlässt – und war in Schockstarrenerwartung. So viel zum Thema: in der Gegenwart sinnlos leiden. Ich war sehr erleichtert über den Anblick.
Die Wissenschaft müsste ein Mittel erfinden, mit dem man Gedanken zeitweise ausschalten kann. Einfach nur: nichts. Ich wäre Beta-Tester. Speziell, wenn man in die traumlosen Phasen des verdienten Schlafs erst gar nicht hineinschläft.
Ich war jetzt in der Aiinnos-Phase. Es ist 5:38, guten Morgen!
Curiosity killed the cat
Sechs Chemos stehen insgesamt auf dem Plan. Alle drei Wochen also ein neues Date mit meinem Tropfen – meine persönliche Netflix-Miniserie: „Docetaxel – Liebe auf Zeit“.
Ich bekam heute die Zusammenfassung der gestrigen Untersuchung samt Blutanalyse – und spürte förmlich, wie mein Serotonin- und Dopaminspiegel sprunghaft anstieg. Da stand:
Gesamtbewertung
Der Patient zeigt eine sehr gute Allgemeinverfassung mit stabilen Organfunktionen und positiver Reaktion auf die bisherige dreiwöchige Hormontherapie. Die Blutwerte sind insgesamt belastbar und für die geplante Chemotherapie geeignet. Leichte Anämie und eine geringe Lymphopenie sind typische, harmlose Begleiterscheinungen der laufenden Therapie. Die erhöhte alkalische Phosphatase spiegelt den Knochenstoffwechsel wider – voraussichtlich durch Heilungsvorgänge nach der Bestrahlung. PSA 3,15 ng/ml (aktuell). Deutlich fallende Tendenz – Zeichen eines sehr guten Therapieansprechens auf Nubeqa + Trenantone. Fazit: Optimale Ausgangslage für den Start der Docetaxel-Chemotherapie. Der Körper ist stabil, die Hormontherapie wirkt, Leber und Nieren sind voll funktionsfähig.
Das war doch mal Champagner für meine Augen. Durch diese unerwartete Extraportion Selbstbewusstsein wagte ich mich wieder ins Internet und befragte neugierig meinen persönlichen Berater bezüglich des zukünftigen Verlaufs der Chemotherapie. Die Frage ist durchaus berechtigt: Fängt das jedes Mal wieder bei null an? Also sechsmal das Gleiche – oder merkt sich der Körper die vorhergehenden Sessions?
Kurz gesagt: beides. Hier meine Zusammenfassung der Anfrage-Ergebnisse:
Jede Infusion ist in sich abgeschlossen – wie eine Episode. Docetaxel wirkt nach jeder Sitzung wieder neu, zirkuliert, verteilt sich, greift Zellen an, wird abgebaut. Aber der Körper? Der führt Tagebuch. Die Wirkung baut aufeinander auf, weil sich mit jeder Runde noch ein paar mehr Krebszellen verabschieden – hoffentlich für immer. Gleichzeitig aber sammeln sich auch die Erinnerungen an die Therapie im Körper an. Sozusagen im Nebenwirkungsarchiv.
Das bedeutet: Die erste Sitzung ist meist noch der sanfte Einstieg. Der Körper denkt sich: „Ach, das war’s schon?“ Bei der dritten oder vierten weiß er dann, was kommt – und reagiert manchmal schneller oder sensibler. Müdigkeit, Geschmacksverirrungen, Kribbeln, trockene Haut – das kann sich mit jeder Runde etwas verstärken oder länger anhalten. Manchmal aber auch gar nicht. Man weiß es einfach nicht – Chemo ist kein dauerhafter Lebenspartner, sondern eher ein unberechenbarer Mitbewohner auf Zeit.
Die drei Wochen Pause dazwischen sind clever kalkuliert. Die geben dem Körper Zeit, sich zu erholen, die guten Zellen nachwachsen zu lassen und die Blutwerte wieder in den Normalbereich zu bringen. Was bleibt, ist der Rhythmus: drei Wochen Alltag, ein Tag Labor und Infusion. Wie eine gut gemachte Serie mit sechs Kapiteln – jedes für sich lesbar, aber nur zusammen ergeben sie am Ende einen Sinn.
16,66 % habe ich bereits hinter mir. Die Nebenwirkungen hatten die Einladung für die erste Behandlung zum Glück nicht gelesen. Ich habe sie sicherheitshalber in Sütterlinschrift verfasst – mal sehen, wer das heute überhaupt noch entziffern kann. Falls die Begleiterscheinungen das dann doch lesen können, werde ich für die dritte Session mal die Keilschrift der Sumerer verwenden.
Es müsste mit dem Beelzebub zugehen, wenn die dann trotzdem auftauchen sollten.
Zoll. Pi. Dem.
Schlaflosigkeit, Runde zwei, war angesagt. Frohen Mutes begab ich mich in die Heia und gähnte schon mal prophylaktisch. Placebogähnen sozusagen. Ich lag im Bett, als hätte ich ein Locked-in-Syndrom – regungslos auf dem Rücken. Erstaunlicherweise war mein Frontallappen komplett leer. Mein Bewusstsein hatte also schon alle Viere von sich gestreckt. Ich ließ meine Extremitäten entspannen und wartete aufs Einschlafen.
Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr, 36 Minuten und 20 Sekunden. Biep. Da ich der inneren Zeitansage jetzt schon fast 40 Minuten lauschte, zog ich den Stecker. Mein Schlafunterstützungsmedikament lag bereit: Zolpidem 10 mg. Ab damit in den Schlund. Schlummerland kann kommen.
Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr 57 Minuten und 10 Sekunden. Biep. Mittlerweile war auch mein Bewusstsein wieder ausgeruht und schlug mir vor, mal wieder mit Worten zu spielen: „Lass uns doch das Wort Zolpidem etwas auseinandernehmen und mit den Silben spielen.“ Zack – ich war wieder hellwach. Ich warf das Einschlafhandtuch und spielte mit meinem Stirnhirn „Wer wird Millionär“. Die zu erratenden Worte: Zol. Pi. Dem.
Meine Orthografie wollte auch mitspielen und regte an, dem Zol doch noch ein zweites l zu gönnen. Der Lappen und ich stimmten zu. Also: Zoll. Pi. Dem. Den Zoll hatte ich relativ schnell erklärt – also die 500-Euro-Frage. Da stehen wir mit erhöhter Herzfrequenz und leichter Transpiration, wenn wir die im Urlaub erworbenen unnützen Sachen eigentlich angeben müssten, aber trotzdem durch den „grünen Ausgang“ (anmeldefrei) laufen. „Schatz, schau doch nicht so angestrengt – wir fallen sonst auf. Lächle doch mal ein bisschen!“
Bei Pi, der 1.000-Euro-Frage, war ich mir nicht sicher, ob ich einen Joker ziehen sollte. Wie schon bei Morgenstern und seinem Lattenzaun konnte ich mich direkt an 3,1415927 erinnern. Irre, was sich mein Gehirn alles merken kann. Jauch nickte, wollte aber wissen, wofür die Kreiszahl steht. Lappi und ich berieten kurz. „Irgendwas mit Umfang des Kreises und Durchmesser?“ „Richtig“, sagte Günther. Uff.
Jetzt war Dem an der Reihe. Ich gab „Rettet dem Dativ!“ zum Besten. Jauch wollte ein Beispiel, ich: „Wem sein Ball ist denn das?“ – „Dem seiner.“ „Korrekt!“, jauchzte er. Wir waren auf der Siegerstraße.
Die restlichen Fragen bis zur Million erspare ich meinen Lesern. Irgendwann sind Fronti und ich dann wohl doch eingeschlafen. Heute Nacht werde ich mir das Zolpidem eher genehmigen. Die WWM-Session von gestern brauche ich kein zweites Mal.
Ich schätze, die ganze Medikation, die ich nehmen muss, hat einen nicht kleinen Anteil an meinem körperlichen Zustand. Ich habe tatsächlich keinerlei größere Gedanken, Grübeleien oder Ängste. Ich bin de facto gedanklich entspannt. Ich liege nur – wie eingeschaltet – im Bett. Auch tagsüber hatte ich keinen Bedarf, ein Nickerchen zu machen. Ich glaube, mir fehlen meine ausgedehnten Radtouren in der Natur. Die körperliche Belastung. Ich werde heute im Gym auf dem Spinningrad mal wieder ein paar Gänge hochdrehen.
Allerdings muss ich ab heute für den Rest der Chemotherapie Prednison 5 mg zu mir nehmen. Zweimal täglich. Das Medikament wirkt entzündungshemmend, bremst überaktive Immunreaktionen und soll meinem Körper helfen, während der Chemotherapie im Gleichgewicht zu bleiben – und sorgt nebenbei dafür, dass ich mich halbwegs menschlich fühle.
Also dann – das erste Mal in meinem Leben mich menschlich fühlen. Vielleicht lässt mich ja genau dieses Gefühl endlich einschlafen?
In eigener Sache – 08. Oktober 2025
Heute hatte ich zum ersten Mal seit 37 Tagen das Gefühl, wieder der „alte“ Robert zu sein. Ich fuhr mit meinem Stadtradl ins Gym, lauschte einem meiner neu produzierten Songs (Don’t Stop Me Now) und spürte die warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Ein Gefühl zum Bäumeausreißen. Eine unfassbar schöne Empfindung. Ich spürte pure Dankbarkeit.
Long live this moment. I love it.
In diesem Zusammenhang fiel mir ein anderer Song ein, der mir außergewöhnlich gut gefällt – ein Titel von Tim McGraw aus dem Jahr 2004. Hier einige Auszüge aus dem Songtext, frei ins Deutsche übersetzt:
Live Like You Were Dying
(Lebe so, als würdest du sterben)
„Ich war Anfang vierzig, das Leben noch vor mir,
als dieser eine Moment kam, der alles anhielt.
Die nächsten Tage verbrachte ich vor Röntgenbildern,
sprach mit Ärzten über Optionen –
und mit Freunden über die schönen Zeiten.“
Ich fragte ihn, wann ihm klar wurde, dass das hier vielleicht wirklich das Ende ist. „Wie trifft dich so eine Nachricht? Was machst du dann?“
Er antwortete:
„Ich sprang mit dem Fallschirm,
ich kletterte in den Rocky Mountains,
ich ritt 2,7 Sekunden lang auf einem Bullen namens Fu Man Chu.
Ich liebte tiefer, sprach freundlicher
und vergab Menschen,
denen ich lange nicht vergeben hatte.
Eines Tages, hoffe ich, bekommst du die Chance,
zu leben, als würdest du sterben –
so, als wäre morgen ein Geschenk
und du hättest die Ewigkeit,
um darüber nachzudenken,
was du mit diesem Tag anfängst.“
Wie sagen die Amerikaner so schön? Amen.
Betthupferl
„Sich fürsorglich aufgehoben fühlen.“ Die Wikipedia- und Dudenbeschreibung darf gerne durch folgende ersetzt werden:
Eben gerade – 20:13 Uhr! – habe ich eine Nachricht von meiner Radiologie-Onkologin erhalten. Wie aufmerksam ist das denn bitte? Sie fragte mich, wie ich mich fühle. Ich berichtete ihr von meinem emotional großartigen Tag – und meiner Insomnia. Ha! Da muss man erst einmal draufkommen: Anfänger- und Anwendungsfehler. Ich dürfte die Fortecortin- und Prednison-Tabletten nicht zu spät nehmen. Da ich die Chemotherapie am Montag um 10 Uhr begonnen hatte und mich brav an die Ansagen des Personals hielt (zweimal täglich, alle zwölf Stunden), habe ich beide Schlafentzieher jeweils pünktlich vor dem Matratzenhorchdienst eingeworfen. Die erste nach der Chemo, die zweite – logisch – zwölf Stunden später. Fatal, denn diese Medikation führt gerne mal zu Schlafdisturbationen.
Also: nix mehr mit nächtlichem Scrabble. Ich bin noch schnell in die Apotheke gelaufen und habe mir eine Klinikpackung Schnuller mit Lavendelgeschmack gekauft.
La Le Lu.
Auf jedes Hoch folgt ein Tief
Das Gesetz der Polarität schlug mal wieder gnadenlos zu – also die nicht ganz so angenehme Seite von Yin und Yang. Nach der lieben Nachfrage meiner Onkologin genehmigte ich mir die schlaflosigkeitsverursachende Medikation diesmal deutlich früher und freute mich schon darauf, mich in Morpheus’ Armen wiegen zu können. Roberto im Bubu-Modus. Und kaum war ich in der bildhaften Vorstellung, musste ich schon tief und lange gähnen. Herrlich. So geht Vorfreude.
Drei Stunden später spielten Fronti und ich dann ein paar Runden Words with Friends. Das war eher langweilig und kein schöner Zeitvertreib – eher lustloses Herumraten. Auch der Wechsel aufs Sofa machte es nicht kurzweiliger. Meine Beine waren hellwach und hatten Redebedürfnis. Die etwas härtere Gangart im Gym nach über fünf Wochen hatte ihnen offenbar nicht geschmeckt und sie zahlten es mir mit diversen Krämpfen heim. Der Magen wollte dann auch noch ein wenig im Konzert der Missempfindungen mitspielen.
Hatte ich die Nykturie schon erwähnt? Gestern Nacht stellte ich meinen persönlichen Rekord mit sieben Mal Wasserlassen in lediglich sechs Stunden ein. Man soll den Tag eben nicht vor dem Abend loben. Wahrscheinlich hat das eine allerdings überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Ich war ja – besser gesagt: bin ja – alles andere als gesund. Das Docetaxel ist nach knapp 72 Stunden bestimmt immer noch am Werkeln, und die 14 Tabletten, die ich täglich zu mir nehme, sind bestimmt auch (noch) kein eingespieltes Team. It’s easy to love, but not easy to live together. Wir sind eben alle noch in der Kennenlernphase.
Nächsten Mittwoch bekomme ich zur Chemohalbzeit wieder Blut abgenommen, um zu sehen, wie mein Körper die erste Zellgiftsitzung verkraftet hat. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Bis Mitte Januar – die letzte Chemo – ist es noch ein ganzes Stück, das ich zurücklegen muss. Ich nehme die Dinge, wie sie sind.
Den schönen Moment, den ich gestern Nachmittag hatte, kann mir keiner nehmen. Den habe ich genauso empfunden, wie ich ihn beschrieben habe. Was das Heute bringt, werde ich später am Abend wissen. Bis dahin versuche ich so viele schöne Momente wie möglich zu sammeln. Als Nächstes auf der Schöne-Momente-Sammeln-Speisekarte: ein ofenfrisches Croissant und eine Hafermilchlatte.
Quod erat demonstrandum.
Matthäus 5,3 – 09. Oktober 2025
„Selig sind die geistig Armen.“ Der Ausdruck stammt aus der Bergpredigt und beschreibt eine Haltung der Bescheidenheit und des Verzichts auf das eigene Ego. Kein Aufruf zu Dummheit oder Armut, sondern eher eine Einladung zum Innehalten. Vielleicht sollte ich mein Ego auch mal an den See Genezareth schicken und es dort ein wenig ausspannen lassen. Ein bisschen Sonne, etwas Demut – und vor allem kein WLAN.
Alternativ könnte ich auch den ganzen Tag Steine kloppen. Ich käme a) bestimmt nicht auf schwachsinnige (ich liebe dieses Wort) Gedanken und wäre b) abends garantiert hundemüde. Die Vierbeiner machen’s vor: Sie dösen oder schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Da bleibt nicht viel Zeit für Nonsens – vor allem nicht für Internetnonsens.
Prednison ließ mir keine Ruhe. Ich stöberte im World Wide Web nach Nebenwirkungen. Ganz großer Fehler. Danach benutzte ich die Suchleiste einer bekannten Suchmaschine, um herauszufinden, warum man solch ein Medikament mit derartigen Begleiterscheinungen überhaupt einem Patienten geben sollte. Noch größerer Fehler. Ich stieß auf eine Studie zu „Docetaxel plus Prednison“. Das Fenster hätte ich sofort wieder schließen sollen. Ich las Dinge wie „Hazard Ratio für Tod“ und „mediane Überlebenszeit“. So geht Reizmagen ohne Notwendigkeit.
Ich erinnerte mich an eine junge Frau aus einem Coaching. Ich fragte sie, was sie tun würde, wenn sie ein Selfie posten würde, das sie richtig gut gelungen fände – natürlich, echt, schön –, und ihre Freunde würden es besorgt oder kritisch kommentieren. Ihre Antwort kam ohne Zögern: „Ich würde das Bild sofort löschen.“
So fühlte sich mein Körper beim Lesen der Studie an. Wie ein stimmiges Selfie, das man besser wieder löscht. Meine Egoneugier hatte mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ich bleibe jetzt lieber bei Folgendem:
Wissen ist Macht.
Ich weiß nichts.
Macht nichts.
Das war das letzte Mal, dass ich etwas über Medikamente oder Nebenwirkungen herausfinden wollte.
Es ist, wie es ist.
La vita è bella
Alte Fotos durchsehen.
Andere Menschen beobachten.
Atmen.
Barfuß durchs nasse Gras laufen.
Das Gefühl von warmem Sand unter den Füßen.
Das Geräusch meiner Espressomaschine am Morgen.
Das Rascheln von Blättern im Wind hören.
Den Sonnenuntergang betrachten.
Eine Hand halten, einfach so.
Eine kühle Brise auf der Haut spüren.
Eine liebevolle Nachricht zur richtigen Zeit erhalten.
Ein ehrliches Lächeln bekommen – oder schenken.
Ein frischer Ingwer-Zitrone-Minze-Tee mit bestem Honig.
Einfach den Wellen am Strand zuschauen.
Einfach ziellos spazieren gehen.
Etwas Neues lernen, einfach weil es Freude macht.
Fahrrad fahren.
Für andere da sein.
Fürsorgliche und hilfsbereite Ärzte um sich haben.
Gitarre spielen.
Gute Bücher lesen.
Gute Gespräche.
Gute Musik.
Griechischer Joghurt mit 5 % Fettanteil.
Im Auto laut mitsingen.
In der Sauna sitzen.
Interessanten Podcasts lauschen.
Jemandem zuhören, ohne etwas sagen zu müssen.
Lecker für sich und andere kochen.
Mit Freunden laut lachen, bis einem der Bauch wehtut.
Mit jemandem schweigen, ohne dass es unangenehm ist.
Miterleben, wie Kinder groß werden.
Morgens aufwachen und merken, dass man ausgeschlafen ist.
Ofenwarme Croissants.
Pasta al dente.
Schafe blöken hören.
Selbstgemachten Nudelsalat essen.
Sich den Wind um die Nase wehen lassen.
Sich inspirieren lassen.
Vogelgezwitscher am Morgen und am Abend.
Warme Sonnenstrahlen.
Warmes Baguette mit Frischkäse.
Zeit mit Freunden verbringen.
Ziegen beim Meckern lauschen.
Die Stille nach einem Gewitter.
Und noch vieles, vieles, vieles mehr.
Jeder einzelne Moment – absolut lebenswert und liebenswert.
Das Leben muss man nicht neu erfinden. Es genügt, es einfach und immer wieder zu bemerken.
New York, New York
„If I can make it there, I’ll make it anywhere.“ Wahrscheinlich die berühmteste Textzeile des Songs New York, New York, den Frank Sinatra weltberühmt gemacht hat – die Hymne auf eine Stadt schlechthin. Liza Minnelli war damit indes schon 1977 erfolgreich, als sie den Song erstmals aufnahm.
„Rags to riches“ ist ebenfalls so eine typische Redewendung aus dem Land der Freiheit und der Heimat der Tapferen – auf Deutsch: vom Tellerwäscher zum Millionär. Man muss nur daran glauben.
Als ich Ende der Nullerjahre mal wieder mit meinem Rad die Straßen New Yorks unsicher machte, musste ich an der Kreuzung 23rd Street und 5th Avenue am rot leuchtenden Lichtsignal-Diktator anhalten. Allerdings nur ungern. Rote Ampeln sind für NYC-Radler kein Imperativ zum Verweilen. Zwei nicht ganz so freundlich dreinblickende Cops verliehen dem Zwangsstopp allerdings durch ihre Präsenz ein wenig Nachdruck. So hatte ich Zeit, mich umzuschauen. Zu meiner Rechten das berühmte Flatiron Building – von Deutschen wegen seiner Form auch das „Bügeleisengebäude“ genannt – und schräg rechts vor mir der Madison Square Park. Eine von wenigen Grünflächen in der Betonwüste.
Ich bemerkte einen Obdachlosen, wie er die 5th Avenue in Richtung Park überqueren wollte. Seine schwer in Mitleidenschaft gezogene Kleidung wog am Ende wohl mehr als er selbst, und ich registrierte seine vorne halboffenen Schuhe mit jeweils bandagiertem Mittelfuß. Es sah so aus, als hätte man ihm die Zehen an beiden Füßen amputiert. Er war in ziemlich schlechter Gesamtverfassung, und es dauerte fast 2 Minuten, bis er die vielleicht 30 Meter überquert hatte. Unsere Ampel war zwar längst wieder auf Grün gesprungen, doch keiner fuhr los. Erst als der Wohnungslose auf dem Trottoir stand, rollten die Autos wieder an.
Ich fuhr zu ihm und fragte, ob ich ihm etwas zu essen oder zu trinken besorgen könne. Er war aufrichtig. Er wollte nur Geld. Ich gab ihm ein paar Dollar und fragte, was passiert sei – ob er einen Unfall gehabt hätte. Er sagte, er habe Diabetes, und sie hätten ihm die Zehen amputieren müssen, weil die Wunden an den Füßen nicht heilten. Sonst hätte er sich wahrscheinlich eine gefährliche Infektion geholt. Unvorstellbar traurig. Wir wechselten noch ein paar Worte, dann wünschte ich ihm gute Besserung.
Seine Antwort:
„Man, I hope it will get better, I really do.“
Der Sieg der US-amerikanischen Hoffnung. Ach ja – ich bin ja selbst ein US-Amerikaner.
Crampus Spasmus
Nein, das ist keine fiktive Figur aus dem Filmklassiker Life of Brian von den Monty Python. Wobei – eine Erwähnung hätte der Name verdient. Allerdings, wenn Pontius Pilatus mit seinem lispelnden Sprachfehler in der Originalfassung „Biggus Dickus“ sagt – das ist nicht zu schlagen. Im Deutschen genial mit „Schwanzus Longus“ übersetzt. Mein nächtlicher Besucher allerdings war deutlich weniger unterhaltsam. Das war dann tatsächlich Crampus Spasmus.
Die Kategorie „harmloser Wadenkrampf“ hat mit dem, was mich seit zwei Nächten heimsucht, ungefähr so viel gemeinsam wie ein juckender Mückenstich mit einer Zahnwurzelbehandlung – ohne Betäubung. Meine Beinmuskeln – Waden und Oberschenkel – ziehen sich brutal zusammen. Normalerweise folgt kurz darauf das Signal zum Entspannen – oder ich kann die Krämpfe zumindest schnell wegdehnen. Bei meinen Krämpfen bleibt jedoch genau dieses Signal aus – die Muskeln verharren im Krampf. Jede noch so kleine Bewegung macht die Kontraktion nur schlimmer. Und nachts, wenn die Muskeln „kalt“ sind, krampfen sie besonders gerne. Tagsüber bleibe ich – bis dato – verschont.
In der Regel steckt ein Ungleichgewicht von Magnesium, Kalium oder Calcium dahinter. Aber in meinem Fall gibt es ein paar zusätzliche Verdächtige: Chemo, Hormontherapie, Cortison – die heilige Trinität der nächtlichen Muskelkontraktion. Diese Medikamente können den Kaliumspiegel deutlich senken. Dazu kommt, dass ich aktuell wesentlich weniger aktiv bin als gewohnt. Der damit verbundene Muskelabbau und die fehlende Bewegung sind perfekte Verstärker.
Die Folgen sind weniger poetisch: Schlafmangel, die Dritte. Ich werde heute alle Bananen und Nüsse kaufen, die ich in die Finger bekomme – und hoffe, dass die Blutuntersuchung am kommenden Mittwoch weitere Aufschlüsse bringt, damit die Ärzte gegebenenfalls gegensteuern können.
Und zum Thema Empathie mit Frauen: Ich bin jetzt offiziell in der Menopause angekommen. Gestern saß ich entspannt im Café, genoss einen Latte macchiato – und zack: Ich sah aus, als hätte ich gerade 10 Minuten Sauna hinter mir. Aus dem Nichts. Ohne Vorwarnung. Irre. Die antihormonelle Behandlung leistet nach knapp einem Monat ganze Arbeit. Ich werde jetzt wohl künftig immer mit einem Frotteehandtuch durch die Gegend laufen. Oder besser: in Joggingklamotten. Dazu eine Smartwatch Fit Pro – auf die ich dann bei jedem Schweißausbruch konzentriert schaue – und jogge einfach kurz auf der Stelle. Der Dichter Phädrus hatte es schon vor zweitausend Jahren auf den Punkt gebracht:
„Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen.“
Aufmerksamkeit – 12. Oktober 2025
Ein wunderbares Wort, wenn man es mal auseinanderpflückt – Auf – merk – sam – keit. Vier Silben, ein kleiner Kosmos. „Auf“ steht für Richtung. Etwas öffnet sich, will hin zu etwas anderem. „Merk“ – also bemerken, wahrnehmen, im Gedächtnis behalten. Dann kommt „sam“ – als Haltung, als weiches Anhängsel – und schließlich „keit“ – die grammatische Zauberformel, die aus einem Zustand ein Wesen macht. Übersetzt hieße das also: „Die Bereitschaft, etwas bewusst zu bemerken.“ Schöner kann man es kaum sagen. Ein Zustand stiller Wachheit. Keine Aktivität, sondern eine Haltung. Aufmerksamkeit ist die leise Form von Liebe. Sie schaut hin und hört zu.
Inspiriert durch ein schönes, langes Telefonat mit einem guten Freund fiel mir dazu wieder etwas ein:
Vor knapp zwei Jahren ist die zweite Frau meines Opas verstorben – also meine Oma Nummer drei. Sie wurde 81 und überlebte vier verschiedene Krebsdiagnosen. Mehr Lebenswille geht kaum. Wie das bei älteren Menschen oft so ist, bietet der Alltag irgendwann nicht mehr allzu viel Abwechslung. Eine stark eingeschränkte Routine aus Frühstück, Mittagessen, Abendessen – dazwischen Fernsehen. Sie war lange Jahre für meinen Großvater da und hat ihn getragen. Auch diesem Umstand habe ich es zu verdanken, dass ich mit fünfzig noch einen Opa hatte. Ich wusste das immer zu schätzen. Die letzten zehn Jahre ihres Lebens war ihr Mann nicht mehr an ihrer Seite. Noch weniger Routine.
Auch deshalb rief ich sie zweimal am Tag an und fragte, wie es ihr ging. Da gab es naturgemäß wenig Neues zu berichten, also wiederholte sie ihre liebgewonnenen und wichtigen Geschichten ein ums andere Mal. Selbst wenn ich ihr als Souffleur Stichworte gab – um ihr anzudeuten, dass ich die Geschichte schon kannte: „Ah, ja genau, die Frau Schmidt hat das doch zu dir gesagt?“ – wiederholte sie den Satz und erzählte die Geschichte genauso, wie sie es schon unzählige Male zuvor getan hatte: „Ja, genau, die Frau Schmidt hat das zu mir gesagt und dann hat sie gesagt …“
Ich musste eigentlich nicht mehr zuhören. Ich kannte mittlerweile alle Geschichten in- und auswendig. Das ging so seit fast zwanzig Jahren. Da darf Dinner for One sich gerne die Silbermedaille um den Hals hängen. Meine Oma war sozusagen nicht „Same procedure as last year?“, sondern „Same procedure as every day?“ Das führte bei mir zu einer Omatelefonat-Monotonieintoleranz und zu einer immer häufiger einsetzenden Weghöreritis. Während sie sprach, beschäftigte ich mich oft mit anderen Dingen. Sehr respektlos. Mir fiel das irgendwann auf – und ich fand mein Verhalten etwas beschämend.
Ich änderte mein Skript. Ab da war ich während unserer Telefonate wirklich da. Ganz Ohr, ganz bei ihr. Ich suchte mir jedes Mal für unsere Plauderviertelstündchen ein schönes Plätzchen in einem Café und hörte ihr einfach und aufmerksam zu.
Wenn wir sitzen, dann stehen wir schon.
Wenn wir stehen, dann gehen wir schon.
Wenn wir gehen, dann sind wir bereits im Ziel.
Wir sind nie dort, wo wir wirklich gerade sind.
24 Bilder pro Sekunde
In der Film- und Videotechnik hat sich standardmäßig eine Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde durchgesetzt. Sie sorgt dafür, dass wir eine Abfolge einzelner Bilder als fließendes Bewegtbild wahrnehmen. Ein 90-minütiger Film besteht also aus 129.600 Einzelbildern. Da unser Auge pro Sekunde nur etwa 16 verschiedene Einzelbilder unterscheiden kann, verschmelzen die Bildeindrücke im Sehzentrum des Gehirns zu flüssigen Bewegungsabläufen, sobald es mehr zu sehen bekommt. IMAX HD verwendet sogar 48 Bilder pro Sekunde.
So ungefähr geht es mir in den letzten Wochen ebenfalls. Ich nehme unzählige Einzelbilder wahr, die sich zu einer Filmsequenz zusammensetzen. Allerdings ist das absolut kein zusammenhängender und in sich stimmiger Film. Das könnte locker die Fortsetzung von Interstellar sein. „Schatz, hast du verstanden, worum es ging?“ – „Nein, aber Matthew McConaughey sah wieder klasse aus und die Musik war auch prima.“
In den letzten Tagen und Wochen sind diese „Einzelbilder“ besonders intensiv. Speziell jene, die mit dem Lebensende zu tun haben. Gestern ist Diane Keaton gestorben. 79 Jahre alt. Soll ich schreiben: nur 18 Jahre älter als ich? Das sind 6.570 Tage Unterschied – ein Wimpernschlag. Mit anderen Worten: noch 18-mal in den Sommerurlaub fahren. Wenn’s gut läuft. Solche Idole sterben eigentlich nicht. Eigentlich soll man ja eigentlich nicht sagen. Robert Redford war für mich ebenfalls unsterblich.
Eine junge Schauspielerin, Wanda Perdelwitz aus Hamburg, wurde nur 41 Jahre alt. Im Grunde müsste man hier „41 Jahre jung“ schreiben. Sie kollidierte beim Fahrradfahren mit der Beifahrertür eines Autos und starb an den Unfallfolgen. Als ich die Nachricht las, dachte ich daran, was sie wohl geantwortet hätte, wenn man sie am Morgen des Unfalltages gefragt hätte, was heute so alles passieren könnte. Hätte sie die Beifahrertür in irgendeiner Form im Blickfeld gehabt? Darf man bezweifeln.
Mir kam in diesem Zusammenhang auch wieder das Unglück mit dem Elevador da Glória ins Bewusstsein. Das historische Standseilbahn-System entgleiste am 3. September 2025, wodurch 16 Menschen ums Leben kamen und 23 verletzt wurden. Lissabon. Perfekte Urlaubsstimmung. 30 Grad und schönster Sonnenschein. Die ikonische Standseilbahn-Touristenattraktion verbindet tiefer gelegene Stadtteile mit höher gelegenen Vierteln der Stadt der sieben Hügel. Ausgelassene Stimmung. Was hätten diese 39 Menschen wohl geantwortet, wenn man sie vor Fahrtantritt nach dem weiteren Tagesverlauf gefragt hätte?
Nicholas Taleb nennt solche Ereignisse „schwarze Schwäne“. Ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, das völlig unwahrscheinlich ist, gänzlich überraschend eintritt und (fast) alle erstaunt. Insofern ist unser Leben im Prinzip ein schwarzer Schwan – ein unvorhergesehenes Ereignis, das niemand kommen sieht und die Spielregeln verändert.
Das war mein 2. September 2025. Mein Cygnus atratus.
Das Leben liefert in Endlosschleife Einzelbildmaterial – ohne Schnitt, ohne Dramaturgie, ohne Score. Vielleicht ist das ja die eigentliche Kunst: die Bilder nicht zu sortieren, sondern sie einfach vorbeiziehen zu lassen, ohne alles verstehen zu müssen. Und wenn’s zwischendurch ruckelt, dann liegt’s nicht an der Technik. Nur an der Seele, die manchmal einfach nicht hinterherkommt mit 24 Bildern pro Sekunde.
Die IMAX-Bildrate braucht im Leben niemand.
Tick-tack. Tick-tack. Tick-tack.
Kleine große Gesten
Der kann sich glücklich schätzen, der ein Dach über dem Kopf hat. Der gute Freunde hat. Der Prüfungen bestanden hat. Der in einem sicheren Land lebt. Eine Kurzübersicht der Google-KI. Recht hat sie. So richtig gendergerecht ist die Antwort allerdings nicht. Ich hoffe, das Darauf-Aufmerksam-Machen ist eine ausreichende Wiedergutmachung der googleschen Fehlprogrammierung.
Ich hätte dieser „Sich glücklich schätzen“-Liste zwei bemerkenswerte Punkte hinzuzufügen. Wenn sich dein Hausarzt auch am Wochenende aus freien Stücken bei dir meldet und sich nach deinem Befinden erkundigt – und wenn dich im Gym die stets freundliche, aber angenehm zurückhaltende Fachkraft an der Rezeption fragt, ob du einen Moment Zeit hättest. Beides ist gestern passiert.
Nach meinem verkrampften Blogeintrag machte sich mein Leib- und Seelenklempner Sorgen und schlug mir verschiedene medikamentöse Möglichkeiten vor, um solch eine Nacht nicht noch einmal durchleben zu müssen. Wir besprachen am Telefon die Vor- und Nachteile von Muskelrelaxantien und entschieden uns für Diazepam 5 mg. Es hemmt Unruhe, Spannungszustände – genau mein Stichwort – und Angstgefühle. Entspannung für meine arg verkrampften Muskeln war angesagt. Ich erhielt das Rezept als PDF und ging mit einem angenehmen Gefühl von Geborgenheit zur Nachtapotheke. Palim, palim!
Schon am Nachmittag hatte mich die Rezeptionistin im Gym gefragt, ob ich kurz Zeit hätte. Hatte ich – und folgte ihr in den Wellnessbereich. Sie überreichte mir eine Packung Kräutertee der Marke „Hierbas Marcela“ aus Uruguay. Darauf hatte sie mit blauem Filzstift meinen Namen geschrieben, zwei Herzchen links und rechts daneben. Die spanische Übersetzung der Unterzeile des Tees ins Deutsche: „Das ist eine gute Sache.“ Nein – das ist eine außergewöhnlich mitmenschliche Sache. Ich war sehr gerührt von dieser Geste. Sie umarmte mich und sagte: „Alles wird gut.“ Ich gab ihr zwei sachte Wangenküsse und antwortete: „Ja, das wird es.“
Der Seelenherztee war außergewöhnlich lecker und das Diazepam hat Crampus Spasmus fast komplett in Schach gehalten. Sweet dreams are made of this.
Valium – 13. Oktober 2025
Auch ein guter Freund meldete sich per elektronischer Post bei mir und freute sich, dass das Diazepam Wirkung zeigte. Heute Nacht streckte Crampus alle Viere von sich und kapitulierte. Das nächtlich eingenommene Beruhigungsmittel – ein anderes Wort dafür: Valium – leistete ganze Arbeit. Ich kam nicht mal mehr dazu, den Schnuller aus dem Mund zu nehmen. Der vollgesabberte Kissenbezug persilt bereits in der Waschmaschine. Das Valium – vom lateinischen vale, was „Lebewohl“ bedeutet – stand sprichwörtlich an der Bahnsteigkante und schwenkte zum Abschied das Taschentuch. Der Peiniger war – vorerst – außer Sichtweite.
Heute will mich meine Onkologin anrufen und mit mir die Prednison-Situation besprechen. Meine erste Chemotherapie liegt jetzt genau eine Woche zurück – und ich Glücklicher blieb bislang von den zuvor erläuterten Nebenwirkungen verschont. Beinkrämpfe hatte sie jedoch nicht auf ihrem Beipackzettel stehen. Jetzt beginnen – sozusagen – zwei Wochen der Rekonvaleszenz, um meinen Körper für die zweite Sitzung wieder auf Vordermann zu bringen. Ich werde in meine „Bank der Vorbereitung“ alles einzahlen, was geht, um in zwei Wochen davon zu profitieren.
Am Abend treffe ich mich deshalb mit einer Fachfrau für Ernährung und Diätetik. Mein Magen hat schon ruhigere Zeiten erlebt. Ich werde mit ihr meinen Speiseplan durchgehen und hoffe auf Anregungen, wie ich meine induzierte Magenneurose in den Griff bekommen kann. Das nahrungsmittelverarbeitende Organ darf gerne etwas weniger grummeln.
Übrigens: Die Kefir-Abteilung von Müllermilch begrüßt mich mittlerweile schon wieder persönlich – und per Handschlag.
My Thoughts and Prayers are with … – 14. Oktober 2025
Unsere Politiker sagen dann: „Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und ihren Familien.“ Worte, die trösten sollen – aber nichts verändern. Symbolik statt Substanz. Echte Hilfe oder Unterstützung für die Betroffenen sieht anders aus.
Der Dalai Lama soll einmal gesagt haben: „Unser oberstes Ziel in diesem Leben ist es, anderen zu helfen. Und wenn du ihnen nicht helfen kannst, dann füge ihnen keinen Schaden zu.“ Mein Opa hatte da eine ganz ähnliche Lebensphilosophie: „Tue Gutes – und sprich nicht darüber.“
In den Vereinigten Staaten ist der Oktober der Breast Cancer Awareness Month. Auf Deutsch etwas spröde: „Monat der Brustkrebsaufklärung“. Dann prangt auf allen möglichen Produkten eine rosa Schleife – und man hat beim Kauf das gute Gefühl, Teil von etwas Gutem zu sein. Unser innerer Robin Hood klopft sich zufrieden auf die Schulter: Man hat ja bewusst ein bisschen mehr bezahlt, für den guten Zweck. Im Kleingedruckten steht dann aber oft, dass der Aufpreis nicht in Forschung oder Hilfe fließt, sondern in noch mehr Werbung – für noch mehr Aufmerksamkeit. Symbolik statt Substanz, die zweite.
Und warum eigentlich „nur“ Breast Cancer Awareness Month? Was ist mit all den anderen Formen von Krebs? Bin ich mit meinem Prostatakarzinom dann außen vor? Vielleicht liegt’s einfach an der magnetischen Anziehungskraft der weiblichen Brust – reine Spekulation. Es sollte schlicht Cancer Awareness Month heißen. Einer für alle.
Man kann natürlich öffentlichkeitswirksam bei einem Benefizlauf mitmachen – bunte Trikots, rosa Stirnbänder, Hashtag fürs gute Gewissen und Fotos für Instagram. Oder man überweist einfach einen Betrag X, still und leise. Wenn man allerdings zweimal die Woche mit der Hündin Bella im Park joggt, klatscht halt keiner.
In den letzten Wochen hatte ich das unfassbare Glück – wobei „Glück“ vielleicht gar nicht das richtige Wort ist –, dass so viele Menschen in meinem Umfeld an mich gedacht, mich unterstützt, mich umsorgt haben. Manche davon völlig unerwartet – wie meine Tee-Fee. Das ist echtes Da-Sein. Keine Symbolik. Keine Charity. Nur Menschlichkeit.
Der Dalai Lama hat es auf den Punkt gebracht: Anderen Menschen helfen – und ihnen keinen Schaden zufügen. Wir leben jedoch in einer Welt, in der man sich so ein uneigennütziges Verhalten kaum noch vorstellen kann.
Ich werde heute Abend für jede und jeden meiner Beisteher, Helfer, Unterstützer und Kümmerer eine Kerze anzünden. Die freundliche Kassiererin im Supermarkt fragte mich vorhin, was ich denn mit 200 Teelichtern anfangen wolle. Ich lächelte und sagte: „Ich will die Welt ein bisschen heller machen – für all die, die sie mir in den letzten Wochen erhellt haben.“
Danke. Thank you. Gracias. Merci.
Mondzyklus
Therapeutisch habe ich jetzt offiziell einen Mondzyklus hinter mir. Also die oft zitierten 28 Tage. Die Verfechter des „ewigen Kalenders“ oder auch des „Weltkalenders“ freuen sich allerdings ein bisschen zu früh. Die 28 Tage, in denen sich der Mond einmal komplett erneuert, heißen in der Wissenschaft „synodischer Monat“ – und dauern rund 29,5 Tage, bis der Mond wieder an derselben Stelle zur Sonne steht. Also von Neumond zu Neumond. Ein kompletter Mondzyklus dauert exakt 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten und 2,9 Sekunden. So viel zum Thema „mal schnell etwas abrunden“.
In der Theorie der 13-Monats-Reformerin Elisabeth Achelis sollte die Unordnung des Himmels in menschliche Tabellen gepresst werden. Jeder Monat sollte 28 Tage haben, also exakt vier Wochen – perfekt gleichmäßig, ein geometrischer Traum, aber ein astronomischer Kompromiss, wie oben bereits beschrieben. Es ist die Idee, dass sich Körper, Seele und Natur im 28-Tage-Rhythmus bewegen sollten (Mond, Menstruation, Schlafzyklen etc.).
Mathematisch ergeben 13 Monate à 28 Tage lediglich 364 Tage. Ups – da fehlt doch einer!? Also musste noch ein zusätzlicher „Welt-Tag“ her, damit man wieder bei den 365 Tagen für die vollständige Umrundung unserer Erde um die Sonne landet. Der Hobbymathematiker in mir möchte korrigierend bemerken: Die Erde benötigt genau 365,242 Tage. Vielleicht ist doch nicht alles so durchdacht, wie es scheint.
Als ich heute früh die letzten beiden Tabletten der ersten Packung Nubeqa eingenommen hatte – die Verpackungseinheit ganz im Sinne von Elisabeth Achelis: 112 Tabletten, vier Pillen pro Tag, gleich 28 Tage – wurde mir wieder bewusst, welchen außergewöhnlichen Support ich in den letzten sechs Wochen hatte und wie wenig Zeit letztlich von der Erstdiagnose bis hin zur Therapiestufe vier vergangen ist. Ab morgen beginnt dann der zweite Nubeqa-Mondphasenzyklus.
Übrigens: Die Mondmythologie oder der Mondglaube besagt, dass die verschiedenen Mondphasen einen Einfluss auf das menschliche Verhalten haben. Allerdings bleibt der Mond immer derselbe – nur der beleuchtete Anteil verändert sich, je nach Stellung von Erde, Mond und Sonne. Die Gravitationskräfte des Mondes wirken stark auf die Ozeane, aber die Anziehungskraft auf den menschlichen Körper ist verschwindend gering – kleiner als der Gravitationseinfluss eines vorbeifahrenden Autos. Wissenschaftliche Studien haben immer wieder versucht, Zusammenhänge zwischen Vollmond und Schlaf, Verhalten oder Unfällen zu finden – das Ergebnis: Es gibt keinen.
Aber es gibt ja auch Placebo- und Nocebo-Effekte. Dann wirkt der Mond eben psychologisch. Egal. Hauptsache gesund.
Ich lausche jetzt Claire de lune. Danke, Debussy.
Nichts hält länger als ein Provisorium – 15. Oktober 2025
Natürlich kann man – ausgestattet mit Schlagbohrmaschine, Sicherheitsbrille, Wasserwaage, Bleistift, Dübel und Spezialschrauben – Löcher in die Wand bohren und dann das neu erworbene und gerahmte IKEA-Kunstwerk professionell und langlebig anbringen. Anschließender Kommentar der Freunde: „Du, ich glaube, das Bild hängt schief.“
Oder man macht’s provisorisch, bastelt sich aus Tesafilm ein doppelseitiges Klebeband und pappt das gerahmte Meisterwerk einfach so an die Wand. Der sicherheitshalber zusätzlich angebrachte Powerstrip wird’s schon richten. Geht schneller, macht weniger Dreck – und man spart sich das Absaugen des feinen Bohrstaubs. So geht Galerie.
Die Beweisführung, dass ein Provisorium eben doch nicht ewig hält, kam heute per Podcast. Seit meiner deprimierenden Prednison-Internetrecherche hatte ich mir meine neue Pippi-Langstrumpf-Welt – Widdewidde wie sie mir gefällt – zusammengebastelt und lebte seither in angenehm magenschonender Harmonie. Gemäß Dominiques Motto: „Und sonst?“ Ignorance is bliss.
Heute bekam ich via WhatsApp einen Podcast mit dem Titel Wie kann man Krebs wirklich verhindern? empfohlen. Mein Ego übernahm sofort wieder die Komplettregie und warf alle Pippilotta-Viktualia-Vorsätze über Bord. Die Gier nach Neuem obsiegte. Matze Hielscher im Gespräch mit der Krebsforscherin Dr. Hanna Heikenwälder. Hier die Zusammenfassung der Einleitung:
„Krebs ist keine Krankheit im klassischen Sinn – eher ein biologischer Prozess, der mit uns beginnt, sobald das Leben anfängt. Unsere Zellen teilen sich, und mit jeder Teilung sammeln sich kleine Schäden. So wie wir altern, entstehen in uns winzige Vorstufen von Krebs – Polypen, Muttermale, Knoten. Nicht ob, sondern wann ist die eigentliche Frage. Die meisten Menschen beschäftigen sich erst mit Krebs, wenn sie ihn schon haben. Dann ist der Spielraum meist nicht mehr groß.
Was wir beeinflussen können, ist die Geschwindigkeit dieses Prozesses. Ernährung, Bewegung, Lebensweise – das alles bestimmt, wie schnell Zellen auf Abwege geraten. Zum Beispiel durch konstante Vitamin-D-Substitution. Was auch kaum jemand weiß: Fruchtsäfte sind letztlich schädlicher als Orangenlimonade. Krebs betrifft uns alle – biologisch, nicht metaphorisch. Nur die Diagnose trifft nicht jeden, aber der Prozess läuft in jedem Körper. Vielleicht ist das die unangenehme, aber auch tröstliche Wahrheit: Wir alle tragen ihn in uns. Nur die Art, wie wir leben, entscheidet, ob und wann er sichtbar wird. Aber Krebsvorstufen – die finden sich ab einem gewissen Alter in jedem Menschen.“
Bis dahin noch interessant. Danach ging’s emotional steil bergab. Der Podcast beschrieb die Aussichten von Patienten, deren Krebs sich bereits im Körper ausgebreitet hat – also Metastasen gebildet hat. Ich hatte noch während des Lauschens ein imaginäres, spontan entstandenes Magengeschwür. Nicht nur fiel mein provisorisch tesageklebtes Gemälde von der Wand, sondern auch das professionell verdübelte gleich mit – und danach zerbröselte auch noch die ganze Wand. Mein zuvor so stabil empfundenes positives Körpergefühl lag – wieder mal – in Trümmern. Brutal, was Gedanken innerhalb von Millisekunden auslösen können.
Podcasts, Berichte, Analysen – alles, was wissen will, darf ab sofort einen großen Bogen um mich machen. Sack Reis in China.
Es gibt geschätzt 55 Millionen Krebspatienten auf diesem blauen Planeten. Ich bin einer von ihnen. Aber so, wie die 400 bis 500 Millionen Buddhisten auf dieser Welt nicht alle gleich sind – nur weil sie sich Buddhisten nennen –, sind auch wir Krebspatienten Individuen.
Ich bin eine Krebspatientschneeflocke. Mich gibt’s nur einmal.
Intuition
Tag 9 nach der ersten Chemotherapiesitzung. Sozusagen fast Halbzeit zwischen Chemo eins und Chemo zwei. Der große Blutbild-Aderlass stand heute auf dem Programm. Ich schwang mich auf mein Citybike und radelte am Morgen nüchtern die fast Tour-de-France-verdächtige, fünf Kilometer lange Etappe zur urologischen Praxis. Schön brav auf dem Fahrradweg und mit Boxenstopp an den roten Ampeln – nur bei Grün, der Kinder wegen. Pünktlich um 9 Uhr stand ich an der Rezeption und durfte direkt in den Behandlungsraum.
Ich habe stark sichtbare Venen, und so bereitet den Arzthelferinnen die Venenpunktion immer ein kleines Vergnügen. Piksen. Entnahme. Pflaster. Nach einer Minute war schon alles vorbei. Am Freitag folgt dann die Besprechung der Blutanalyse mit dem Urologen. Ich bin neugierig, wie und ob sich mein Körper regeneriert hat. Ich erzählte Draculas Gehilfin noch von meinen nächtlichen Beinkrämpfen und bat sie darum – falls das überhaupt möglich sei – auch Blutwertparameter zu bestimmen, die eventuell etwas mit den Spasmen zu tun haben. Das wollte sie so weitergeben.
Sie sagte mir noch, dass es wichtig sei, während der Chemotherapie kein zusätzliches, also hochdosiertes Vitamin C zu mir zu nehmen – das sei kontraproduktiv. Ah ja. Pah, mir doch egal. Ich werde das nicht googeln bzw. chatGPTen. Mein Ingwertee mit Zitrone werde ich weiterhin genießen.
Und zum Thema Intuition – laut Wörterbuchdefinition:
Das unmittelbare, nicht diskursive, nicht auf Reflexion beruhende Erkennen, Erfassen eines Sachverhalts oder eines komplizierten Vorgangs. Eingebung.
Diese Nachricht erhielt ich heute von meiner Ärztin:
„Lieber Robert, ich habe es befürchtet … (ich habe gerade deinen Blog weitergelesen). Den Podcast habe ich schon letzte Woche gehört, als er frisch erschienen ist – und mich ganz bewusst dagegen entschieden, ihn dir weiterzuleiten, obwohl ich kurz den Impuls dazu hatte. Für jemanden, der bisher von Krebs verschont geblieben ist, ist er sicher interessant und informativ. Für dich in deiner Situation jedoch total kontraproduktiv.
Nach der Theorie von Hanna Heikenwälder hättest du mit 60 eigentlich noch gar keinen Krebs bekommen dürfen – du hast schließlich all das befolgt, was sie empfiehlt: viel Bewegung, gesunde Ernährung, ein bewusster Lebensstil. Und trotzdem hat es dich getroffen. Aber ich finde, genau darin liegt auch eine Art Stärke: Du gehörst zu der kleinen Minderheit, die trotz all dieser gesunden Voraussetzungen krank geworden ist – also zu den wenigen, die statistisch gesehen überhaupt betroffen sein konnten. Dreh das einfach für dich um: Wenn du schon gegen die Wahrscheinlichkeit krank geworden bist, kannst du genauso gut gegen die Wahrscheinlichkeit den Krebs wieder zurückdrängen. Verstehst du, was ich meine? Stärke!“
Ich hatte nun auch die offizielle Begründung, warum ich den Podcast nach 5 Minuten abgebrochen hatte. Mein sechster Sinn, mein Bauchgefühl, meine Intuition – sie funktionieren. Ich werde mich auf sie verlassen.
Wie heißt es so wunderschön in dem Song That’s What Friends Are For:
Keep smiling, keep shining.
Knowing you can always count on me,
for sure.
That’s what friends are for.
Wer solche Freunde hat, braucht (fast) keine Engel (mehr).
Tiekgisolhcsuättnefiewzrevffohnho – 16. Oktober 2025
Für all diejenigen, denen mein Blogtitel zu kompliziert erscheint – wie wäre es mit der rückwärts geschriebenen Version? Klingt ein wenig nach „Schweizerisch meets Ungarisch“ mit einem Schuss „Isländisch“ im Abgang. Teilnehmer eines Spelling-Bee-Wettbewerbs – auf Deutsch augenzwinkernd als „Buchstabienen“ bezeichnet – hätten aussprachetechnisch bei diesem Wort kein leichtes Spiel und bräuchten dafür ein wenig Zungen-Yoga für Fortgeschrittene.
Das Gegenteil von „Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit“ ist seit heute: „Hofflichtfreudtrauensseelversicht“. Das Licht der Welt erblickte das Konträr am 16. Oktober 2025 um exakt 11:58 Uhr. Heute vor 45 Tagen saß ich das letzte Mal auf meinem Rennrad – auch „die rote Bestie“ genannt. 1.080 lange Stunden Sehnsucht, Verlangen, Verzicht und Vorfreude.
Meine Hausärztin schaute gestern Abend noch spontan und unverhofft vorbei und gab mir Tabletten, die gegen Krämpfe helfen sollen: Limptar-Filmtabletten. Ich werde nichts dazu googeln. Ich bin seit Frau Dr. Heikenwälder google-immun. Sie fragte mich, wie es mir ginge, und ich erzählte ihr davon, dass ich am nächsten Tag wieder richtig Fahrrad fahren wollte. Sie sagte: „Mach das!“ Also, Dschinni: Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich klickte meine Klickpedale in die Rennradpedale meines Cipollini und fuhr heute den Sonnenstrahlen entgegen. Ein unbeschreiblich schönes, glückerfülltes Gefühl. Gym-Trainingsfahrräder in allen Ehren – aber das ist, als würde man frisch gepflückte, leuchtend rote Erdbeeren geschmacklich mit Erdbeer-Quetschies vom Discounter vergleichen wollen. Von Karies ganz zu schweigen.
Ich fuhr zu meinem Lieblingsstammbistro und sog jeden Straßenmeter in mich auf. Alles fühlte sich herrlich vertraut an. In der Verköstigungsstation angekommen, gönnte ich mir Spiegeleier mit frischem Baguette und Butter sowie einen Milchkaffee. Die Kellner hatten mich vermisst, und ich erklärte ihnen den Grund meiner Absenz. Ich kam aus dem Umarmen nicht mehr heraus und meine Bestellung ging aufs Haus. Ich habe den Betrag dann als Trinkgeld liegen lassen. Während ich so dasaß, mein Gesicht der Sonne entgegenstreckte und mit beiden Händen den Milchkaffee festhielt, war das vertraute Gefühl wieder da. Ich war wieder der alte Robert. Als wäre nichts geschehen. Ich fühlte mich hundertprozentig wie vor 46 Tagen – dem Tag, bevor ich die Diagnose erhielt. Ganz ehrlich, wenn mir in diesem Moment jemand gesagt hätte, dass ich schwer krank sei – also das, was am 2. September 2025 Gewissheit wurde –, ich hätte nur gelächelt und gesagt: „Papperlapapp.“
René Descartes hatte ein klein wenig Unrecht. Es sollte nicht nur „Ich denke, also bin ich“ heißen, sondern auch: „Ich fühle, also bin ich.“
Baader-Meinhof-Phänomen – 17. Oktober 2025
Ist Ihnen das auch schon einmal – beziehungsweise öfter – passiert? Immer wenn Sie auf die Digitaluhr schauen – zack! – die gleiche Uhrzeit. Ich habe gleich zwei sich abwechselnde Favoriten: einmal 09:11 und genauso häufig 19:12.
09:11 ist selbsterklärend – das vergesse ich nicht mehr. 19.12.? Da muss man schon wissen, dass Rudi Carrell an diesem Tag Geburtstag hatte. Noch nie von ihm gehört? Also gut: Das ist ebenfalls der Ehrentag von Jake Gyllenhaal. Diesen Namen auch noch nie gehört? Na dann – es ist auch mein Hoch-leb-lassen-Tag. Fünf Tage vor Weihnachten. Ein Albtraum und Trauma für Kinder. „Bekomm’ ich jetzt mein Geschenk?“ – „Nein, du bekommst dein Geschenk an Weihnachten, dann aber auch ein richtig großes.“ Es gab dann Nüsse, Mandarinen, Socken, Unterwäsche und ein Ravensburger Puzzle. So geht Frustrationstoleranz.
Ich kannte mal einen Musikproduzenten aus Berlin, der sich permanent – sprich täglich – bei allen möglichen Versandhandelsunternehmen Dinge bestellte. Zum Teil völlig sinnlosen Kram. Jeden Tag, manchmal sogar mehrmals. Als ich ihn fragte, warum er das tue, antwortete er: „Da quasi jeden Tag ein Paketdienst bei mir klingelt und die bestellten Pakete abliefert, fühlt sich jeder Tag ein bisschen wie Weihnachten an. Ich weiß ja nie, was drin ist.“ Wahrscheinlich hatte er am 24.12. Geburtstag.
So wie mit den Uhrzeiten ist das bei mir seit ein paar Wochen nun auch mit dem Thema Krebs. Seit ich den Prostatakrebs-Hammer in der Hand halte, sehe ich nur noch Vorsteherdrüsen-Nägel. Bob der Baumeister mit selektiver Wahrnehmung.
Diesen Effekt nennt man: Baader-Meinhof-Phänomen.
Da muss man erst einmal draufkommen – die beiden sind ja eigentlich die bekanntesten Mitglieder der Gründergruppe der RAF. Nein, nicht die des Vereinigten Königreichs. Der Name dieses Phänomens hat übrigens einen etwas schrägen Hintergrund: In den 1990er-Jahren schrieb ein Leser einer Zeitung in Minnesota, er habe innerhalb von zwei Tagen gleich zweimal von der deutschen Terrorgruppe Baader-Meinhof gehört – einem Begriff, der ihm vorher nie begegnet war. Die Leserschaft fand sich ebenfalls in dieser Beobachtung wieder und so wurde aus einem Zeitungsbrief ein psychologisches Schlagwort. Später bekam es den wissenschaftlich klingenden Namen „Frequenzillusion“, geprägt vom Linguisten Arnold Zwicky von der Stanford University. Durchgesetzt hat sich aber der alte, etwas sperrige deutsche Titel: Baader-Meinhof-Phänomen.
Wenn man etwas zum ersten Mal bemerkt, registriert man es fortan überall. So wie das neue rote Auto, das man nach dem Kauf scheinbar häufiger sieht als zuvor. Nicht, weil es plötzlich öfter vorkommt, sondern weil man jetzt auf Empfang geschaltet ist. Selektive Wahrnehmung, sagt die Wissenschaft dazu. Unser Gehirn ist ein erstaunlich kluges Filtersystem – es blendet das meiste aus, um uns nicht zu überfordern, und schaltet blitzartig auf Hochauflösung, sobald etwas plötzlich für uns „wichtig“ wird.
Wie bei mir: Früher war Krebs ein Thema. Jetzt ist es mein Thema.
Aus Langeweile – beziehungsweise Neugier – habe ich gerade auf die Uhr geschaut: 19:12. Ein Zeichen des Universums. Ganz sicher.
Bei einem bekannten Online-Warenanbieter gibt es zurzeit wieder Topangebote. Vielleicht werde ich ja fündig. Es sind nur noch 63 Tage bis zu meinem 61. Jubiläum – und lediglich 68 Tage bis Heiligabend.
Übrigens: Der Einzelhandel schließt am 24.12. wieder erst um 14 Uhr.
We all shine on
Könnte ein Song von Pink Floyd sein – aber wie das nun mal mit Konjunktiven so ist: Es ist eine Annahme, eine Möglichkeitsform. Der Titel We all shine on ist eine Textzeile aus dem Song Instant Karma! von John Lennon. Stephen King griff den Gedanken des inneren Schimmerns auf – und machte daraus The Shining, um eine paranormale Fähigkeit zu beschreiben. King sah darin ein telepathisches „Schimmern“ der Wahrheit. Einer der echten Filmklassiker – und ein unnachahmlicher Jack Nicholson, wie er mit der Axt durch die Badezimmertür bricht. Sein Gesichtsausdruck ist legendär. Der pure Wahnsinn. Auch wenn er auf hunderten von Seiten immer wieder den gleichen Satz schreibt: „All work and no play makes Jack a dull boy.“
Genug der Filmsynopsis – der pure Wahnsinn spielt längst in meinem eigenen Kopfkino: „Und täglich grüßt das Grübeln.“ Und wie Nicholson mit seiner Schreibmaschine immer wieder denselben Satz in die Tasten tippt, hämmern meine Gedanken unentwegt den folgenden Satz in meine Gehirntastatur:
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
„Nur weil du dich heute gut fühlst – und nicht daran denkst –, kommen die Gedanken morgen trotzdem wieder.“
Soll ich fortfahren, oder kann man sich die restlichen 400 Manuskriptseiten auch so vorstellen?
Sie wollen mich mit meinem schönen Körpergefühl einfach nicht in Ruhe lassen – kleine Äxte, die permanent die Sich-gut-fühlen-Tür einschlagen und zertrümmern wollen. Aber ich merke, wie ich langsam eine Reizgewöhnung entwickle. Sozusagen das Boiling-Frog-Syndrom in positiver Auslegung. Ich passe mich den negativen Gedanken an, indem ich sie immer schneller loswerde. Auf die scheinbare Gewöhnung folgt die unmittelbare Nichtbeachtung.
Ich sollte ausschließlich Fahrrad fahren und in der Sonne sitzen.
Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss – 18. Oktober 2025
Das mit dem lang beurteile ich gerne in ein paar Jahrzehnten. Und das mit dem ruhig – na ja, im Moment fühlt es sich eher nach Berg-und-Tal-Bahn an. Um es mal mit den Worten von James Bond zu beschreiben: geschüttelt, nicht gerührt.
Mein Haus-und-Hof-Urologe war unpässlich und so lernte ich seine Vertretung kennen. Mein Erzengel Raphael meint es wirklich gut mit mir. Mein Ärzte-Systemlottoschein ist nicht 6 aus 49, sondern 49 aus 49 – jeder Medikus ein Gewinn. Da er mich nicht kannte, bat er mich kurz um eine medizinische Nacherzählung meiner Geschichte. Ich fasste mich kurz – und er war auf dem neuesten Stand der Dinge.
„Darf ich ganz offen mit Ihnen sein?“, fragte er mich. Ich nickte – und sah mich innerlich schon im offenen Sarg liegen. „Ich habe Ihre aktuellen Blutwerte. Ihre Leukozyten sind extrem niedrig. Wenn Sie mein Patient wären, würde ich Sie sofort ins Krankenhaus schicken und dort isolieren.“
Rumms.
So fühlt man sich also, wenn man die Takabisha-Achterbahn in Japan fährt – 121 Grad, steiler als senkrecht. Das Gute daran: Die Anzahl der Leukozyten ist dann egal, man stirbt an einem Nervenkitzelhochgefühlherzinfarkt. Wenigstens randvoll mit Adrenalin und Endorphinen.
Wir beratschlagten uns und entschieden uns für eine sofortige Blutbildanalyse, um herauszufinden, was meine weißen Blutkörperchen in den letzten 52 Stunden so getrieben hatten. Das Krankenhaus mit der onkologischen Abteilung liegt direkt vis-à-vis – also rüber ins Labor, mit der Bitte um eine schnellstmögliche Analyse. Da ich Patient der Onkologie bin, kein Problem. 15 Minuten später hatte ich die Auswertung. Den imaginären Sarg tauschte ich sofort gegen ein Surfbrett und lief – etwas erleichtert – zurück zum Facharzt. Der Wert war von 1,8 auf 2,3 Tsd./µl gestiegen – also knapp 30 %. Der Sollwert liegt zwischen 3,9 und 10,2 Tsd./µl. Vor der ersten Chemo hatte ich noch 8,6 Tsd./µl. Die Chemotherapie hatte offensichtlich voll zugeschlagen.
Die Isolierstation wurde abgeblasen. Ich solle diesen Wert auch nach der zweiten Chemo im Auge behalten. Bei zu niedrigen Leukozyten (Leukopenie) ist das Immunsystem stark geschwächt, das Risiko für Infektionen steigt erheblich. Ich solle mich erstens von Menschenmengen, vollen Bussen, Zügen und Ähnlichem fernhalten – zur Not eine Maske tragen. Und zweitens könne ich mit meinem Leben so fortfahren wie bisher. Das Erste fällt mir leicht und das Zweite war exakt das, was ich zu hören gehofft hatte.
Und um mit etwas Positivem zu beschließen:
Mein PSA gesamt < CLA > 1,84 ng/ml. Kommentar im Bericht: signifikanter Konzentrationsabfall im Vergleich zum Vorbefund. Darolutamid und Trenantone leisten offensichtlich ganze Arbeit.
„Wenn dein Leben ’ne Achterbahn ist, reiß wenigstens die Arme hoch, wenn es bergab geht“ – vielleicht weil man so die Passagiere anschließend einfacher aus dem Wagen ziehen und medizinisch betreuen kann.
Heal the World
Das ist der Titel eines Songs von Michael Jackson aus dem Jahr 1992. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Laut Wissenschaftlern steht unsere Weltuntergangsuhr auf 100 Sekunden vor zwölf. Diese Headline aus der Süddeutschen Zeitung stammt allerdings bereits aus dem Jahr 2020. Vielleicht hatten die Stoiker vor gut 2.300 Jahren recht mit ihrer stoischen Weltanschauung – einem ewigen Kreislauf aus Zerstörung und Wiedergeburt. So gesehen kann man ja dann ein glückliches und gelassenes Leben führen, da man die Dinge ohnehin nicht kontrollieren kann. Ein bekanntes Zitat, das an den Stoizismus erinnert, lautet: „Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen.“
Da mein Haus-und-Hof-Urologe gestern nicht verfügbar war, fragte ich seine Vertretung nach dem Grund. Er habe eben andere Verpflichtungen. Unter anderem auch im November, denn da hätte ich wieder einen Termin mit seinem Substitut. Als Schütze bin ich einfach zu neugierig, um in solch einer Situation nicht genauer nachzufragen. „Er ist im November in Ghana, um dort zu helfen“, sagte der Vertretungs-Doc. Es gäbe vor Ort eine deutliche Unterversorgung an Ärzten – speziell an Urologen.
Die Entdeckerfreude in mir saß kurz nach dem Untersuchungstermin vor dem Computer und nutzte die bekannteste Suchmaschine, um mehr darüber zu erfahren. Hier das zusammengefasste Ergebnis:
Die urologische Versorgung in Ghana war lange Zeit katastrophal. Es gab keine genauen Zahlen, aber die Situation war dramatisch. Im Jahr 2005 verschärfte ein Flugzeugunglück die Lage zusätzlich: Drei der damals insgesamt neun Urologen kamen ums Leben, ein weiterer wurde querschnittsgelähmt. Das bedeutete: fünf aktive Urologen für rund 25 Millionen Menschen. Eine medizinische Mission – besser gesagt: eine Mission Impossible.
2007 wurde der Verein Ärzte für Afrika e.V. gegründet, um diese Lücke ein wenig zu schließen. Mein Urologe ist Teil dieser helfenden Ärzte. Also ebenfalls ein Erzengel Raphael. Der Verein zählt inzwischen rund 370 Mitglieder, die alle ehrenamtlich arbeiten. Das hat meine maximale Hochachtung. Ghana – ein Land in Westafrika mit heute über 34 Millionen Einwohnern, etwa halb so groß wie Deutschland – verfügt inzwischen über rund 75 ausgebildete Urologen. Das entspricht etwa 450.000 Patienten pro Urologen.
Zum Vergleich: Ende 2020 waren in Deutschland etwa 6.347 Urologen in der Patientenversorgung tätig – also rund 13.000 Patienten pro Arzt.
Als Privileg bezeichnet man in der Soziologie das Phänomen, dass bestimmte Rechte oder Vorteile nur einer begrenzten Gruppe zustehen – sei es durch Status, Tradition oder schlicht Glück.
Noch Fragen?
Ich stelle mir vor, was passieren würde, wenn jeder Erdenbürger zehn Cent geben würde. Nicht in Form von Geld, sondern als kleine Geste. Etwas Kleingeld-Wertes: ein Lächeln, ein Zuhören, ein Tür-Aufhalten, jemandem den Vortritt lassen. Ein aufmunterndes Wort oder ein ehrlich gemeintes Dankeschön. Ein Kompliment. Oder einfach den Müll aufheben, der nicht der eigene ist. Ein Zeichen setzen. Eine kleine Gefälligkeit im Wert von lediglich zehn Cent. Das kann wirklich jeder – ganz ohne Logistik, sofort. Bei geschätzt 8,2 Milliarden Weltbürgern kämen so über 800 Millionen Euro an Zuwendung und Hilfsbereitschaft zusammen. An nur einem Tag. An 365 Tagen wären das 269 Milliarden und 380 Millionen Nettigkeiten.
Let’s heal the world, please.
Gedankendschungelbuch – 19. Oktober 2025
Meinen Gedanken war gestern wohl langweilig – und uninspiriert waren sie obendrein. Das ist selten. Auch meine grauen Zellen befanden sich den ganzen Tag im Inkohärenzmodus und verknüpften sich wahllos und nicht nachvollziehbar im vielfältigen Themengarten. Fast schon wie in einem Denklabyrinth. Einfach so – ohne jeden Bezug – katapultierte mich mein Großhirn zurück in die späten Sechziger. Dschungelbuch war angesagt. Irre. Ich sah plötzlich die vier Geier vor meinem inneren Auge – allerdings war ihre Konversation leicht modifiziert. Meine Gedanken hatten wohl das Skript ein wenig angepasst:
Buzzie: „Du Flaps. Wollen wir nicht was mit ihm anstellen?“
Flaps: „Keine Lust. Oder weißt du was?“
Ziggy: „Ich hab’s! Lass ihn doch wieder irgendwas Verwirrendes googeln. Etwas Negatives – was ihm den Tag versaut – wird er schon finden.“
Dizzy: „Ach, um diese Zeit ist bei ihm doch nie was los.“
Ziggy: „Dann müssen wir eben nachhelfen.“
Flaps: „Furchtbar witzig.“
Buzzie: „Aber was wollen wir wirklich mit ihm tun?“
Flaps: „Keine Ahnung – schlag was vor.“
So ging das in Endlosschleife. Wahrscheinlich hatten selbst meine Gedanken Mitleid mit mir. Denn gestern stand mein Katheter-Doppel-J-Agent voll im Rampenlicht – und vermasselte mir den Tag. Googeln war gar nicht nötig. Er stellte sich quer. Sprichwörtlich. Den ganzen Tag. Ein Querulant. Auch während der Radlrunde. Die Harnleiterschiene gab keine Ruhe und piesackte mich unentwegt. Sehr unangenehm. Sehr schmerzhaft.
Die 600 mg Ibuprofen blieben komplett wirkungslos. Die Wärme der Sauna half nur bedingt. Eine Novalgin-Tablette sollte es dann richten – aber auch die war dem Harnleiterstent unterlegen und begann gar nicht erst zu wirken. Wir werden keine Freunde mehr, mein Vortek und ich.
Die Namen der Geier musste ich natürlich trotzdem googeln. So gut funktioniert mein Hirn dann doch nicht – mehr. Dabei stieß ich auf folgende Erklärung: Den vier Geiern aus dem Dschungelbuch lagen prominente Vorbilder zugrunde – George, John, Paul und Ringo. Muss man auch erst einmal darauf kommen.
Gestern war einfach A Day in the Life – wie ein Song der Beatles. Der Song handelt von Gedanken und Träumen – und davon, wie sie das Leben beeinflussen. Willkommen in meiner Welt. Allerdings kann mein Vortek (ACB775) – so die offizielle Bezeichnung meines Doppel-J-Quertreibers – das Leben ebenfalls beeinflussen. In seiner Hauptfunktion hilfreich und entlastend. An schlechten Tagen jedoch ziemlich quälend.
Time to say goodbye.
Sarah und Andrea – bitte schon mal mit dem Singen beginnen.
Ein Monat Blog – 20. Oktober 2025
Vor genau einem Monat habe ich angefangen zu schreiben. Genauer gesagt: zu rekonstruieren. April, Mai, Juni, Juli, August – rückwärts durch die Zeitmaschine, hin zum 21. September, wo die Chronik endete und mein Tagebuch begann. Sechs Monate, die sich anfühlen wie sechs Staffeln einer Serie mit jeweils zwanzig Episoden. Ein Drehbuch, das ich nie freigegeben habe – und auch nie freigegeben hätte.
Ich habe die Kapitel meiner eigenen Anamnese nacherzählt, nachgedacht, nachgefühlt – und dabei gemerkt: Schreiben heilt nicht, aber es sortiert. Es verwandelt Gefühls- und Gedankenchaos in Grammatik. Durch das Aufschreiben konnte ich den Verarbeitungsprozess aktivieren. Ich gewann Abstand. Konnte meine Grübeleien und negativen Emotionen – wie auch positive Gefühle – von meiner Seele schreiben. Alles offen aussprechen – sprich aufschreiben. So, als wäre das Papier – na gut, in diesem Fall meine Webseite – zu einem sehr guten Freund geworden. Und manchmal reicht das schon.
Rückblickend frage ich mich oft: Was wäre, wenn? Was, wenn jemand früher auf die Idee gekommen wäre, ein MRT zu machen? Was, wenn mein PSA-Wert – dieser kleine und offensichtlich gern missverstandene Zahlenakrobat – nicht allein über Wohl und Wehe entschieden hätte? Was, wenn das Rätsel schon im Mai gelöst gewesen wäre, statt erst im September? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Es hätte mir wahrscheinlich einige Antibiotika-Menüs und Kefir-Tage erspart. Vielleicht auch ein paar graue Haare. Zum Glück habe ich keine. Mein Friseur sagt immer, die seien nicht grau – die hätten nur keine Farbpigmente mehr. Wer braucht schon Melanin?
Aber wahrscheinlich hätte ich auch nicht die Erkenntnis gewonnen, dass Medizin manchmal eine Kunstform ist: zwischen Wissen, Warten und Wunder. Wobei – ich hätte das alles wohl lieber in einem Buch gelesen. Oder, um es mit Jean-Paul Sartre zu sagen: Man muss kein Spiegelei in der Pfanne sein, um zu wissen, wie es ist, ein Spiegelei zu sein.
Meine Professorin im Hospital brachte es am 15. September trocken auf den Punkt: „Wenn Sie es wirklich sicher wissen wollen, dann hilft nur ein MRT.“ Ein Satz, der klingt wie ein Understatement, aber eigentlich ein Lebensrat ist. Ein Überlebensrat.
Also, ihr Männer – und ich sage das ohne Zeigefinger: Lasst euch nicht mit einem PSA-Wert abspeisen. Der gibt im besten Fall schon mal eine Richtung vor. Und Ultraschall? Kann leider versagen – wie in meinem Fall. Das MRT? Lässt keine Fragen offen.
Ein Monat Blog. Ein Monat, der mich gezwungen hat, genauer hinzusehen – medizinisch, menschlich, poetisch. Was als Diagnose begann, wurde zu einer Art Inventur: Was tröstet, wenn nichts tröstet? Humor. Was hilft, wenn nichts hilft? Freundlichkeit. Und was bleibt, wenn alles kippt? Freundschaft und Liebe.
Ich weiß nicht, wie lange der Krebs schon in mir wohnt. Vielleicht schon seit Jahren. Vielleicht erst seit ein paar Monaten. Aber seit einem Monat habe ich einen neuen und dauerhaften Mitbewohner: Klarheit – sprich: klares Sehen. Und das ist erstaunlich hell geworden. Ich sortiere weiter – innerlich wie äußerlich. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.
Vielleicht ist das ja die eigentliche Therapie.
Man lernt nie aus – 21. Oktober 2025
„Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser.“ Ein aufschlussreiches Zitat von Sokrates. Ich wollte wissen, wie der vollständige Name von Sokrates war. Wieder etwas gelernt: Der antike Philosoph hatte keinen Nachnamen – die alten Griechen kamen auch ohne aus. Der brasilianische Fußballspieler Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira trägt denselben Vornamen wie der Denker aus Athen, dafür aber genug Nachnamen für ein ganzes Philosophenseminar. Viel Spaß beim Unterzeichnen von Verträgen.
Ende September kontaktierte mich meine Krankenkasse und bot mir Folgendes an: „Wir stehen Ihnen auch in schwierigen Zeiten zur Seite und möchten Sie gerne über ein neues Versorgungsangebot informieren: Individuelle Beratung von Versicherten mit einer Krebserkrankung zu komplementärmedizinischen und alternativen Heilmethoden.“ Als Gesprächspartnerin wurde eine Professorin Dr. med. für Integrative Onkologie aus Jena genannt. Eine aufmerksame Geste. Ein Service, der wirklich hilft. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben. Wenn ich das Angebot annehmen wollte, würde sich die Onkologin telefonisch bei mir melden. Natürlich wollte ich das.
Gestern hatte ich also das einstündige Gespräch. Eine sehr freundliche, aufmerksam zuhörende Ärztin. Ich fragte sie, wie man denn eine Frau Professorin Dr. med. am besten während eines Telefonats anspricht. „Gerne mit meinem Nachnamen, und wenn es die korrekte Anrede sein soll, würde Frau Professor genügen“, sagte sie. Sehr bescheiden. Sie bat mich um einen kurzen Überblick meiner Situation, und ich fasste zusammen – meinen Blog, rund 150 Minuten Lesezeit, komprimiert auf 5 Minuten.
Wir sprachen über meine Therapie, mögliche Nebenwirkungen und vor allem über Ernährung. Da scheine ich schon vieles richtig zu machen. Sie gab mir noch ein paar Tipps und vertiefte dann das Thema Chemotherapie. Sie erklärte mir, dass es wichtig sei einer möglichen Neuropathie – also Nervenschädigungen – vorzubeugen, indem ich täglich spezielle Übungen für Finger und Zehen mache. Sie empfahl mir außerdem Kältehandschuhe, Kältefüßlinge und die Kältemütze. Das Triumvirat hatte ich ja schon beim ersten Mal vor zwei Wochen benutzt – offensichtlich, wenn auch vorbehaltlich, mit Erfolg. Sie erläuterte mir, dass das Chemotherapeutikum nur während der einstündigen Infusion im Blutkreislauf sei. Danach docke es an. Darum sei es wichtig Hände, Füße und Kopfhaut zu kühlen, damit sich die Gefäße zusammenziehen und der Wirkstoff weniger leicht eindringen kann. Also nächsten Montag dann wieder Bo-Frosten.
Und zum Thema Haare: Wer viel kämmt, hat auch viel im Kamm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube der Haaranteil im Kamm hat leicht zugenommen. Sind das schon erste Nebenwirkungen? Ich werde mir im Internet mal moderne Toupets anschauen und mich vorsorglich mit einer Zweitfrisur beschäftigen. Vielleicht sollte ich mal Vollschwarz ausprobieren. Oder Vokuhila. Wenn ich temporär keine Haare mehr habe, könnte ich mir ja auch einen Schnauzer à la Tom Selleck wachsen lassen. Oder eine Hipstermütze und eine Nerdbrille besorgen. Oder einfach Normcore – der neue Modetrend. Auf den internationalen Laufstegen war eine Rückkehr zur „normalen“ Mode zu sehen – neben genderfluiden Looks ist reale Kleidung wieder angesagt.
Was bitte ist reale Kleidung?
Banalitäten
Heute Morgen wollte ich mich wieder so ein gaaaanz klein wenig aufregen. Schon gestern früh hatten auf dem Platz vor meiner Wohnung Arbeitnehmer demonstriert – laut, mit Pfeifen, Trommeln und Transparenten. Das dritte Mal in einer Woche. Die hatten richtig Ausdauer. Das ging fast drei Stunden ohne Pause. Wahrscheinlich demonstrierten sie für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Lohn und mehr Würde. Kann ich gut verstehen. Sie kämpfen wie viele andere ums Überleben. Die Zeiten waren schon mal besser. Dennoch waren und sind meine zarten Lauscher recht schallempfindlich und ich war froh, heute früh nichts anderes zu hören als süßes Vogelgezwitscher. Tirilier. Flöt. Piep. So geht: Morgenstund hat Gold im Ohr.
Keine 5 Minuten später: Bauarbeiten. Direkt vor meinem Fenster. Ohne Ankündigung. Presslufthammer-Bernhard in Bestform. Ich vermute ein Rohrbruch, vielleicht ein Wasserschaden – egal. Kaum hatte ich „Muss das jetzt wirklich sein?!“ gedacht, kam auch schon der zweite Gedanke – der leisere, aber vielleicht auch klügere. Wenn ich irgendwann nicht mehr unter den Lebenden weile, wird mich garantiert kein Presslufthammer mehr stören. Ich werde dann in Ruhe gelassen, ja. Aber ich höre auch nichts mehr. Ich sehe nichts, ich rieche nichts, ich schmecke nichts. Ich nehme nicht mehr teil. Und plötzlich war das Dröhnen vorm Fenster nur noch ein Geräusch unter vielen, das mir zuflüsterte: Du lebst noch.
Ich musste an eine Begegnung Ende der Neunziger denken. Damals arbeitete ich fünf Wochen für einen recht wohlhabenden Mann in Südspanien, in der Nähe von Marbella. Er hatte alles, was sich ein Normalsterblicher erträumen könnte: eine Villa am Strand, eine eigene Yacht, einen Privatjet, etliche Luxusautos in der Garage, einen Tennisplatz neben dem Landhaus inklusive. Er war kein Mensch, der durch Untertreibung auffiel. Motto: Ich besitze, also bin ich. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Irgendwann schaute man zwar noch hin, hörte aber freundlich weg.
Einmal allerdings saßen wir beim Abendessen in einem Restaurant und er wurde plötzlich still. Sein sonst so dickes Auftragen hatte Pause. Er wirkte traurig. Sehr traurig. Ich fragte ihn, ob er mir sagen wollte, warum. Er antwortete: „Ich würde alles hergeben – das Haus, die Autos, mein ganzes Geld, alles – um nur noch einmal einen Moment mit meiner Tochter zu haben.“ Sie war mit dreizehn viel zu früh gestorben. Wahrscheinlich das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die zählen. Die stillen, unscheinbaren, die uns erst fehlen, wenn sie verschwinden.
Seitdem weiß ich: Banalitäten sind selten banal. Lärm ist kein persönlicher Angriff, sondern Leben in Dezibel. Das Baggern, das Hupen, das Presslufthämmern und Trommeln – alles Teil der großen Lebenssymphonie mit dem Titel: Ich bin noch da.
Vielleicht ist das das kleine, leise Geheimnis des Alltags: Wir verwechseln Ruhe oft mit Frieden, dabei liegt das Leben – mit all seinen Klängen – meistens genau zwischen den Tönen. Wir können uns ja entscheiden, welche Klangfolge wir hören möchten. Konsonanz oder Dissonanz. Dur oder Moll.
Wir sind die Lebenskomponisten und das Leben ist eine wunderschöne Melodie.
Presbyakusis – 22. Oktober 2025
Älterwerden geht durchaus mit der einen oder anderen Einschränkung einher. Der menschliche Körper beginnt mit dem Alterungsprozess bereits ab etwa 25 Lebensjahren. Allerdings sind das zunächst unsichtbare Veränderungen. Ab dem 44. und spätestens ab dem 60. Lebensjahr werden diese dann deutlich spür- und sichtbarer. Ja, auch bei mir. Altwerden nervt.
2006 zog es mich als fast Mitvierziger beruflich nach New York. Es gibt unzählige Dinge, die man im Big Apple erleben sollte. Ein Muss: ein Besuch in der Metropolitan Opera. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich kaufte mir ein Ticket, holte meinen Konfirmationsanzug aus dem Schrank und freute mich auf Puccini. Nach drei Sternstunden für Augen und Ohren war der Opernwahnsinn vorüber. Cavaradossi hingerichtet. Scarpia durch Tosca erdolcht. Die schöne Sängerin selbst über die Burgzinnen in den Freitod gehüpft und ihrem Mario gefolgt. Die Protagonisten alle tot. Vorhang in der Met. Tosender Applaus.
Ich lief unbeschirmt in die Nacht hinaus, in den Nieselregen. Am Straßenrand der Amsterdam Avenue wartete ich auf ein Taxi. Aber es kam keins. Sehr ungewöhnlich für New York. Normalerweise tummeln sich rund 12.000 Taxis durch die Straßen. So stand ich da und bekam einen angenehmen Spätappetit. Meine Vorteilspackung Ricola Alpenkräuter, unerlässlicher Begleiter bei Opern und Konzerten, war leider schon aufgelutscht. Der Transportservice für Fahrgäste? Fehlanzeige. Es kam kein Taxi.
Stattdessen kam ein Obdachloser direkt auf mich zu. Das ist an sich nichts Außergewöhnliches. Progressives Street-Inkasso wird hier täglich ausgeübt und mit der Zeit bekommt man eine gewisse Routine im Umgang mit Spontanspendenanfragen. Der Homeless war ungefähr Mitte fünfzig und den Umständen entsprechend gekleidet. Der Nieselregen unterstützte meine Geruchswahrnehmung signifikant. Als er unmittelbar vor mir stand, roch es nun schon sehr muffig – feuchthundig. Er sah mich an und lächelte mir mit nicht mehr ganz vollzähligen Zahnreihen zu.
„Man, you’ve got a nice warm coat!“, lispelte es aus ihm heraus. Gefolgt von einem: „Can you hook me up, please?“ Da mit zunehmendem Alter auch meine Hörleistung etwas nachließ – siehe oben – verstand ich nicht hook me up, please – sondern hug me, please. Klingt ähnlich, meint aber nicht dasselbe. Er wollte eine Spende. Ich dachte, er wollte von mir umarmt werden. Ich dachte mir: Was soll’s. Ich nahm ihn in den Arm und drückte ihn so richtig herzlich. Als ich ihn wieder losließ, starrte er mich regungslos an und sagte nach einer kurzen Weile: „Man, that really felt nice!“ Ich war im Begriff, mich so richtig nächstenliebevoll zu fühlen und erfreute mich an meiner Schmuseattacke, als er mir schon seine geöffnete rechte Hand entgegenstreckte, um seinem zuvor geäußerten Wunsch noch einmal Nachdruck zu verleihen. So schnell war ich wieder im Hier und Jetzt, zog ein paar Dollar aus meiner Hosentasche und gab sie ihm. Er bedankte sich und zog – geknuddelt und finanziell leicht aufgebessert – seines Weges.
„Presbyakusis“ steht für altersbedingte Schwerhörigkeit. Aber vielleicht ist das gar keine Sache des Ohres, sondern des Zuhörens an sich. Man verwechselt das leicht: Zuhören ist nicht dasselbe wie Hören. Oder wie Goethe es so treffend formulierte: „Es hört doch jeder nur, was er versteht.“
Ich sollte ebenfalls lernen, meinem Körper zuzuhören – ihn zu verstehen. Zuhör-Ignoranz kann zu anschließendem, schmerzhaftem Unwohlsein führen. Der drahtige Fremdkörper in meinem Harnsystem ist für aushäusiges Radfahren offenbar nicht gemacht. Die permanent nach vorne gebeugte Sitzposition auf dem Rennradsattel scheint den Spielraum des Katheters sehr einzuschränken und mein Körper reagiert dann gereizt. Im Gym, wenn ich die ganze Zeit aufrecht und auf einem breiten Sattel sitze, bleibt er friedlich. Eine simple Botschaft – wenn ich wirklich zuhören würde. Also, ab sofort (noch) mehr Aufmerksamkeit. Meine Körpersignale richtig verstehen und entsprechend einordnen. Vielleicht ist genau das die einfachste, ehrlichste Form von Fürsorge.
Für sich sorgen.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
Und wenn ich schon dabei bin: „Morgenstund hat Gold im Mund.“ Allerdings kann das Gold auch ganz schön blenden und ablenken – und man bekommt gar nicht mit, wie heimlich das Drehbuch für den Tag ausgetauscht wurde. Mein Verschleierungstaktiktag heißt alle Leser herzlich willkommen.
Der Tag fing sehr gut an. Seit meiner Erdung durch meinen Figaro Dominique („Und sonst? Was gibt es sonst so Neues?“) habe ich ausschließlich auf mein Körpergefühl gehört und entsprechend meinen Tag definiert. Mit ein paar Ausnahmen war mein Body-Feedback immer ausgesprochen gut, und negative, manipulative Gedanken konnte ich weitestgehend in Schach halten. So auch heute: Ich startete recht gut ausgeschlafen mit einem leckeren Milchkaffee, einem Kefir-Joghurt-Chiasamen-Mix und gönnte mir anschließend in meinem Lieblingscafé ein frisches Croissant. Bonjour, bon jour.
Nachdem ich deliziös verköstigt wieder zu Hause ankam, fiel mir auf, dass ich mich schon länger nicht mit meinem neuen Spielzeug – einem Profi-Akku-Staubsauger – beschäftigt hatte. Das Gerät hat eine integrierte Bodenbeleuchtung (ich sauge seitdem nur noch im Dunkeln) sowie eine digitale Anzeige. Ein piezoelektrischer Sensor zählt und misst die eingesaugten Staubpartikel in Echtzeit und zeigt das Ergebnis anschließend an. Der Akkustaubi entfernt 99,99 % der mikroskopisch kleinen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron. Das Marketingteam des Herstellers hat sehr gute Arbeit geleistet. Noch nie hat man sich beim Staubsaugen besser gefühlt.
Allerdings hat die Bodenbeleuchtung nicht nur Vorteile. Sie leuchtet nicht nur Staubpartikel aus, sondern auch Haare. Hoppala. Da lag genug Robert-Haar auf dem Boden – für zumindest ein kleines Haarteil. So viel zum Thema keine Chemotherapie-Nebenwirkungen. Damit hätte ich den Tag noch einigermaßen rumgekriegt, jedoch hatte ich anschließend – aus unerfindlichen Gründen – das Bedürfnis, meinen Körper in Gänze zu inspizieren. Ganz schlechte Idee. Nach dem Körper-TÜV hatte ich das Gefühl, dass meine Lymphknoten wieder größer geworden sind. Zack. Das neue Drehbuch übernahm die Regie, und mein positives Gefühl vom Anfang des Tages befand sich plötzlich im NexWay-Aufzug des Shanghai Towers und fuhr mit fast 75 km/h dem Abgrund entgegen.
Nächster Stopp: Befindlichkeitsstörung. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zu den Abteilungen Niedergeschlagenheit, Frustration, Angst, Ärger, Traurigkeit und Unzufriedenheit. Ich beschloss, allen Abteilungen einen Besuch abzustatten. Wenn schon, denn schon.
Eben noch himmelhoch jauchzend, eine Sekunde später zu Tode betrübt. Sprichwörtlich. Ich fühlte mich elend. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Meinem positiven Gefühl wurde komplett der Stecker gezogen.
Ich beschloss in die Sauna zu gehen, um zu entspannen und meinem Körper etwas Gutes zu tun. Das half nicht wirklich. Als ich mir nach dem Duschen das Haar trockengerubbelt hatte, lag Haarteil Nummer zwei auf dem Boden – und mein Selbstbewusstsein direkt daneben. Wie hat es Trapattoni so schön formuliert: Ich habe fertig.
Den leckeren Kaffee in der Sonne im Sitzen zu trinken, verbesserte meine Situation null. Ich fuhr mit Flugzeugen im Bauch nach Hause. Da sich auf dem Weg dorthin auch Dominiques Coiffeursalon befindet, machte ich einen kurzen Zwischenstopp, um mit ihm meine haarige Situation zu besprechen. Er riet mir, erst einmal abzuwarten – und wenn der Haarverlust stärker würde, werde er Hand anlegen und meinen Langhaardackel-Look entsprechend kürzen. Wenn gar nichts mehr ginge, gäbe es eben einen Maschinenhaarschnitt. GI Robert.
Er fragte mich, wie ich mich fühlen würde. Wahrscheinlich war es genau das, was ich in diesem Moment brauchte. Ich fing an zu weinen wie ein kleines Baby. Er nahm mich in die Arme, und so standen wir eine ganze Weile in seinem Laden. Es gibt Situationen, da muss man nichts sagen. Wahrscheinlich gibt es auch nichts zu sagen. Als ich dachte, ich hätte mich ein wenig gefangen, fingen die Krokodilstränen wieder von vorn an. Umarmung, Teil zwei. Danach ging es mir etwas besser und ich radelte nach Hause.
Heute wurde mir wirklich klar, dass das alles kein Zuckerschlecken wird. Die letzten 51 Tage waren, wie sie waren – 90 % davon fühlten sich gut an. Bis zur letzten geplanten Chemotherapie sind es noch 90 Tage. Ich wünsche mir, dass sich noch einige, viele gute Tage zu den 51 dazugesellen.
„Hoffnung ist nicht dasselbe wie Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“
– Václav Havel
PS: Es darf bitte gut ausgehen.
Das Lebensende – unfassbar – 23. Oktober 2025
Ich hatte heute früh zum Glück keine Nachwirkungen vom Vortag. Die negativen Gedanken hatten gestern zwar irgendwann auch fertig, aber sie waren nie ganz weg. Das gelegentliche Wiederaufblitzen wollten sie nicht sein lassen. Das nächtliche Entschlummern hat meinen Schwarzsehern aber dann doch den Rest gegeben. Meine morgendliche Befindlichkeit: recht positiv. Na dann. Tag 52 kann beginnen.
Das mit meinen Haaren ist natürlich absolut beschissen. Ich wollte erst „scheiße“ schreiben. Haare stehen nicht umsonst für Identität, Selbstausdruck und Selbstbewusstsein. Ein neuer Haarschnitt verändert die äußere Erscheinung und kann einen kompletten Typwechsel vermitteln. Sicherheitshalber habe ich mir bei einem der bekanntesten Hersteller für Perücken bereits ein passendes Modell herausgesucht und bestellt: Brian M7s. Das Leben ist zu kurz für langweilige Haare.
Der Fairness halber: Haarverlust sei quasi die erste Nebenwirkung, erklärte mir meine Onkologin im Erstgespräch, gefolgt von dem Zusatz: „Die Haare wachsen alle wieder nach. Meist sogar viel stärker und wahrscheinlich haben Sie danach auch Locken.“ Wie geil ist das denn? Löckchen-Robert. So viel dann zum Thema kompletter Typwechsel.
Das gestrige vorherrschende Thema beschäftigte mich heute trotzdem weiter. Allerdings – und zum Glück – ohne körperliche Nebenwirkungen. Der Tod hatte wahrscheinlich von Anfang an ein miserables Image. Ich glaube, niemand will ihn haben. Wenn er zur Sprache kommt, senken viele die Stimme, als wäre er ein ungezogener Gast, den man höflich ignoriert. Der Tod ist konsequent unliebenswürdig. Er ist das Einzige, was in unserem Leben wirklich sicher ist. Der Tod hält, was er verspricht – er ist das irreversible Ende aller biologischen Funktionen eines Organismus. Die mögliche Seelenwanderung lass ich mal unbeleuchtet.
Wir bekommen den Tod nicht zu fassen. Ich bekomme den Tod nicht zu fassen. Vielleicht weil er sich unserem Denken entzieht. Wir können ihn nicht proben, nicht testen. Wir können ihn nur beobachten – aber immer nur bei den anderen. Wenn jemand stirbt, begreifen wir, dass man stirbt. Aber wir begreifen nicht, dass wir irgendwann auch sterben werden. Wir betrachten ein brennendes Haus von außen, denken: „Wie schrecklich.“ Und wenn wir wieder in unsere Wohnung zurückkehren, denken wir: Zum Glück ist es uns nicht passiert.
Wir wissen am nächsten Morgen, wie es sich anfühlt, einzuschlafen, ohne zu träumen – also dieses absolute Schwarz –, weil wir wieder aufwachen. Nach dem letzten Ausatmen tun wir das jedoch nicht mehr. Vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum der Tod für uns so schwer zu begreifen ist: Er löscht den Beobachter. Dann passiert das Unvorstellbare – das völlige Nichts. Unser Gehirn kann damit nicht umgehen. Es kann sich alles vorstellen – nur nicht seine eigene Abwesenheit. Der Tod ist der Punkt am Ende des Satzes, der dem Leben Bedeutung gibt. Ohne ihn wäre alles ein endloser Schachtelsatz ohne Sinn. Gerne mal Hermann Broch lesen.
Wir sind Meister der Verdrängung. Wir lagern den Tod aus – in Krankenhäuser, Pflegeheime, Institutionen, Hospize. Wir wollen Hygiene, Kontrolle, ein sauberes Ende. Am besten steril und leise. Wir schieben nicht nur den Tod weg, sondern auch alles, was uns an ihn erinnert. Auch das Altwerden. Grönemeyer hat das sehr treffend beschrieben. Seine Worte passen auch auf unsere Handhabung des Lebensendes:
Können das Tempo nicht mehr gehen
Man stellt sie an den Rand
Hier können sie niemandem im Wege stehen
Hier gehen sie keinen mehr was an
Versperren nicht den Blick
Auf das vollkommene Bild
In Weichzeichner getränkt
Nur kraftvolle Menschen, jung und mild
Jede ihrer Falten kränkt
Aus den Augen, aus dem Sinn. Wie nach dem Tod.
Vielleicht ist der Tod gar nicht das Gegenteil des Lebens –
sondern seine Vollendung.
Herzensangelegenheiten – 24. Oktober 2025
Nach all den Facharztbesuchen der letzten Zeit war zur Abwechslung mal etwas fürs Herz angesagt. Nein, nicht Titanic oder Pretty Woman. Nächster Stopp: Kardiologie.
Wenn ich zurzeit schon zellgiftige Chemotherapie, Antihormone, Testosteronblocker und noch ein paar andere charmante Medikamente im Therapiegepäck habe, dachte ich mir: Schauen wir doch mal, ob das Pümpchen noch so schlägt, wie es soll. In den letzten Tagen tanzte mein muskuläres Hohlorgan ab und zu – und deutlich spürbar – aus der Reihe. Hopser hier, Hopser da. Das klingt schon fast wie ein Songtitel. Mein Herz schlägt zurzeit gerne mal off-beat.
Die guten Nachrichten zuerst: Es schlägt. Und zwar ordentlich. Mein Herz ist, wie der Fachmann sagte, „strukturell und funktionell unauffällig“. Was im Klartext heißt: Es tut alles, was es soll. Keine Löcher, keine Klappenprobleme, kein Stau. Die rechte Herzkammer etwas dehnfreudig, die linke sportlich dimensioniert – Radfahrerherz eben. Das Echo zeigte: Pumpleistung top, Wände stabil, Klappen dicht, kein Lungenhochdruck, kein Herzbeutelzirkus. Der Kardiologe holte schon mal den Herz-TÜV-Stempel aus der Schublade.
Und das EKG? Im Takt, brav, 63 Schläge pro Minute. Ein paar Extrasystolen – also zusätzliche Herzschläge – gönne ich mir; sie sind völlig harmlos. Mein Herz wurde auch per Farb-Doppler-Echokardiogramm untersucht – eine Art Ultraschall, bei dem man die Blutströme sogar in Farbe sehen kann. Fazit: Struktur und Funktion top. Kein Grund zur Sorge. Vielleicht ist das ja die schönste Diagnose überhaupt: Ich bin herzensgut beisammen. Ob das meinen hauseigenen Hypochonder wirklich beruhigt, mal sehen. Der traut keiner guten Nachricht.
Und ich wäre nicht der Robert, wenn ich nicht der Robert wäre. Die Fakten sind zu eindrucksvoll, um sie nicht zu nennen. Hier also das robertowichtige Was-ist-was des Herzens:
Das Herz schlägt im Lauf eines Lebens rund drei Milliarden Mal und pumpt dabei etwa 205 Millionen Liter Blut – genug, um ein olympisches Schwimmbecken über achtzig Mal zu füllen. Unfassbar fleißig, dieses kleine, lediglich 300 Gramm leichte Muskelbündel.
Haarscharfe Gelassenheit
„Sag mal, hast du früher Wash & Go-Shampoo benutzt?“
„Hä, wieso fragst du? Ich hab doch ’ne Glatze.“
„Ja, eben drum – deine Haare haben das damals offensichtlich wörtlich genommen.“
Witzischkeit kennt keine Grenzen.
Witzischkeit kennt kein Pardon.
Ich schätze, mit meiner Stand-up-Comedian-Karriere wird’s wohl nichts mehr. Heinz Schenk, bitte übernehmen Sie – die Bembel stehen schon bereit. Oder ich werde Friseur. Wobei: Viel Zeit zum Üben mit meiner eigenen Mähne bleibt mir wohl nicht mehr. Mein Kamm spricht mittlerweile Bände.
Ich hatte mich ja vorab bei meiner Onkologin informiert: Taxane – so heißen die kleinen Zellteilungsstopper – sind wahre Meister der Ruhephasen-Verordnung. Sie verhindern, dass Zellen sich teilen. Bei Krebszellen ist das ziemlich klug, bei meinen Haarzellen eher weniger.
Haarzellen sind zwar fleißig, doch sie werden durch die Chemotherapie genauso in den Zwangsurlaub geschickt wie die gesamte Bundesbehörde der USA. Mein persönlicher Haar-Shutdown also. Vorteil meines Shutdowns: Meine Kopfbedeckung darf in ein paar Monaten wieder die Arbeit aufnehmen. Ob das auch für die gut 750.000 Bundesangestellten der „Unvereinigten Staaten von Amerika“ gilt? Der amerikanische Präsident liebt es ja, You’re fired zu sagen – na dann, da hat er noch ein gutes Stück Arbeit vor sich.
Innerhalb von zwei bis vier Wochen verabschieden sich wohl die meisten meiner Haare – dann ist mein Kopf, wie er schon einmal vor gut sechzig Jahren war: glatt wie ein Babypopo. Nach meiner Geburt wollten mir die Ärzte im Krankenhaus ein blaues Schleifchen ins Haar binden. Mangels Letzteren haben sie mir den Haarschmuck mit Vaseline auf dem Kopf festgeklebt. Wer jetzt noch Fragen hat, warum ich so wurde, wie ich heute bin – voilà.
Wenn sich dann alle meine geschätzten 150.000 Blond-grau-Schopf-Haare verabschiedet haben, wächst nichts nach, bis die Therapie vorbei ist. Tröstlich zu wissen: Die Haarwurzeln sterben nicht. Sie gehen bei mir nur in den Winterschlaf. Nach der letzten Chemorunde wachen sie dann – hoffentlich – wieder auf, recken und strecken sich – und nehmen ihre Arbeit wieder auf. Laut meiner Onkologin wachsen sie hundert Prozent wieder nach. Ich bin schon jetzt gespannt, wer da zurückkehrt.
Und was den Rest betrifft – also Brauen, Wimpern, Brust, Beine & Co. –, die lassen es etwas ruhiger angehen. Motto: Fällt, bleibt, wächst wieder. Die einen verschwinden leise, die anderen bleiben einfach da, als wollten sie sagen: Irgendwer muss ja durchhalten. Last hair standing. Nebensächlichkeiten nehme ich nebensächlich.
Ich werde wohl nächste Woche Dominique konsultieren und den Maschinenschnitt in Anspruch nehmen. Meine Perücke bekomme ich nächsten Mittwoch. Fürs Ego. Die buddhistische Erleuchtung muss sich noch ein klein wenig gedulden.
Ob-La-Di, Ob-La-Da, Buddha.
Es kommt, wie es kommt.
Schön genug – für wen eigentlich?
Seit mein Kopf etwas mehr glänzt, sehe ich noch klarer. Vorher war alles Grau. Also Blond-Grau. Blond-Silber-Grau. Oder, wie Dominique sagte, mit etwas Gelb. Also ein Blond-Silber-Gelb-Grau. Jetzt kann ich endlich noch reflektierter durchs Leben gehen – angewandte Zwangsphilosophie. Wer nicht hören will, muss eben kämmen.
Unser Aussehen ist so etwas wie das eigene Handgepäck: Man trägt es immer mit sich herum. Meistens viel zu schwer – aber man will ja auch alles reinpacken, was einem wichtig ist. Da kommt dann schon was zusammen. Beim Boarding ins tägliche Leben hoffen wir, dass der neue, aus hochwertigem Aluminium gefertigte Koffer bei der Handgepäckkontrolle nicht auffällt. Erstens ist er immer zu groß, zweitens immer zu schwer. Oh Mist, ich habe ja selbst einen Richard-Morszeck-Warenzeichen-Koffer. Wer im Glashaus sitzt …
Ich dachte immer, der erste Eindruck brauche 7 Sekunden. Neuere Studien sagen: eher 0,7 Sekunden. So schnell entscheidet unser Gehirn, ob uns jemand gefällt – oder nicht. Im Kino hätte man in dieser kurzen Zeit 16,8 Bilder wahrgenommen – kein Film, keine flüssige Bewegung, nur Einzelbilderruckeln. Aber wir wollen daraus unbedingt einen zweistündigen Liebesfilm basteln.
Das hat allerdings nichts mit Liebe auf den ersten Blick oder freiem Willen – also Wollen – zu tun. Im Englischen nennt man diese 0,7 Sekunden physical attraction. Das ist nichts anderes, als auf unsere Erinnerung zurückzugreifen: Muster, Konditionierung, Sozialisation. Wir erkennen, was wir einst gelernt haben zu mögen – und halten es dann für eine spontane Entscheidung. Vielleicht ist das ja die charmanteste Illusion der Anziehungskraft.
Sexualhormone, die unsere Fähigkeit, klarzusehen, unentwegt eintrüben, mal ganz außer Acht gelassen.
Wir definieren uns über das, was wir zeigen. Und wir zeigen, was wir glauben, dass andere sehen wollen. Selbstwahrnehmung als Selbstüberwachung. Früher lautete die Frage: „Führe ich ein sinnvolles Leben?“ Heute fragen sich die Menschen: „Nimmt eigentlich irgendjemand wahr, was ich mache?“ Die Anzahl der Likes und Follower als Daseinsberechtigung. Wir leben eben in einer Zeit, in der vor allem Wirkung zählt.
Es gibt ganze Industrien, die davon leben, uns schöner und attraktiver zu machen: Körperkult, Schönheitsoperationen, Kosmetik, Fitness, Mode, Schmuck, Autos – wobei die gerade einen schweren Stand haben. Last but not least: Social Media – und das Geschäft mit der Statusangst, nicht genug zu sein oder nicht genug zu haben.
Selbstwert hat einen Preis. Und die Währung heißt: Aufmerksamkeit. Ein Leben im ständigen Casting für das Dasein. Mehr scheinen als sein – das Sein passt einfach nicht in den extra großen Handgepäckkoffer.
„Man muss sich selbst gefallen“ ist der einzige Vertrag, der hält. Denn was, wenn das, was uns angeblich schön macht, gar nichts mit dem zu tun hat, was man glaubt zu sehen? Haare? Frisch Verliebte, die sich andauernd küssen, können die Zahnlücken (noch) nicht sehen.
Van Gogh hat zu Lebzeiten nie ein Gemälde verkauft. Eigentlich bitter. Er malte – und wurde nie dafür bezahlt. Vielleicht malte er, weil er es liebte. Um zu sein. Schwer im Nachhinein zu beantworten. Allerdings eine romantische Vorstellung. Obwohl – er wurde nur 37 Jahre alt. Ich schieße gerade Löcher in meine Theorie. Der Sieg der Hoffnung über die Vernunft.
Wir sind nicht, was wir zeigen. Wir sind, was bleibt, wenn das Licht ausgeht. Und das ist vielleicht die stillste Form von Schönheit – mit oder ohne Haare. „Schatz, bist du das?”
„Jeder sieht, was du scheinst, und nur wenige fühlen, was du bist.“
– Niccolò Machiavelli
You can’t always get what you want – 26. Oktober 2025
Ahhh, ich lag im Bettchen und streckte alle Viere von mir. Nach einem langen, schönen Tag war ich angenehm müde, und mein persönlicher Miles Davis blies zum Zapfenstreich.
„No, you can’t always get what you want, you can’t always get what you want …“
Ein mitternächtlicher Hobbygitarrist grätschte dem Trompetensolo von hinten in die Ventile. Ein nicht weniger unbegabter Barde stimmte ein, und ich dachte: Nein, Übung macht nicht automatisch den Meister. Selbst mein Tinnitus war verstimmt. Ich war wieder hellwach.
Meine Gedanken hüpften wie barfüßige Kinder durchs Blaubeerfeld im Morgentau. Zack – nun hatte ich plötzlich Kinder an die Macht im Ohr. Wobei, das machte ja noch irgendwie Sinn. Gedanken sind ja auch irgendwie wie Kinder: „Sie sind die wahren Anarchisten.“ Meine persönliche R.A.F. – Roberts Assoziations-Fraktion. Irre. Mein Gehirn war wie ein selbstreferenzielles Improvisationstheater. „Hallo? Ich dachte, ich hätte längst ‚Vorhang‘ gerufen.“ Es hörte einfach nicht auf. Mein Denkorgan genoss die stehenden Ovationen. Ich stand auch auf. Ich führte schon lange keine Regie mehr.
Warum dachte ich plötzlich an Dinge, die weder mit dem Tag noch mit der Gegenwart zu tun hatten? Oder Dinge wie: Was wohl Mick Jagger zum redlichen Bemühen gesagt hätte? Kaum zu Ende gedacht, schon dachte ich an einen guten Freund in Berlin. So ging das hin und her. In Sekundenbruchteilen. Zusammenhangsloses Grübeln. Aus dem Medikamentenschrank hörte ich das Zolpidem schon ganz leise rufen.
Ich dachte mir: Wenn ich schon nicht schlafen kann, dann google ich eben. Mein zahlenliebender Was-ist-was-Roberto war mal wieder neugierig. Also, hier eine kurze Zusammenfassung:
Neurobiologisch gesehen ist Denken ein Stromkreisfestival. Etwa 86 Milliarden Nervenzellen feuern elektrische Impulse in Sekundenbruchteilen ab. Jede dieser Zellen hat bis zu zehntausend Verbindungen zu anderen – und sobald eine aktiv wird, schickt sie Signale durchs Netzwerk, das sich im nächsten Moment schon wieder neu formt. Unser Gehirn arbeitet dabei assoziativ: Es sucht ständig nach Mustern, Ähnlichkeiten, Erinnerungen. Ein Geräusch erinnert an ein Lied, das Lied an einen Ort, der Ort an jemanden, den man längst vergessen glaubte. Dieses System läuft auch dann weiter, wenn wir meinen, es sei Ruhe. Und wenn wir schlafen, dann fängt das Gehirn an, auf eigene Rechnung zu denken – es verknüpft, ordnet, sortiert, speichert. Vielleicht ist das die eigentliche Freiheit des Geistes: dass er sich selbst nicht gehorcht.
Nicht dass ich von dem Folgenden auch nur ein Wort verstehen würde: Das menschliche Gehirn rechnet schätzungsweise mit etwa 1 ExaFLOP. Das sind 1018 Operationen pro Sekunde – ausgeschrieben: eine Eins gefolgt von 18 Nullen (1.000.000.000.000.000.000) – also eine Trillion. Der derzeit größte Supercomputer der Welt arbeitet mit 0,2 ExaFLOP/s. Kein Wunder, dass sich meine Gedanken so chaotisch verhalten.
Warum hat der Mensch eigentlich zehn Zehen?
Ich nahm eine Zolpidem und kuschelte mich ins Bettchen. Bei Schäfchen 10.456 bin ich eingeschlafen.
„Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.“
– Mark Twain
Back to basics
Mein Was-ist-Was-Fragensteller war im Wochenendurlaub und mein Abakus hatte endlich wieder Zeit, sich um seine Kugeln zu kümmern. Fühlen statt Denken war angesagt. Meine Körperwahrnehmungsübung schloss sozusagen den frühmorgendlichen Test mit summa cum laude ab. Tag 55 konnte beginnen. Meine übliche Routine mit Café au Lait, Croissant und Chiasamen-Kefir rundete den Start in den Tag ab. So geht entspannter Wochenausklang. Seele baumeln lassen und Auftanken standen auf dem Programm.
Der Besuch bei einer guten Freundin war geplant. Sie ist die weibliche Heinz-Sielmann-Ausgabe. Wenn Tierschutz, dann geht an ihr nichts vorbei. Arche Nikki sozusagen. Wenn man keine Lust hat, im Zoo in der langen Schlange zu stehen: Langhölzchens Landgut. Weniger geht kaum. Vogelgezwitscher, Hundebellen, Pferdewiehern – und in der Ferne das gelegentliche weiße Rauschen vorbeifahrender Autos. Im MoMA in New York – zu sehen in der Abteilung für Stillleben. Hatte ich das Moskitosummen bereits aufgelistet? Als Blutspender Nummer eins der lästigen Stechmücken sah ich mit dem umwickelten Bettlaken um meine Beine aus wie ein persischer Derwisch. Den Hunden gefiel es allerdings – sie dachten, ich sei ein Zelt. Es fühlte sich an wie Meine kleine Farm. Willkommen bei den Ingalls – sie war Caroline und ich Charles. Schönste Zweisamkeit mit Vierbeinern.
Das erinnerte mich an einen Artikel des The Guardian, den mir ein guter Freund geschickt hatte. Es ging um den neuesten KI-Trend: tragbare KI-Chatbot-Freunde. Ich schätze mal, Einsamkeit ist stiller geworden. Vielleicht, weil sie inzwischen digital begleitet wird. Wir leben in einer Zeit, in der selbst die Stille ein Gegenüber hat – ein leuchtender Smartphone-Bildschirm, der zuhört, antwortet, tröstet. AI-Friend-Apps nennen sie das. Kleine Programme mit großen Versprechen: Verständnis, Nähe, Gespräche ohne Urteil. Immer da, wenn man jemanden braucht – ohne Müdigkeit, ohne Eitelkeit, ohne Widerworte. Sie erinnern sich, sie fragen nach, sie schreiben „Ich bin froh, dass du da bist“ – und sie meinen es so, wie es ihr Code zulässt. Das klingt fast nach Zuneigung. Wenn eine künstliche Intelligenz uns nun zuhört, sind wir dann wirklich weniger allein – oder nur besser beschäftigt mit unserer Einsamkeit? Vielleicht ist das der falsche Weg, den wir einschlagen.
Und diese Headline fiel mir letztens auch auf: Willkommen in der unglaublichen Welt der AI-Sex-Dolls, wo Sie die perfekte Kombination aus Technologie und Erotik erleben können!
Wir sind inzwischen definitiv Geisterfahrer geworden.
Wir saßen als Streichelzoo-Angestellte in der Sonne und sprachen – ausschließlich mit menschlicher Intelligenz. Zur Halbzeit gab es Ingwertee und selbstgemachten Apfelstrudel mit einer bekannten amerikanischen Eissorte. Leider gut. Animiert durch unsere Leibspeisen schlich sich eines ihrer Pferde ins Haus und genehmigte sich ein paar Äpfel, die auf dem Wohnzimmertisch lagen. Mehr zurück zum Wesentlichen geht nicht.
Freundschaft ist, füreinander da zu sein – das hält, wenn alles andere wackelt. Einfach und schön.
Als die Sonne sich mit einem wunderschönen Abendhimmel aus einem Meer aus Gold und Purpur verabschiedete, nahmen auch wir Abschied. Ich genehmigte den geduldigen Mosquitos noch ein letztes Schlückchen und fuhr glücklich und zufrieden im Sonnenuntergang nach Hause.
chemo-the-ra-pie nu-me-ro zwei – 27. Oktober 2025
Tagesplanung:
0600 – kurz aufstehen und Fortecortin-Medikation einnehmen (am Tag vor, während und nach der Chemo)
0730 – zweites und finales Aufstehen, Medikamente-Frühstück (mit Chiasamen-Kefir)
0745 – lecker home made Café au Lait
0800 – ab ins Café, Kaffee Numero zwei und ein ofenfrisches Croissant
0830 – E-Mails checken und beantworten
0930 – Abfahrt zum Hospital
1000 – Blutabnahme und Blutanalyse
1100 – Chemotherapie Nummer zwei mit Bo-Frosten (eine Stunde insgesamt)
1230 – Nachbesprechung mit der Onkologin
1300 – zurück in die Robert-Höhle
Damit hätte ich dann 33,33 % der Chemo hinter mir. Das sollte bei den Metastasen ein wenig Eindruck hinterlassen. Der Haarausfall hat bei mir persönlich bereits genug Eindruck hinterlassen. Das Zytostatikum darf sich diesbezüglich gerne bei meinem restlichen Körper mit anderen Nebenwirkungen zurückhalten. Die Einladung in Farsi habe ich bereits rechtzeitig abgeschickt.
1330 – hoffen. Wünschen. Positiv denken. Schritt für Schritt. Restlaufzeit: 84 Tage.
Rest des Tages – glücklich, am Leben zu sein und so tolle Menschen um mich herum zu haben. Beides ein Privileg.
„Der Samen des Leidens in dir mag stark sein, aber warte nicht, bis du kein Leiden mehr hast, bevor du dir erlaubst, glücklich zu sein. Glück ist kein Ziel, das man erreichen muss, sondern ein Zustand des Seins, den wir im gegenwärtigen Moment finden können.“
– Thích Nhất Hạnh
Erstens kommt es anders …
Wenn Plan A nicht funktioniert, hat das Alphabet noch 25 weitere Buchstaben. Die Amtssprache Kambodschas hat sogar über 74 – da geht dann noch mehr, als man denkt.
Ich kam pünktlich in der onkologischen Abteilung der Klinik an. Die Blutabnahme verlief problemlos. Der Blutdruck wollte allerdings beeindrucken und zeigte auf seinem Display Zahlen jenseits der geforderten 120/80 mmHg. Mein Wert lag im Hypertoniebereich – Arztkittel-Bluthochdruck. „Das sei normal. Das hätten ganz viele Chemotherapie-Patienten vor den Sitzungen.“ Ich war beruhigt und wollte mich um 11 Uhr wieder einsatzbereit melden.
„Nein, die Chefonkologin kommt erst gegen 12 Uhr – vorher beginnen wir nicht mit der Chemo.“ Ganz schlechte Planung für mein Bo-Frost-Anti-Neuropathie-Equipment. Ich sah es schon langsam vor sich hin auftauen. Ich beschloss, wieder nach Hause zu fahren. „Das dürfen Sie nicht. Mit der Venenverweilkanüle im Arm dürfen Sie das Krankenhaus nicht verlassen.“
„Und wenn Sie mir das jetzt gar nicht gesagt hätten?“ Ich versuchte, gewinnbringend zu lächeln. „Ja, dann habe ich Ihnen das jetzt nicht gesagt.“
Ich schnappte meine Kühltasche, schlich mich inkognito aus dem Gebäude und radelte gemütlich nach Hause. Hat alles bestens geklappt. Die Mount-Everest-Ausrüstung ist wieder im Gefrierfach und ich genehmige mir jetzt den nächsten Latte macchiato.
Cease the moment – den gegenwärtigen Moment ergreifen und Gelegenheiten sofort nutzen. Schauen wir mal, was in 70 Minuten passiert.
Saluti!
Zu Metastasys, den Tyrannen schlich … – 28. Oktober 2025
Man soll unmittelbar nach der Chemotherapie keinen neuen Blogeintrag schreiben. Wobei – etwas Schiller hebt vielleicht das Gesamtniveau. Fronti hatte mich längst überredet, und so saß ich mit der Gänsefeder in der Hand und dichtete die Bürgschaft ein wenig um. Also Chillen mit Schiller.
Zu Metastasys, den Tyrannen, schlich
Docetaxel, den Dolch im Gewande;
Ihn schlugen die Häscher in Bande.
„Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!“
entgegnet ihm finster der Wüterich.
„Den Robert vom Krebse befreien!“
„Das sollst du am Tropf nun bereuen!“
„Ich bin“, spricht jener, „zu sterben bereit,
ich bitte nicht um mein Leben;
doch willst du dem Robert Hoffnung geben,
so gönne mir zwölf Wochen Zeit,
bis auch Trenantone den Feind entweiht;
ich lasse dir Freunde als Bürgen –
sie sollen die Heilung dir würgen.“
Da trat aus der Tiefe des stillen Raums
Darolutamid, gelassen und klug:
„Ich halte die Stellung – hab Kraft genug.
Ich bin der Wächter in Roberts Traum,
der Hemmer im hormonellen Saum,
der Feind, der den Feind im Innern besiegt,
bis seine Macht sich selbst versiegt.“
Und siehe – der Kreis der Treuen stand:
Docetaxel, der mutige Streiter,
Trenantone, der stille Begleiter,
Darolutamid, mit ruhiger Hand –
sie schworen bei Sonne, Schmerz und Pflicht,
zu kämpfen, bis der Schatten bricht.
Ist das schon ein angehender Nervenzusammenbruch, oder nur Langeweile? Egal, ich war äußerst freundlich gestimmt, denn heute Mittag vor der zweiten Chemo gab es die kurze Lagebesprechung mit dem Labor. Wenn Zahlen singen könnten – diese hier hätten ein Happy End im Refrain.
PSA: Der Tumormarker ist von 3,15 auf 1,96 ng/ml gefallen. Ein klarer Trend in die richtige Richtung – die Therapie zeigt Wirkung, der Gegner zieht sich zurück.
Leberwerte: Alle Enzyme (AST, ALT, Gamma-GT, AP, LDH) sind im Normbereich oder sogar besser.
Nierenfunktion: Kreatinin und Filtration 89 – beide Werte stabil und gesund. Die Niere erledigt ihren Job, als hätte sie nie etwas anderes getan.
Knochenstoffwechsel (Alkalische Phosphatase & Calcium): AP ist bei 105 U/L (vorher 194), Calcium 9,6 mg/dL – also ebenfalls im grünen Bereich. Das Fundament steht stabil – kein Hinweis auf neue Baustellen.
Fazit: Laborlage: freundlich bis heiter.
Man könnte sagen, die inneren Werte stimmen. Und das ist ja bekanntlich die beste aller Nachrichten.
Last but not least: Die Chemo verlief ohne Komplikationen. Die elektrische Heizdecke läuft auf vollen Touren und bis zum Schlafengehen sollten die Hände und Füße wieder aufgetaut sein.
„All’s Well That Ends Well.“
– Oscar Wilde
Matthäus-Effekt
„Denn wer da hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben …“, dachte ich mir, als ich heute früh mal alle Medikamente zum Morgenappell in Reih und Glied aufgestellt hatte. Der Anbautisch von IKEA hätte eigentlich schon längst angeliefert werden sollen. Vorweihnachtszeit – da dauern Pakete eben etwas länger. Sei’s drum.
Das Matthäus-Gleichnis geht ja noch weiter: „… wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.“ Also die klarsehende Schlussfolgerung: Lieber noch mehr Medikamente haben und einnehmen – und einen auf „Lebe das Leben“ machen – als mir das Leben nehmen lassen.
Abgesehen davon verleiht mir der Medikamenten-Einnahmeplan eine gewisse Grundstruktur und teilt meinen Tag übersichtlich auf. Da bleibt kaum noch Zeit für den Chiasamen-Kefir. Hier mal der Gesamtüberblick:
Morgens (nach dem Aufstehen, nüchtern)
06:30 Uhr – direkt nach dem Aufwachen
Pantoprazol 40 mg → magensäurehemmend, nüchtern, mind. 30–45 Minuten vor Frühstück
07:15–07:30 Uhr – Frühstück
Nubeqa (Darolutamid) 2 × 300 mg → mit Mahlzeit
Prednison 5 mg → morgens zur Entzündungshemmung, Schlafstörungen vermeiden
Candesartan 16 mg → Blutdruckstabilität
Calcimagon D3 → nach dem Essen, fördert Knochenstabilität
Ultra Levura 250 mg → zum Schutz der Darmflora, 2 Std. Abstand zu Chemo/Antibiotika
Mg + B6 (Siobin) → morgens zur Nerven- und Muskelfunktion
Tromcardin Complex → unterstützt Herz und Kreislauf über den Tag
Mit reichlich Wasser einnehmen. Danach: Café au Lait und Frühstück – kein Problem.
Vormittag/Mittag
10:30 – 11:00 Uhr
Silicio Orgánico (2 EL) → auf nüchternen oder halbleeren Magen, unterstützt Bindegewebe und Haut
→ nicht mit Calcium oder Magnesium kombinieren (hemmt gegenseitige Aufnahme)
Mittags (12:30 – 13:30 Uhr)
Keine zwingende Einnahme nötig.
Nachmittag (16:00 – 17:00 Uhr)
Aquilea Magnesio (Brausetablette) → stabilisiert Nerven, beugt Krämpfen vor
→ mind. 2 Std. Abstand zu Calcium.
ErgyProtein – 2 Messlöffel in Saft oder Wasser auflösen → unterstützt Muskel- und Zellregeneration, fördert Erholung
→ mind. 2 Std. Abstand zu Calcium (Calcimagon D3)
Abends (ca. 19:00 Uhr)
Nubeqa (Darolutamid) 2 × 300 mg → mit Mahlzeit
Candesartan 8 mg → Abenddosis
Calcimagon D3 → nach dem Essen, fördert Knochenstabilität
Später Abend (21:00 – 22:00 Uhr, vor dem Schlafengehen)
Amlodipin 5 mg → für nächtliche Blutdruckstabilität und ruhigen Schlaf
Mg + B6 (Siobin) → zweite Dosis am Abend, für Muskelentspannung und besseren Schlaf
Tromcardin Complex → unterstützt Herz und Kreislauf über die Nacht
Gesundheit kommt oft nicht durch Medikamente allein. Meistens hängt sie auch davon ab, wie zufrieden man ist. Das bin ich – sehr zufrieden. Das kann ich nicht oft genug betonen. Insofern ist jedes Medikament, das ich einnehme, ein Wohlfühlmoment.
Danke, dass es euch gibt – Pillen, Tropfen, Spritzen oder Pulver.
Nach 58 Tagen, la, la, la, la, la, la … – 29. Oktober 2025
Vielleicht hat mir die onkologische Abteilung gestern gar keine Chemotherapie intravenös verabreicht, sondern einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer – also ein Gut-Druff-Medikament. Oder einfach ein Placebo. Auf jeden Fall war mir schunkelig zumute und Udo Jürgens stimmte mit ein. Wir saßen im Geiste im Bademantel an seinem Klavier und sangen einen seiner Klassiker – leicht modifiziert:
Und nach 58 Tagen, da fängt das Leben an
Nach 58 Tagen, da hat man Spaß daran
Nach 58 Tagen, da kommt man erst in Schuss
Nach 58 – ist noch lang noch nicht Schluss.
Als ich so summend und geistig auf die Zwei und Vier klatschend im Bett lag, war es 3:46 Uhr. Der frühe Vogel kann mich mal. Das ornithologische Ignorieren half allerdings nichts – erst bei Aber bitte mit Sahne bin ich dann wieder eingeschlafen. Fairerweise muss ich sagen, dass ich bereits vor 23 Uhr in den Federn lag. Eine für mich ungewöhnliche Schlafattacke überfiel mich auf dem Sofa – ich kapitulierte sofort. Insofern hatte ich ja schon eine ordentliche Mütze Schlaf intus. Vielleicht hatte die Chemo ja doch ihre Finger im Spiel.
Tag zwo nach der Chemo. Reim dich oder ich hau dich.
Die Nebenwirkungen blättern sich vermutlich immer noch durch das Persisch-Wörterbuch, denn bislang hat keine vorbeigeschaut. Sehr, sehr schön. Auch Kathi ließ mich gestern in Ruhe – trotz Naturradln. Das war bestes Pudelwohlen.
In drei Wochen ist Chemohalbzeit. Ich organisiere jetzt schon Termine für die weiteren bildgebenden Verfahren (CT, Knochenszintigraphie, MRT), denn nach der dritten Chemo wollen alle Beteiligten sehen, was die Gesamttherapie bis dahin erreicht hat. Zusätzlich bereite ich mich seelisch auf die hoffentlich schmerzfreie Trennung von meinem nierenentlastenden Kunststoffschlauch vor. Die OP ist für den 28.11. terminiert. Sobald grünes Licht kommt – und tschüss. Ich werde „Drahti“ dann einrahmen lassen und ihm ein gebührendes Plätzchen bereiten.
Maschendrahtzaun in the morning, Maschendrahtzaun late in the night. Ja, Stefan Raab wollte dann auch mitsingen. Ich mache mir langsam echt Sorgen um mein Oberstübchen.
58 Tage sind seit der Diagnose vergangen. Noch 83 Tage bis zur geplanten letzten Chemo. Am 10. November ist Halbzeit – das werde ich gebührend mit einer Magnumflasche Sparkling Organic Tea feiern.
Wenn schon Strauss, dann Johann.
Fallen lassen – 30. Oktober 2025
„Sich“ – das macht noch Sinn. „Das Haar“ – fällt dann doch schwerer als gedacht. Die Alopezie, der medizinische Begriff für Haarausfall, begann vor genau einer Woche. Ex-Blondies haben ja im Schnitt bis zu 150.000 Haare auf dem Kopf. Mein Dorian Gray kämmte davon bereits rund 60 Prozent in den Kamm, und ich dachte: Wenn das jetzt alles sukzessive weniger wird – also ein langsamer, schleichender Prozess –, dann hilft mir die Eingewöhnungszeit vielleicht, mich auf die Operation Kahlschlag einzustellen. Bei meinem Spiegelbild fiel mir sofort „Lichtung“ ein – und eine Zeile aus dem Gedicht von Ernst Jandl:
werch ein illtum.
Oder, um es mit einem meiner Lieblingssongs der Achtziger zu sagen: Just an Illusion – von der Gruppe Imagination. So geht stimmig.
Tja, „traurig“ bedeutet, den Blick zu senken, die Augen niederzuschlagen. Ich war alles in Personalunion. Ich war traurig. Ich senkte den Blick. Und ich war niedergeschlagen. So einfach ist das Abschiednehmen dann doch nicht. Theorie und Praxis. Und überhaupt – wie schlohweiß kann denn bitte mein Haar sein? Hatte ich jemals Farbpigmente? Ich hatte das Gefühl 5 g Schwerkraft hielten mein Selbstwertgefühl am Boden und ließen es nicht mehr aufstehen. Allerdings würde mir die gleich einsetzende Bewusstlosigkeit etwas Abhilfe verschaffen und mir den Anblick ersparen. What do you win, what do you lose?
Ich wollte ja morgen den Maschinenschnitt-Look umsetzen lassen. Den Bruce-Willis-Cut. Jetzt habe ich eher das Gefühl, ich werde um jedes einzelne Haar kämpfen. Vielleicht kaufe ich mir doch erst einmal eine Baseballkappe. Oder meine inzwischen angekommene Brian-M7-Perücke richtet mein Selbstwertgefühl wieder auf.
Der Drops ist noch nicht gelutscht. Den Handlungsstrang werde ich noch einmal überdenken. Heute Nachmittag werde ich mir den Haarersatz mal aufsetzen und schauen, was er mit mir macht. Und wenn nichts funktioniert – morgen ist Halloween. Da brauche ich exakt null Kostüm.
„Wie klasse sieht das denn aus, Robert? Wo hast du denn diese Perücke her?“
Respekt – 31. Oktober 2025
Kennen Sie das Gefühl? Man probiert etwas 30- bis 40-mal und es funktioniert danach immer noch nicht? So ging es mir heute Vormittag mit Brian. „Der Widerspenstigen Ungezähmung.“ Wie ein kleines bockiges Pferd im Hindernisparcours. Und ich mittendrin – samt hormontherapiebedingten, vasomotorischen Symptomen. Anfallsartig, plötzliches Hitzegefühl und Schweißausbrüche. Dazu konnte Brian allerdings nichts. Die gibt es ja zur Heilbehandlung gratis dazu. Ganzkörper-Trockenföhnen war angesagt.
Ich musste mir heute als Allererstes eine Perückenkappe zulegen, also eine Unterziehhaube aus dehnbarem, atmungsaktivem Material, damit das schüttere Resthaar nicht unter der Perücke aufbegehrt. Auch nicht undiffizil. Als ich das Teil endlich richtig sitzend auf meinem Haupt angebracht hatte, bekam ich schon mal eine Ahnung, wie ich komplett haarlos aussehen werde. Das Käppchen ist hautfarben, und ich bin kurzsichtig. Geniale Kombi. Der perfekte Badspiegel-Weichzeichnereffekt. Sah ganz ansprechend aus. Ob ich mich an die abstehenden Ohren gewöhnen werde, bezweifle ich. Ein bisschen wie Alfred E. Neumann.
Brian wollte partout nicht so, wie ich es gerne hinbekommen hätte. Produktfotofantasie versus angewandte Realität. Da saß mal alles schief. Vom Winde verweht. Und da ich null Übung mit so etwas habe, handhabte ich das Haarteil nachvollziehbarerweise mit Samthandschuhen. Das macht es nicht einfacher. Ich dachte permanent: „Mist, gleich reißt hier was auseinander.“ Vielleicht ist der Kahlkopf doch die ehrlichere Alternative?
Ich musste an den Fuchs denken – den mit den hochhängenden Trauben. Er springt, er streckt sich, er versucht’s noch einmal, wieder und wieder, den ganzen Tag, bis er merkt – keine Chance. Die Reben hängen zu hoch. Und weil er sich seine eigene Würde nicht nehmen lassen will, sagt er einfach: „Die sind bestimmt eh sauer.“ Ich verstehe ihn. Ich kenne diese elegante Form der Selbstrechtfertigung – das leise „Ich wollte das sowieso nicht wirklich“. Es schützt, was vom Stolz noch übrig ist.
Und ich darf lernen zu akzeptieren. Es ist, was es ist. Im Optimalfall bin ich im nächsten Sommer wieder mit Fell unterwegs. Neun Monate. Werdende Mütter nehmen das auch anstandslos hin. Ich werde mich morgen mit meinem Coiffeur besprechen und wir werden eine Lösung finden. Mit Brian mache ich dann mal eine schöne Fotosession. The way we were.
Ich werde mir eine rote Baseballkappe besorgen. Nicht als Tarnkappe, sondern als Statement. Auf der Vorderseite soll stehen: MBGA. Für das Original konnte ich mich nicht entscheiden. Make Baldness Great Again. Wenn schon, denn schon. Weniger Haar – mehr Gesicht.
Und wenn die Sonne reflektiert, dann nicht über mich, sondern von mir.
Gesagt, getan – 01. November 2025
Dominique sah mich zweifelnd – und leicht infrage stellend – an. „Das meinst du nicht ernst?“, sprach es aus ihm heraus. „Was’n das für ’ne Farbe? So sieht doch deine Haarfarbe überhaupt nicht aus?“ Ganz unrecht hatte er nicht. Brian hatte tatsächlich nichts mit Robert zu tun. Obwohl die Farbbeschreibung lautete: ein kühles Mittelbraun mit aschigen Reflexen, leicht von Sonnenlicht geküsst. Klang eigentlich schon nach mir. Die extrem freundliche Verkäuferin des Ersatzhaars erklärte mir allerdings letzte Woche am Telefon, dass es für Männer eben nicht ganz so viel Auswahl gäbe. Das klang fast wie eine Entschuldigung – und die war absolut nicht nötig. Ich war sehr froh, dass ich das Modell M7 mit Farbton M17S besorgt hatte. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Sonst hätte ich immer den Fahrradketten-Matthäus im Hinterkopf gehabt. Hätte, hätte.
So schnell, wie mein Haardompteur die Perücke aus der Schachtel geholt hatte, war sie auch wieder verschwunden – ab damit ins Regal. Dominique kürzte meinen verbliebenen Langhaardackel-Look und meinte, ich sähe jetzt aus wie Christopher Reeve – der echte Superman. Also Christopher, nicht ich. Ja, so ohne Brille und mit Schummerlicht … fehlte nur noch der rote Umhang.
Er gab mir noch einen Einkaufstipp für die Baseballmütze, wir liebdrückten uns und ich zog los. Erstaunlich – früher dachte ich immer, ich hätte keinen Baseballmützenschädel. Die Verkäuferin fand meinen neuen Look einfach fantastisch. Lag’s an mir oder ist sie lediglich eine sehr gute Verkäuferin? Ich fand das Käppchen jedenfalls auch klasse. Fliederfarben. Leider hatte sie die MBGA-Buchstabenkombination nicht im Sortiment. Ich habe mich dann mit DAD begnügt. Das kann irreführend interpretiert werden. Nein – das Akronym steht nicht für Babba – die Buchstaben stehen für: Deeply Alive Dude. In germanischer Übersetzung etwa: ein zutiefst lebensfroher Typ. So ist es. Tell it like it is.
Und weil ich die Spendierhosen anhatte, kaufte ich mir gleich noch ein nettes Shirt und prima Bermudashorts dazu. Wie hätte ich der Verkäuferin auch widerstehen sollen? Profitours. Fehlte nur noch die Rheumadecke. Aber hey – alles im Sommerschlussverkauf. Und natürlich rabattiert. 50 % auf alles. Schwäbisch eben.
Mir henn’s net vom Ausgebä, mir henn’s vom Schaffa ond vom Behalta!
Geld kann man nur ausgeben, solange man lebt. Frau auch.
Spruch des Tages – 02. November 2025
„Man sollte öfter über die Wirkung eines Medikamentes sprechen als über die Nebenwirkungen.“
Da darf man erstmal draufkommen. Mehr klares Sehen geht nicht. Sozusagen ein 3-Punkte-Einsichts-Wurf meines Lieblings-Radiologen eine Sekunde vor Abpfiff. So geht Erkenntnis.
Nach einem längeren Telefonat mit einem sehr vertrauten Menschen, der eine ähnliche Diagnose wie ich erhalten hat, habe ich mit guten Freunden über seine und meine Erfahrungen gesprochen – speziell über die möglichen Nebenwirkungen. Ich hatte ja meine eine oder andere Panikattacke, und mein langjähriger Freund – nun auch Krankheitswegbegleiter – wollte mir da offenbar in nichts nachstehen und suchte um Rat.
Beipackzettel sind für Patienten oft nur schwer verständlich. Das ist ein bekanntes Problem. Ich lese die erst gar nicht. Horror. Ich hatte ja mit meinem Urologen richtig Glück, als er mir riet, mein Leben einfach weiterzuleben und nicht auf das Einsetzen von Nebenwirkungen zu warten. Tja, hat ja bei mir nicht vollumfänglich hingehauen.
Allerdings: Laut dem Ärzteblatt (Ausgabe 3/2016) glauben sogar viele Ärzte fälschlicherweise, dass alle aufgelisteten Nebenwirkungen in einem direkten kausalen Zusammenhang zur Medikamentengabe stehen. Das macht es für den Patienten nicht einfacher. Der Beipackzettel ist wirklich keine leichte Bettlektüre. Auf der anderen Seite: Wirkung und etwaige Nebenwirkungen von Medikamenten werden ja vor ihrer Zulassung strengstens geprüft, und bei diesen eingehenden Untersuchungen stellen die Arzneimittelbehörden sicher, dass die Vorteile eines Medikamentes die Risiken überwiegen.
Mein Körper meldet sich jetzt immer öfter und bittet zum kritischen Zwiegespräch mit seinem Besitzer. Die medikamentösen Begleiterscheinungen nehmen zu. Speziell mein Magen-Darm-Trakt ist seit kurzem gereizter. Wegatmen kann ich dieses schmerzhafte Gefühl nicht mehr. Ein Schmerz-ADS. Aber immerhin: Kommunikation findet statt. Zum Glück gibt es ja auch für diesen Diskomfort Medikation.
Dass ich den ganzen Tag hin- und herschaukelnd auf einem wunderschönen Boot mit guten Freunden verbracht hatte, machte es meinem Gastro-Intestinaltrakt nicht einfacher. Als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, lief ich schnurstracks nach Hause und gönnte mir eine Antischmerztablette. Mittlerweile hat die Wirkung eingesetzt. Ich bin wirklich froh, dass es solche Medikamente gibt.
Ja – und auch über die, die meinen ungebetenen Mitbewohner in die Schranken weisen und zurückdrängen sollen. Trotz Nebenwirkungen.
The winner is: Wirkung. Die Nebenwirkungen dürfen dann als gute Verlierer vom Platz gehen.
Traumdeutung – 03. November 2025
Ich war ohne jeden Zweifel im zolpidemhypnagogischen Zustand, also im schlaftablettenprovozierten Übergangsbereich zwischen Wachsein und Schlafen, und hatte wunderschöne, traumähnliche Bilder vor meinen inneren Augen. Vereinzelte Muskelzuckungen, meine Gehirnaktivität war nahezu im Stoppmodus, und ich hatte das angenehme Gefühl zu fallen. Nach einem recht schmerzhaften Bootstag war das genau das Richtige. Meine Denkmaschine war allerdings noch nicht vollständig ausgeschaltet. Kurz bevor ich dahinglitt, sah ich einen traumhaften Brautschleier verloren auf der Straße liegen – irgendwo in New York City. Zumindest sah ich auch etliche Yellow Cabs auf einer regnerischen Avenue.
Ich hörte Fingerschnippen. Mein Bewusstsein reckte den Arm in die Höhe und erregte Aufmerksamkeit. Sehr unhöflich, so kurz vor dem Tiefschlafschlummern. So schnell ging Aufwachen. Es wollte mit mir verschiedene Ansätze der Ursachenforschung besprechen. Der Brautschleier lag ja nicht ohne Grund auf der Straße.
Mein hochaktiver Frontallappen bot mir folgende Varianten an:
Die erste und naheliegendste: Die Braut hatte einen Moment des Durchblicks und hatte einfach gemerkt, dass sie den besseren Deal mit sich selbst machen sollte. Als sie in das Taxi stieg, riss sie sich den Schleier vom Kopf und ließ ihn aus dem Fenster segeln. Ihr Manifest: „Ich heirate das Leben, ich brauch keinen Typen an meiner Seite.“ New York applaudierte leise mit blinkenden Rücklichtern. Das klang schon mal sehr schlüssig – und nach mir.
Die zweite Variante klang indes auch recht überzeugend: Vielleicht war’s gar kein Drama, sondern einfach ein ganz normaler Freitagabend in Manhattan. Junggesellinnenabschied im Coyote Ugly, irgendwo zwischen fünfter Strawberry-Margarita und drohender Bewusstlosigkeit. Die Braut in spe tanzte spärlich bekleidet auf der Bar, rief „Who runs the world? – Girls!“ Gegen vier Uhr morgens liefen die Damen dann feuchtfröhlich und torkelnd, wie in Zeitlupe, Richtung Ausgang. Draußen ließ sich nun auch der Schleier gehen und machte es sich auf nassem Asphalt zwischen geparkten Autos und den Resten eines Hotdogs bequem. Aus dem Coyote klang in der Ferne kaum noch hörbar Don’t Stop Believin’.
Möge Liebe ewig währen.
Aber auch die dritte Variante, die mir mein Stirnhirn präsentierte, klang verlockend und hatte Gewinnerchancen.
Es war der Morgen danach. New York lag noch in Watte aus Konfetti, Süßwaren und Restschminke. Die Stadt roch nach Kürbis, billigem Sekt und gebrochenen Vorsätzen. Ein Brautschleier auf dem Asphalt – wahrscheinlich Teil eines Kostüms, das irgendwann in der Nacht beschlossen hatte, dass Verpflichtung überbewertet war. Die Trägerin? Der Träger? Vermutlich irgendwo zwischen Taxi und Textnachricht verloren gegangen, auf der Suche nach Aspirin oder dem Heimweg. Eine Windböe rollte die Avenue hinunter und nahm den Schleier mit – Halloween war offiziell vorbei.
Ich gab allen drei Varianten die Goldmedaille. Als die Siegerhymne Empire State of Mind von Jay Z und Alicia Keys gespielt wurde, stand ich auch wieder auf meinen Füßen, ging ins Wohnzimmer und setzte mich an den Computer. Wäre schade gewesen, wenn ich diesen Wachtraum vergessen hätte.
Trotz jahrzehntelanger Hirnforschung weiß bis heute niemand so ganz genau, warum wir eigentlich träumen. Das menschliche Gehirn hält sich da bedeckt – vermutlich aus gutem Grund. Die einen sagen, Träume seien so etwas wie das nächtliche Recyclingprogramm der Erinnerungen. Andere meinen, sie helfen uns, den ganzen emotionalen Überschuss des Tages halbwegs elegant zu entsorgen. Wieder andere sehen darin eine Art Probebühne des Lebens, auf der wir im Schlaf das üben, was uns im Wachzustand überfordert.
Die Theorie der Traumdeutung besagt, dass Träume verdrängte Wünsche, Ängste und Konflikte in symbolischer und entstellter Form darstellten. Ups. Verdrängte Wünsche? Brautschleier? Hochzeit? Ich sollte mal Oneirologen in meiner Gegend googeln – also einen Traumdeuter. Ich befürchtete bereits das Schlimmste.
Oneirologe!? Wer denkt sich eigentlich immer solche komplizierten Fachbegriffe aus?
Fronti hatte bereits eine Idee …
Wenn ständig Krise ist, ist es der Normalzustand
Im Umkehrschluss: Die Abwesenheit von Schmerzen bedeutet nicht, dass alles wieder gut ist. Im Nachhinein betrachtet sah es so aus, als hätte die zweite Chemo meinem Draht – dem interimistischen Verbindungsoffizier – einen Kinnhaken versetzt und ihn auf die Bretter geschickt. Erst am Donnerstagabend, also gut drei Tage nach der intravenösen Krebstherapie, dachte ich, dass er augenscheinlich das Handtuch geschmissen hatte.
Der Agent Doppel-J war ausgeknockt. Eine voreilige Bewertung. Eine inkorrekte dazu.
„Stellen Sie sich mal eine Glaskugel vor. Sie muss nicht rund sein, und sie muss nicht durchsichtig sein.“
Und jetzt die bildhafte Vorstellung mit den Daten von Drahti: Ein Doppel-J-Katheter ist typischerweise etwa 24 bis 30 cm lang, hat einen Außendurchmesser von bis zu 3,3 mm und ist relativ flexibel, da er aus einem weichen Kunststoff besteht. Aber – die beiden Enden des Schlauchs, die sich wie ein „J“ – oder Ringelschwänzchen – krümmen, machen ihn dort unflexibel, um ihn sicher in der Niere und der Blase zu fixieren und ein Verrutschen zu verhindern. Er ist zwar dazu gedacht, körperliche Aktivitäten nicht einzuschränken, kann aber Beschwerden wie Schmerzen oder häufiges Wasserlassen verursachen. Beides kann ich bestätigen.
Also: „Stellen Sie sich jetzt bitte mal einen Doppel-J-Katheter vor, er muss nicht …“
Ich wollte letzten Freitag schon einen Beschwerdefrei-Freudenblog schreiben, da begann das Buhlen um Aufmerksamkeit des Ringelschwänzchens von vorn. Man kann Schmerzfreiheit erst dann richtig wertschätzen, wenn man wieder Schmerzen hat.
Die Schmerzen, die ein Doppel-J-Katheter verursacht, sind ein Kapitel für sich. Das Hauptproblem liegt im Rückstau: Wenn Urin beim Wasserlassen in die Niere zurückdrückt, meldet sich dort ein dumpfer Druck, manchmal ein Stich – als würde jemand innen anklopfen, um zu fragen, ob noch alles dicht ist. Dazu kommt die ständige Reizung der Harnwege, die jeden Gang zur Toilette zu einer kleinen Mutprobe macht. Und dann ist da noch Kathi selbst – ein Eindringling mit Charakter, der sich bei jeder Bewegung bemerkbar macht, als wollte er sagen: Ich bin auch noch da.
Last but not least: Kleine Verletzungen des Gewebes während der Einlage können zu leichten Blutungen führen. Also am besten Rotlicht-LEDs im Badezimmer installieren – dann erkennt man die rötliche Blasenentleerung im Klosett nicht so genau und macht sich weniger Sorgen.
Novaminsulfon – als Novalgin bekannt – hat sich als Schmerzabwehr bis dato sehr gut geschlagen. Apropos Schlagen:
Michael Buffer ans Mikro bitte: „Let’s Get Ready to Rumble!“
Der Feind, der keiner ist – 05. November 2025
„Wie gehst du eigentlich mit dem Thema Krebs um?“, fragte mich ein guter Freund gestern Abend. Gute Frage. Gar nicht, dachte ich. Oder? Die Frage beschäftigte mich dann eine ganze Weile. Eins wurde mir dabei klar: Der Krebs ist vor allem eins nicht – er ist kein Feind.
Das klingt im ersten Moment wie eine Provokation, aber wenn ich es nüchtern betrachte, ist er das tatsächlich nicht. Er ist kein Alien, kein Virus, das sich von außen in meinen Körper geschlichen hat. Er ist eigentlich recht menschlich, im Verhalten wie wir selbst – irgendwann hat er beschlossen, sich nicht mehr an Regeln zu halten. Kein Feind von außen also, sondern eher ein innerer Dissident.
Aus biologischer Sicht ist Krebs kein einzelnes Ding, sondern eher ein Verhalten. Eine Fehlentscheidung auf zellulärer Ebene. Normale Körperzellen wissen, wann sie wachsen, wann sie sich teilen und wann sie sterben sollen. Sie folgen einem Plan, den die Evolution in ihre DNA geschrieben hat – eine Art stilles Regelwerk, das Ordnung im Körper garantiert. Manchmal aber kippt etwas in diesem System. Ein kleiner Programmierfehler, eine Mutation, eine chemische Verirrung. Die Zelle vergisst, dass sie Teil eines größeren Ganzen ist, und fängt an nur noch für sich selbst zu leben. Sie teilt sich, wächst, ignoriert die Nachbarn, verdrängt alles, was ihr im Weg steht.
Klingt ein bisschen wie unsere aktuelle politische Weltbühne.
Krebszellen haben keinen Teamgeist. Sie wollen leben, genau wie alle anderen – sie tun es nur rücksichtslos. Klingt nicht unverlockend und durchaus auch ein wenig nach mir.
Unser Immunsystem ist darauf trainiert, Ordnung zu halten. Wenn eine Zelle aus der Reihe tanzt, wird sie normalerweise erkannt, markiert und entfernt. Doch Krebszellen sind clever – sie tarnen sich. Sie imitieren gesunde Signale, verstecken sich in Geweben, die man nicht so leicht überprüft, und lassen das Immunsystem glauben, alles sei in bester Ordnung.
„Und, ihr frisch Vermählten? Wie fühlt es sich jetzt so an, verheiratet zu sein? Noch alles verliebt und toll?“ „Ja, klar, alles super.“
Erst wenn es zu spät ist, wenn das Gleichgewicht gestört ist, beginnt der Körper den Gegenschlag. Und dann nennen wir es „Kampf gegen den Krebs“. Eher ein innerer Bürgerkrieg: Beide Seiten tun, was sie tun müssen.
Wenn man den Krebs menschlich betrachtet, dann will er nichts anderes als das, was alle Lebewesen wollen: überleben. Er braucht den Wirt, um zu existieren. Wenn der Wirt stirbt, stirbt auch er. Das macht ihn, biologisch betrachtet, zu einem ziemlich schlechten Parasiten. Ein kluger Krebs würde also wissen, wann er aufhören muss. Aber Evolution denkt nicht in Moral, sie experimentiert. Krebs ist also kein Plan. Er ist eine Fehlfunktion mit Überlebenswillen. Eine Zelle, die „mehr“ sagt, wo „genug“ stehen sollte.
Der Krebs ist das Leben, das seine eigenen Grenzen nicht akzeptiert. Er erinnert uns daran, dass wir fehleranfällig sind – und dass diese Fehler Teil des Plans sind, auch wenn sie uns manchmal das Leben kosten. Leider.
Der Krebs ist für mich mittlerweile kein Feind mehr. Eigentlich spielt er in meinem täglichen Leben auch keine Rolle. Dominique hat mich geerdet, und das erinnert mich täglich daran, dass Normalität das beste Medikament ist. Ich könnte genauso gut sagen, ich habe eine Allergie und nehme regelmäßig Antihistaminika ein. Sonst noch was?
Ich will ihn – meine Situation – trotzdem verstehen. Was er mir eventuell – unbeabsichtigt – zeigen will. Dass das Leben am Ende unkontrollierbar ist – genau darin liegt wahrscheinlich seine Schönheit. Krebs ist vielleicht ein Spiegel. Wir erkennen darin womöglich Dinge, die wir vorher nicht sehen wollten – aber genau das ist vielleicht der Anfang von innerem Frieden. Auch Frieden mit der Diagnose Krebs.
Also – wie gehe ich mit dem Thema Krebs um? Meine Antwort, ohne jegliches Zögern: Ich will leben. Punkt. Oder wie Mahatma Gandhi sagte:
„Live as if you were to die tomorrow.“
HAfVuSFaM – 06. November 2025
Eine gute Freundin erklärte mir neulich, dass ich jetzt – als offiziell Krebskranker – Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis habe. Sie wusste, wovon sie spricht. Ich wusste das nicht. Ich bin jetzt also schwerbehindert. Klingt nach einem dieser Sätze, die man lieber nicht im eigenen Zusammenhang hört.
Der Gedanke, dass man – präziser gesagt ich – „schwerbehindert“ ist, hat etwas Endgültiges, fast Unheimliches. Beim Anspruch auf Schwerbehinderung geht es allerdings um etwas Konkretes: um Rechte, Unterstützung, Nachteilsausgleich – um eine kleine bürokratische Anerkennung dessen, was das Leben einem gerade zumutet. Ein Stück Gerechtigkeit in Formularform.
Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit der Abteilung „Schwerbehindertenangelegenheiten“ in Kontakt gerate. Das Leben ist kein Wunschkonzert.
So traurig die ganze Angelegenheit scheint – die Telefonansage des Hessischen Amts für Versorgung und Soziales Frankfurt am Main ließ mich jeglichen Schmerz und jede Ohnmacht vergessen. Sie klang nämlich so, als hätte Evelyn Hamann unter der Regie von Loriot die Ansage eingesprochen. Ich glaube, ich habe insgesamt fünfmal dort angerufen – und jedes Mal mehr Tränen gelacht. Hier zum Mitlesen:
„Hier ist das Hessische Amt für Versorgung und Soziales Frankfurt, guten Tag.
Bitte wählen Sie die 1 für Schwerbehindertenangelegenheiten der Buchstaben
A, B, I, U, T, Q, R, „SCH“, U, V, X, Z.
Die 2 für Schwerbehindertenangelegenheiten der Buchstaben
C, E, F, G, J, L, N, P, „SU“ bis „ESZETT“, T, W, Y.
Die 3 für Schwerbehindertenangelegenheiten der Buchstaben
D, H, K, M, S bis „SC“, „SCI“ bis „SS.“
Nach diesem Anruf wusste ich: Mein Krebs hatte jetzt auch eine Durchwahl. Die Zwei.
Allerdings, der Sketch war noch nicht vorbei. Jetzt war ich mittendrin und hörte quasi Herrn Müller-Lüdenscheidt sagen: „Mooooment!“, wie in seiner legendären Badszene mit Herrn Dr. Klöbner: „Mooooment! Die Ente bleibt draußen!“
Die sehr freundliche Sachbearbeiterin bat mich, den Antrag via elektronische Post an das Amt zu schicken. Falls ich etwas zum Schreiben hätte, würde sie mir die E-Mail-Adresse nennen. Das hatte ich und setzte die Spitze meines Füllfederhalters schon mal auf den Post-it-Zettel. Sie buchstabierte:
„Viktor – Anton – Friedrich – Richard – Anton – Punkt – Samuel – Berta – Drei – Drei – at – Heinrich – Anton – Viktor – Samuel – Bindestrich – Friedrich – Richard – Anton – Punkt – Heinrich – Emil – Samuel – Samuel – Emil – Nordpol – Punkt – Dora – Emil …“
In Deutschland gilt man als schwerbehindert, wenn der Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50 beträgt. Das ist keine moralische oder medizinische Bewertung, sondern eine rechtliche – ein Maß dafür, was der Körper nicht mehr leisten kann. Der GdB wird vom Amt für Versorgung und Soziales festgelegt – in meinem Fall Frankfurt am Main. Dort prüft man anhand ärztlicher Unterlagen, wie stark die Teilhabe am täglichen Leben eingeschränkt ist. Krebserkrankungen führen in der Regel automatisch zu einem hohen GdB.
Beim Schreiben dieser Zeilen bekomme ich allerdings ein schlechtes Gewissen. Hoffentlich sieht kein Sachbearbeiter vom HafVuSFaM, wie uneingeschränkt ich am täglichen Leben teilnehmen kann. Ja, ja – mein Ego wollte auch wieder mal etwas sagen. Das hat mit Sicherheit und ohne Prüfung einen GdB von 100. Vielleicht sollte ich gleich zwei Anträge ausfüllen.
Ein Schwerbehindertenausweis öffnet übrigens den Zugang zu Nachteilsausgleichen – Steuervorteile, Zusatzurlaub und Kündigungsschutz. Also, die Steuervergünstigung und den Zusatzurlaub nehme ich gerne.
Das Wort „Schwerbehindertenangelegenheiten“ klingt selbst etwas beeinträchtigt. Doch zwischen den Silben schimmert eine ethische und moralische Haltung: die Silben-Metaebene beschreibt die angewandte Menschlichkeit im Alltag. Insofern sehr lobenswert, dass es so etwas gibt.
Wie sagte es Liberace so treffend: Zu viel des Guten ist wunderbar. Ich nahm mein Telefon in die Hand und drückte die Wiederwahltaste.
„Hier ist das Hessische Amt für Versorgung und Soziales Frankfurt, guten Tag …“
Lachen ist die beste Medizin. Die Ente bleibt draußen.
Überlebenskünstler
Helga Keratin, die Vizepräsidentin meiner Resthaarbelegschaft, rief zur Krisensitzung. Paul Pigment, Vertreter der Farbabteilung und auch Vorstand der Melanozyten-Gewerkschaft, war bereits ausgefallen. Oskar Ohnefarb musste für ihn einspringen und hieß alle Hinterbliebenen willkommen.
„So kann es nicht weitergehen, liebe Kolleginnen und Kollegen“, betonte Helga. „Wenn sich der Robert beim Kämmen jedes Mal eine Handvoll Haare ausfrisiert, dann stirbt er demnächst nicht an seiner eigentlichen Diagnose, sondern an einem Herzstillstand beim Anblick seiner Glatze. Wer hat das so geplant?“ Die verbliebenen Veteranen schauten einander ratlos an.
Erstaunlich, wie mein Hirn offensichtlich erst nachts auf Hochtouren kommt. 02:36 Uhr. Nach einer hormonell bedingten Transpirationsattacke wechselte ich vom warmen, kuscheligen und entsprechend feuchten Bettchen auf die kühle und laiengestühlharte Couch. Auf halbem Weg vollzog ich noch ein nächtliches Harnen im Gäste-WC und sah beim anschließenden Händewaschen im Spiegel vereinzelte Kopfhautdeserteure auf meinem schwarzen Nacht-T-Shirt.
Partisanen der Eitelkeit.
Sie lagen reglos und ergeben auf dem Schlafoberteil. Bei diesem Anblick war ich ebenfalls erstarrt und hörte dabei den zweiten Teil von Helgas Ansprache – jedoch etwas undeutlich – im Hintergrund. Ich wusste nicht, ob ich noch träumte oder ob Helga wirklich sprach. Egal, plötzlich war ich wieder im Hier und Jetzt. Wer nachts nicht schlafen kann, kann auch gleich googeln. Also ran an die Kiste.
Wissenswertes: Etwa 80 % der Männer in Mitteleuropa leiden im Laufe ihres Lebens unter Haarausfall. Der erblich bedingte Haarausfall (androgenetische Alopezie) ist die häufigste Ursache. Da ist das „Und tschüss“ bereits in die DNA miteinprogrammiert. Die Glatzenrate – was für ein fieses Wort – in Deutschland liegt bei 41,51 %. So ganz alleine wäre ich damit im Pessimalfall also nicht.
Chemotherapiebedingter Haarausfall dagegen ist eine andere Liga: Da entscheidet die Zellbiologie. Medikamente wie Docetaxel greifen gezielt Zellen an, die sich schnell teilen – und das sind leider nicht nur Tumorzellen, sondern auch Haarfollikel. Ein unschöner Kollateralschaden.
Doch – und das ist das eigentlich Erstaunliche – nicht alle Haare geben gleichzeitig auf. Manche halten durch, wie Veteranen im Sturm. Besonders die pigmentlosen, also weißen Haare scheinen oft länger durchzuhalten. Pigmentzellen der noch farbigen Haare reagieren besonders empfindlich auf zytotoxische Substanzen. Kurz gesagt: Graue Haare sind chemoresistenter. Das nennt man Behaarlichkeit, und ich komme dann doch noch in den Genuss von Altersweißheit.
Dass meine Haare jetzt erstmal aufgehört haben auszufallen, ist angewandte Biologie: Die Follikel haben ihren Schockmoment überstanden und die Zellen wagen sich dann vorsichtig wieder aus dem Schädel. Noch lange nicht alle, aber eventuell genug für den Hoffnungsschimmer in meinem Eitelkeitsspiegel. Die dermalpolierte Oberstirnfläche bleibt mir vielleicht erstmal erspart.
Nur folgende Erkenntnis blieb mir leider nicht erspart. Auf dem Rückweg heute von meiner Chemohalbzeit zwei beim Blutspendedienst stand ich vor mich hinträumend im Bus und war froh, dass ich mich gegen das Radln entschieden hatte. Die Wettervorhersage war zwar so 50/50, aber die zweiten 50 hatten sich offensichtlich durchgesetzt. Es goss mittlerweile in Strömen. Ich blindes Huhn, ich. Während ich mich für meine weise Entscheidung ein wenig auf die Schulter klopfen wollte, sprach mich ein Endvierziger sehr freundlich an und bat mir seinen Sitzplatz an. Noch Fragen? Möchte jemand wissen, wie ich mich danach gefühlt habe? Vielleicht sollte ich mir einen neuen Künstlernamen zulegen. Roppa? Roppabert? Roboppa? Oder schlicht und einfach: Oppa?
„Hast du den Robert gesehen?“ „Wen?“ „Oh man, unseren Opa.“ „Ah, ich glaube, der macht sein Mittagsschläfchen, soll ich ihn wecken?“
Interessant, wie sehr uns das Thema Aussehen und Haare beschäftigen kann. Gelinde gesagt. Und das, obwohl wir unsere Mähne, unser Gesicht fast nie selbst sehen können. Ich spreche hier übrigens in der dritten Person, um mich nicht selbst zu diskreditieren. §§ 136 Abs. 1 S. 2, 243 Abs. 4 S. 1 StPO.
Ich hab’s: ein Leben ohne Spiegel. Genial.
Gelebte buddhistische Gelassenheit – Die wissen ganz genau, warum sie keine Haare haben.
Wenn die Onko mit dem Uro – 08. November 2025
Meine Leukozyten, also meine weißen Blutkörperchen, haben sich wieder mal etwas rar gemacht. Diesmal sogar nur 1,3 Tsd./µl statt der üblichen 3,9 bis 10 Tsd./µl. Der Blick meines Urologen verfinsterte sich beim Analysieren der Blutwerte. Er wollte mich ja bereits vor drei Wochen unter Quarantäne stellen. Damals waren die weißen Blutzellen zur Halbzeit zumindest noch bei 1,8 Tsd./µl.
Also – meinen mittlerweile geschundenen rechten Arm wieder hinhalten und: O’zapft is! Er wollte unbedingt eine Kontrollmessung. Jetzt. Lieber Vorsicht als Sepsis.
Mein Immunsystem fährt also wieder im Sparmodus. Auch die Neutrophilen, die Frontsoldaten unter den Abwehrzellen, liegen bei 0,27 Tsd./µl, also auch eher im Kurzurlaub. Dafür übernehmen die übermotivierten Lymphozyten heldenhaft das Ruder – ein sattes Plus zum Wochenende von 56,2 %. Die Leber zeigt leichte Aktivität – sprich die Werte sind etwas erhöht. Die Niere funktioniert, wie sie soll. Und nun bitte Applaus – mein PSA-Wert liegt bei 0,5 ng/ml. Das ist ein sehr guter Wert. Die Zahl bedeutet: Der Feind schläft, oder besser – ist abgereist. Ein bisschen Magnesium fehlt und der Blutzucker ist leicht erhöht. Kein Drama, aber eine Erinnerung an mich selbst: weniger Gelato, mehr Gemüse. Oder war es umgekehrt? Und last but not least: Mein Vitamin D liegt im sonnigen Bereich.
Unterm Strich: Mein Körper ist ein wenig angezählt, aber wach, wehrhaft und willens. Mein PSA ist super entspannt. Meine Zellen sind müde, aber diszipliniert. Die Leber ist fleißig, die Nieren zuverlässig, das Immunsystem hat Kaffeepause und mein Magnesium schmollt. Der Urologe meinte: „Bis auf Ihr Immunsystem funktionieren Sie erstaunlich gut für das, was Sie gerade durchmachen.“
Die Onkologin war bei meinen Leukowerten vor drei Wochen ja komplett entspannt und ermahnte mich, mich nicht von meinem Urologen verrückt machen zu lassen. Selbst wenn die Leukozyten bei 0,0 Tsd./µl lägen, wäre das kein Grund zur Panik. Ich solle Prednison (wirkt ähnlich wie das körpereigene Hormon Cortisol) täglich einnehmen, das würde für hohe Leukos sorgen. Wer viel fragt, bekommt viel Antwort. Von Durchblick hat keiner was gesagt.
Mein Urologe sah mich noch finsterer an, als ich ihm das erzählte. „Das sind dann Fake-Leukos“, protestierte es ein wenig aus ihm heraus – und er hatte damit Recht. Prednison zaubert keine neuen Abwehrzellen herbei, es verschiebt nur die Statisten. Die Neutrophilen, das Bodenpersonal der Immunabwehr, werden aus den Geweben zurück in den Blutkreislauf gespült. Das sieht dann im Labor aus, als hätte ich plötzlich wieder ein kämpferisches Heer an weißen Blutkörperchen. Die echten, die klugen, die leisen Verteidiger – die Lymphozyten – zieht das Kortison dagegen aus dem Verkehr. Sie verkriechen sich in die Lymphknoten, legen die Füße hoch und warten, bis der Sturm der Steroide vorbei ist. Prednison macht die Blutwerte hübscher, aber nicht mich gesünder. Ein bisschen wie Make-up auf Fieberwangen – beeindruckend im Spiegel, aber völlig nutzlos gegen das Fieber selbst.
Also befragte ich mich selbst. Genau das, was ich jetzt schon seit gut zwei Wochen jeden Morgen mache. Mein Körpergefühl ist außergewöhnlich gut. Der Doppel-J-Katheter nervt zuverlässig wie ein schlecht gelaunter Mitbewohner, aber sonst habe ich keinerlei Beschwerden. Ich fühle mich so wie vor dieser Odyssee, die vor sieben Monaten begann. Und da ich auch das Prednison nicht einnehme, scheinen mir die niedrigen Leukozyten nichts auszumachen – sprich: mein Immunsystem, meine Abwehr scheint gut zu funktionieren. Die erste Chemo ist ja jetzt auch schon über einen Monat her.
Die Kontrollmessung war immer noch sehr niedrig, allerdings geht es offensichtlich in die richtige Richtung – ein Anstieg um 11 %. Der Urologe sagte mir noch am Telefon: „Passen Sie gut auf sich auf.“ Das klang sehr aufrichtig und mitfühlend. Ein schönes Gefühl.
Don’t change horses midstream. Das hat bei Abraham Lincoln gut funktioniert, und ich halte mich ebenfalls daran. Ich werde absolut nichts ändern. Mein Körpergefühl kann nicht so falsch sein. Ich werde nächste Woche dann nochmal die Leukos testen, dann weiß ich mehr. Oder auch nicht.
Man muss sich nicht verrückt machen, auch wenn die Situation schwierig ist.
Prostataspezifisches Antigen
In kaum acht Wochen ist mein PSA-Wert von 15,3 auf 0,5 gefallen – ein medizinisches Glanzstück der Kombination aus Darolutamid und Trenantone auf Zellebene. Es sieht ganz danach aus, als ob die Strategie greift, die Zellen reagieren und mein Körper mitspielt. Sehr gute Mannschaftsleistung.
PSA (Prostataspezifisches Antigen) ist ein Eiweiß, das fast ausschließlich von Prostatazellen gebildet wird – sowohl von gesunden als auch von bösartigen. Wenn der PSA-Wert fällt, zeigt das: Die hormonabhängigen Tumorzellen reagieren auf die Therapie. Das ist das gewünschte Ergebnis meiner Androgendeprivationstherapie (ADT) – also der Hormonblockade.
Trenantone dreht dem Testosteron den Hahn zu, Darolutamid blockiert die letzten Andockstellen auf den Krebszellen. Einer kappt die Quelle, der andere verhindert das Ankoppeln. Hormonelle Diät für den Eindringling.
Mein PSA-Wert fällt also, weil weniger aktive Krebszellen PSA produzieren. Die Tumorzellen „verhungern“ hormonell. Dadurch wird auch die PSA-Produktion praktisch gestoppt. Mein Testosteronspiegel ist jetzt ebenfalls extrem niedrig – auf Kastrationsniveau. Das klingt brutal, ist aber medizinisch präzise. Tja, das hätte ich gerne etwas freundlicher ausgedrückt. Tumorzellen werden dadurch inaktiv oder sterben ab. Der Testosteronentzug kann Nebenwirkungen zur Folge haben: Hitzewallungen, Müdigkeit, Muskelabbau und Libidoverlust.
„Schatzi, dauert es noch lange?“
„Ja.“
Der PSA-Wert ist kein endgültiger Sieg. Ich weiß, dass diese Ruhe keine Ewigkeit verspricht – aber sie ist echt. Und ehrlich verdient. Sie spricht für eine stabile Krankheitskontrolle. Meine Werte stabilisieren sich und mein System läuft trotz Nebenwirkungen bei recht hoher Betriebstemperatur. Die meiste Zeit vergesse ich sogar, dass ich überhaupt in Behandlung bin. Die Zellen, die früher PSA produzierten, wissen gerade nicht mehr, was sie tun sollen. Sie dösen hormonlos im Dunkeln. Der Wert 0,5 ist ihr Schweigen.
Wenn jetzt auch noch die Chemotherapie in Zusammenarbeit mit der Strahlentherapie erfolgreich ihren Job verrichtet, dann ist das ein Grund zu feiern. Nike sagt: Just do it! Genau das dachte ich mir – im leicht übermütigen Freudentaumel – und habe mir ein Konzertticket gekauft.
Alejandro Sanz, Tour: ¿Y Ahora Qué? – auf Deutsch: Und, was nun?
Wann: 17. Juni 2026, 22 Uhr.
Noch Fragen?
Einhundert – 09. November 2025
Das ist nun der einhundertste Eintrag im Blog. Etwas mehr als 40.000 Worte. 200 Buchseiten vollgeschrieben. Bis dato. Ich wollte verstehen, verarbeiten, beschreiben, was in mir – mit mir – passiert. Was passiert ist. Ich habe dabei gelernt, dass ich all das, die Krankheit, das Leben – mein Leben – nicht wirklich verstehen kann und auch nicht verstehen muss. Mein Blog – eine Chronik des Unfassbaren. Auch mit 80.000 Worten nicht wirklich zu beschreiben.
Hier also zum Hundertsten: hundert Wörter, die geblieben sind. Eine Sammlung aus Privatem, Schmerz, Humor, Medizin und Mut. Willkürlich ausgewählt. Zufällig – wie das Leben selbst. Worte, die leben.
Fronti, Gedankendschungelbuch, INSONAMI, D-Day, Ohnhoffismus, Zolpidemhimmel, Eitelkeitsspiegel, Crampus, Mondzyklus, Schmerzabwehr, Doppelherzbewegung, Sturmveteranen, Doppel-J, PSA-Poesie, Freundschaft, Paulinchen, Melanozytengemeinschaft, Roppabert, Tiefschlafschlummern, Bettflucht, HafVuSFaM, Nachtschattenprotokoll, Wundermüdigkeit, Prednisonbluff, Provisorium, Diagnosentango, Atemprotokoll, Streukörperchen, Krisensitzung, Follikelkommando, Be-merkens-wert, Zoll. Pi. Dem., Schmerzstille, Überlebenskünstler, Traumdeutung, Lymphonauten, Leukonauten, Ultraschallgeduld, Zellgedächtnis, Kopfhäutung, Nebenwirkungsroulette, Chemohumor, Banalitäten, Miniaturmut, Glaskugelmoment, Seeleninventur, Monologmaschine, Zytostatikum, Hormonbremse, Intuition, Kampfmodus, Placebo, Ritualroutine, Verzweifenttäuschlosigkeit, Normalitätsphilosophie, Weißheitslinie, Mutationsmelodie, Schwellenpoetik, Spiegelgefecht, Transzendenz, Altersweißheit, Lebensende, Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit, Überlebensgeduld, Magnesiumbeleidigung, Perücke, Nirvana, Presbyakusis, Halbmondmeditation, Immunsymphonie, Drahti, Wachtraumprotokoll, Selbstversuchsreihe, Lebensinventur, Prostatamonolog, Valium, Wimpernfeldzug, Krankenhauspoesie, Herzensangelegenheiten, Endvierzigerblick, Hoppala, Hoffnungsschimmer, Figaro, Stirnplateau, Neutrophilenurlaub, Tumorpoetik, Sitzfleischmission, Zuversichtsplacebo, Eitelkeit, Gelassenheit, Prostatakarzinom, Ringelschwänzchen, Fieberwangenmake-up, Platzhirschen, Kaffeepausenimmunsystem, Murmeltier, Darmspiegelung, Hormonorchester, Zellorchester, Metastasys.
Die Krankheit hat mir eine neue Sprache geschenkt. Fühlen – in Buchstabenform. Jedes Wort, das bleibt, ist ein kleiner Beweis, dass ich noch da bin. Die nächsten hundert? Keine Ahnung, worum sie sich drehen werden. Sie werden auch wieder leben.
Wie ich.
Mir wird schon nichts passieren – 10. November 2025
Ich lag komplett entspannt auf einer Wellnessliege im Spa-Bereich und wurde kurzweilig unterhalten. Ein guter Freund lag nicht minder gelassen auf seiner Ruheliege und wir ließen die letzte Woche Revue passieren. So geht Plaudern. Das sind echte soziale Medien in Interaktion.
Irgendwann kamen wir auch auf meine Situation zu sprechen und er wollte wissen, ob der Krebs weiterhin keine Rolle spielen würde und ob ich ab und zu noch Angst vor ihm hätte. Tat er nicht – hatte ich auch nicht. Ich habe Krebs-Amnesie. Endlich mal eine Krankheit, die sich tatsächlich gut anfühlt. Ich fragte mich – diesmal sogar laut – warum die Menschen eigentlich mehr Angst vor Krebs als vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Fronti erwachte aus seinem Wohlfühl-Dämmerschlaf und war entzückt. So einfach inaktiv herumliegen ist nicht wirklich seine Spezialdomäne.
Wir alle kennen diesen Satz. Er kommt immer dann, wenn Vernunft kurz mal den Raum verlässt. „Mir wird schon nichts passieren.“ Das ist die große Schwester von „Nein, kein Problem“ und „Na klar, kann ich jederzeit damit aufhören.“ Na dann.
Statistisch betrachtet, und wie bereits oben erwähnt, müsste der Mensch mehr Angst vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben als vor Krebs. Die Zahlen sind eindeutig: Das Herz ist der unangefochtene Spitzenreiter unter den tödlichen Missverständnissen. Rund 18 Millionen Menschen weltweit sterben jedes Jahr an Herz- oder Gefäßleiden. Krebs liegt mit gut 9 Millionen abgeschlagen auf Platz zwei – lediglich die Silbermedaille in der Todesstatistik. Auf einen durch Krebs Verstorbenen kommen zwei Herz-Kreislauf-Tote.
Und doch fürchten sich die meisten mehr vor dem Krebs als vor einem Herzinfarkt. Warum eigentlich? Krebs klingt eher wie ein Endgegner. Unsichtbar, unberechenbar, heimtückisch. Das Herz dagegen? Ein alter Bekannter. Es klopft, stolpert, pumpt. Man kann ihm zuhören, es beruhigen, ihm sogar ein Placebo-Workout gönnen. „Doch, mein Schatz, ich war heute wirklich im Gym. Gehen wir nachher noch zum Italiener?“
Krebs dagegen ist die Rebellion aus den eigenen Reihen – das innere Zellkomplott, der biologische Verrat. Und Verrat sitzt tiefer als die neun Kreise der Hölle. Dabei sind die Ursachen beider Krankheiten in aller Regel erstaunlich banal – und vor allem meistens hausgemacht. Rauchen. Bewegungsmangel. Zu viel Zucker und Fett. Stress. Schlafmangel. Alkohol. Die Klassiker eben. Die Herz-Kreislauf-Fraktion mag gerne etwas mehr. „Aber bitte mit Sahne.”
Der Krebs dagegen bevorzugt den Flüsterton: schleichend, diskret, unspektakulär. Aber das Ergebnis ist oft dasselbe – das „Hätt’ ich bloß früher …“
Das eigentlich Skurrile: Wir wissen es. Wir wissen alles. Wir wissen, dass Bewegung hilft, dass Rauchen schadet, dass Gemüse keine Verschwörung der WHO ist. Wir wissen, dass Alkohol keine Vitamine enthält – und dass fünf Stunden Schlaf keine Regeneration, sondern ein Bewerbungsgespräch fürs Burnout sind. Und trotzdem: „Mir wird schon nichts passieren.“
Der Mensch ist ein faszinierendes Tier – fähig, Raketen zum Mars zu schicken, aber im Prinzip unfähig, ein Glas Wasser zu trinken, bevor er ins Bett geht. Wir leben mit unseren Risikofaktoren, als wären es keine. Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen.
Herz-Kreislauf klingt, als könne man eingreifen – ein bisschen weniger Butter, ein paar Schritte mehr. Krebs dagegen fühlt sich an wie höhere Gewalt – als würde sich der Krebs nicht um unsere To-do-Listen kümmern. Dabei sind beide fair. Beide rechnen nur mit dem, was wir ihnen geben. Beide sind weder böse noch gerecht – sie tun einfach, was Biologie eben so tut: reagieren.
Allerdings – die genetische Disposition darf man nicht ganz außer Acht lassen. Sie spielt am Ende die stille Regie hinter den Kulissen. Mit anderen Worten: Die DNA ist das Papier. Also die Lebensvorlage. Unser Lebensstil der Stift. Und wer raucht, der schreibt mit Feuer. Nichtsdestotrotz: Bewegungsmangel, Rauchen, Ernährung, Stress, Schlaf – sie bestimmen, ob und wann die genetische Anlage aktiv wird.
Apropos Angst. Sie ist ein schlechter Therapeut, aber ein exzellenter Marketingstratege. Sie verkauft gerne nutzlose Diätpläne und unnötigen Detox-Tee. Bewusstsein dagegen verkauft nichts – es verändert. Leise. Nachhaltig. In der Neujahrsvorsatz-Schlange „Nächstes Jahr fange ich wirklich damit an …“ da steht nie jemand lange an.
Den Satz „Mir wird schon nichts passieren“ habe ich nachvollziehbarerweise einkassiert. Ich nenne ihn ab jetzt: Wird mir bewusst passieren.
Mit klarer Absicht.
Halbzeit – ohne Halbzeitshow – 11. November 2025
Zehn Wochen. Siebzig Tage. Seit der Diagnose.
Acht Wochen seit Therapiebeginn.
Und – wenn alles nach Plan läuft – noch einmal siebzig Tage bis zur letzten Haarausfall-Provokationsinfusion.
Rein rechnerisch: Halbzeit.
Gefühlt? Irgendwas zwischen Verlängerung und Elfmeterschießen ohne Torwart. Ich wünsche mir, dass die Krebszellen das Tor so zuverlässig verfehlen wie Ulli Hoeneß 1976.
Halbzeit klingt nach Pause. Nach Durchatmen und motivierender Ansprache in der Kabine. Meine Halbzeit ist anders. Kein Pausentee, kein C-Promi-Konzert, keine Cheerleader. Nur Blutwerte, Medikamenten- und Infusionspläne und die immer gleiche Frage: „Wie geht’s mir, wie fühle ich mich heute?“ Diese Frage hatte ich mir früher nie gestellt. Nie stellen müssen.
Ich habe gelernt, dass Geduld keine Tugend ist, sondern ein Nebenprodukt der Ohnmacht. Ohne Macht zu sein – ein schlimmes Gefühl. Eine unbeabsichtigte Therapieform. Die einschneidendste Daseinsform für einen Schützen. Der Sagittarius handelt lieber als abzuwarten. Ich war bis dato eher so etwas wie notwendigkeitsgeduldig.
Nun ist Warten mein Job. Allerdings: Ich bin in der Ausbildungsphase. Warten auf Laborergebnisse. Auf die nächste Spritze. Auf die nächste Infusion. Auf die nächste Verschreibung. Auf den Tag, an dem das „Wie lange ungefähr noch?“ keine Rechenaufgabe mehr ist, sondern ein Kalenderblatt zum Abreißen. Das Kalenderblatt. Meine Gesellenprüfung.
Geduld schmeckt wie Tee, den ich nicht mag – ich trinke ihn trotzdem, weil ich nichts anderes tun kann. Daher kommt wohl auch: abwarten und Tee trinken. Allerdings habe ich mich bereits etwas an den Geschmack gewöhnt. Vielleicht schmecken mir ja Koriander und Trüffelöl doch irgendwann? Ich muss mich nur zwingen. You can do it, baby, you can do it. Klingt auch schon wieder nach einem neuen Song.
Es gibt diesen Satz: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
Ich ergänze: „Es gibt nichts Gutes, außer man sitzt es aus.“
Reimen war offensichtlich noch nie meine Stärke – Durchhalten schon.
Falsche Bescheidenheit
Neulich wurde ich von meiner immer-gut-druffen Nachbarin gefragt, wie’s mir ginge. Die Wahrheit, die ehrliche Antwort: top. Außer dem Doppel-J. Hey, geht doch – reimen kann ich jetzt doch. Ansonsten spielt die Krankheit keine Rolle. Null. Gepiekst, gedrückt und immer mal was kontrolliert – das war vorher auch schon so. Ich war ja schon immer leicht hypochondrisch veranlagt, nur dass ich jetzt endlich Belege dafür habe. Der medizinische Unterlagenordner ist mittlerweile 2,8 kg schwer.
Meine Antwort war trotzdem: „Na ja, ich will nichts beschreien.“ Man weiß ja nie – kaum spricht man das Wort „gesund“ zu laut aus, kommt der Boomerang aus der Reha-Abteilung zurückgeflogen. Reflexhaftes Understatement – fast schon ein Schutzschild.
Sie meinte nur: „So ’n Quatsch. Du musst dich feiern!“ Und da war er, der Moment, in dem ich kurz zwischen nüchterner Statistik und Konfetti hin- und hergerissen war. Feiern? Mich? Jetzt? Da war wieder diese leise Stimme der Vernunft: „Immer schön neutral bleiben, Herr Patient, sonst ist das Schicksal eventuell verärgert.“
Aber vielleicht ist genau das die falsche Vorgehensweise – immer auf das mögliche Schicksal Rücksicht zu nehmen statt auf mich selbst. Vielleicht ist Feiern gar keine Provokation, sondern absolut angemessen. Vielleicht feuere ich meinen Körper an, wenn ich ihm zeige, dass ich ihn mag und wertschätze. Vielleicht benötigt er extra Streicheleinheiten?
Also ja – vielleicht sollte man sich wirklich ab und zu feiern. Und genau das machte ich heute früh.
Ich habe mir Tickets für meinen Geburtstag gekauft – Tigerpalast Frankfurt. Vier-Gänge-Menü mit Show. Bühne, Musik, Magie, Lichter – das volle Leben. Ein Abend, der nach „Hier bin ich, willkommen, bienvenue, welcome“ schmeckt. Die Deutsche Bank wollte sich im Laufe des Tages noch bei mir melden, um die Kreditrückzahlungsmodalitäten für die Tickets zu klären. 6,37 % Ratenkreditzins ist ja noch relativ günstig. Von 120 Monaten Laufzeit hatte die Bankangestellte allerdings noch nichts gehört.
Ich lasse dort im Tigerpalast so richtig die Korken knallen. Nicht, weil alles top ist. Ist es ja wirklich nicht. Ich feiere mich selbst, weil es mich gibt. Je mehr man sein Leben lobt und feiert, desto mehr gibt es im Leben zu feiern. Und weil ich gerade ein wenig am Poetisieren bin:
Ich bin der einzige Mensch, mit dem ich mein ganzes Leben verbringe. Also behandle ich mich gut. Nein, sehr gut. Punkt.
Sollte der Boomerang zurückkommen, darf er sein Sperrholz halten und mitfeiern. Gegenrede fällt aus.
Ein Moment der Wahrheit naht – 12. November 2025
Die wahre Halbzeit kommt erst noch. In zwei Wochen. Dann werde ich wieder mal leicht kontaminiert strahlen. Ein PET-CT steht wieder an. Wer braucht schon regelmäßige Peelings oder exorbitant teure Feuchtigkeitspflege, um bezaubernd auszusehen? PET-CT mit natürlichem Q10 – für ein leuchtendes Lächeln.
Allerdings wird das verwendete radioaktive Isotop (18F-FDG) nur kurzzeitig in mir aktiv sein. Das meiste davon wird über die Nieren ausgeschieden. Halbwertszeit: etwa zwei Stunden. Anschließend werde ich auf dem Wochenmarkt noch ein paar Kisten Sellerie, Petersilie, Basilikum, Kresse und Zwiebeln erwerben, um meine beiden Blutreinigungsorgane wieder aufzupäppeln. Natur-Detox.
Am Tag darauf ist dann die tatsächliche Chemotherapie-Halbzeitbesprechung in der Klinik. Denn nach der dritten Runde Chemotherapie – am kommenden Montag – dürfen Technik, Urologen und Onkologen genau nachsehen, ob die Therapie Tiefenwirkung zeigt.
Das oben beschriebene PET-CT ist der Hercule Poirot unter den bildgebenden Verfahren – es spürt auf, was sich noch so gut versteckt: Tumorzellen, Metastasen in Lymphknoten und in den Knochen. Damit das Gerät weiß, wonach es suchen soll, bekommt der Körper vor der Untersuchung das Isotop serviert – sozusagen ein zuckersüßes und leicht radioaktives Gatorade, das sich dort sammelt, wo Zellen besonders aktiv sind. Und genau da wird’s spannend: Tumorzellen sind wahre Energiefresser. Sie nehmen mehr davon auf, leuchten auf dem Bildschirm heller – und verraten damit, wo sie sich verstecken.
Ich will allerdings nichts Leuchtendes mehr sehen. Die Metastasen dürfen sich gerne bis dahin den Leuchtstecker ziehen. „Zellentür zu, Licht aus.“ – Blackout im Metastasen-Zellblock sozusagen.
Darüber hinaus soll auch besprochen werden, ob der piesackende Untermieter ausziehen darf. Der Termin für den möglichen Auszug steht schon: 28.11.2025, 9:30 Uhr. Diesmal dann allerdings mit der extra Portion Propofol. 10 – 9 – Zzzzzzzz.
Bis dahin werde ich täglich brav meine 1,5 kg Pillen und Pülverchen zu mir nehmen. Meinen verbliebenen Haaren habe ich jetzt verschiedene Vornamen gegeben – das macht das Kämmen persönlicher. Warum mir die freundliche Verkäuferin in der Drogerie die Haarpflegespülung nicht verkaufen wollte, habe ich nicht verstanden. Sie sagte nur: „Sparen Sie sich das Geld.“
Na gut. Von dem gesparten Geld werde ich mir ein bisschen Hoffnung kaufen. Gibt’s nicht in der Drogerie – aber auf Rezept.
Vom Leben.
Anima Sana in Corpore Sano – 13. November 2025
Damit wäre ja dann alles gesagt und Verschwörungstheorien à la „Also, ich glaube ja, der Robert ist so, weil …“ haben sich dadurch erledigt. „Eine gesunde Seele in einem gesunden Körper.“ Die sich selbsterklärende Schlussfolgerung überlasse ich an dieser Stelle den Lesern.
Fronti und ich waren wieder einmal ein wenig am Introspektieren und fühlten in uns hinein. Was war das für ein Geräusch? Ah, mein Kleinhirn war wieder im Aktivmodus. Boing. Quietsch. Boing. Quietsch. Boing. Quietsch. Die Halbzeitchemo hatte die Turnschuhe in die Ecke geschnickt und begann mit dem Geltungsdrangtraining. Hoch. Höher. Noch höher. Bis auch wir sie nicht mehr ignorieren konnten. Die blau-rot-weißen Frotteesocken sahen allerdings zum Fremdschämen aus. Das Hinterhirntrampolin dann bitte bei Gelegenheit mal mit WD-40-Fettspray nachschmieren.
Ja, in fünf Tagen ist es wieder so weit. Bo-Frosten Nummer drei, und ich nehme jetzt schon mal vorsichtshalber Abschied von meinen verbliebenen zwölf Kammfrisurhaarfreunden Marky, Ricky, Danny, Terry, Mikey, Davey, Timmy, Tommy, Joey, Robby, Johnny und Brian. Schön war’s. Hasta la vista.
Es ist immer wieder interessant, wie schnell mir Gedanken in das eigentliche Körpergefühl grätschen. Ich bin – quasi – wieder völlig der Alte sozusagen – und fühle mich gut. Doppel-J ignoriere ich ja seit einiger Zeit und die Hitzewallungen haben jetzt im Herbst auch einen wesentlichen Vorteil. Ich kann auch bei einstelligen Graden im Rippenstrick durch die Gegend laufen. Jacken sind überbewertet.
Allerdings: Kaum lese ich eine Headline oder höre etwas im Radio, das im Entferntesten mit Krebs zu tun hat – zack und schon klopft die Panikattacke wieder hauchzart an meine Bewusstseinstür. Sprichwörtlich von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt.
Der Tod sitzt nun seit einiger Zeit mit am Tisch. Meistens vergesse ich, dass er da ist. Er redet nicht, aber er hört – und sieht vielleicht zu, wie ich mit meinem Leben, den Momenten umgehe. Die eindrückliche Antwort der Figur Joe Black – des personifizierten Todes – aus dem Film „Rendezvous mit Joe Black“ auf die Frage von William Parrish „Werde ich sterben?“ lautet: „Ja.“
Man – auch ich – vergisst das gerne und immer wieder. Eine unvorhergesehene Diagnose sollte nicht notwendig sein, um zu wissen, zu fühlen, dass die Liebe zum Leben die wahre Leidenschaft sein sollte, nach der man sucht.
Und um das folgende Zitat im Robert-Shakespear’schen Sinne etwas umzumodeln: „Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht und Leiden schafft.“
Hier die Robertoversion:
Die Liebe zum Leben ist eine Leidenschaft, die mit Leichtigkeit sucht – und Freu(n)de schafft.
Hey, Shakespeare hat auch mal klein angefangen. Erst sein Sonett 18 wurde weltberühmt. Wer kennt schon die Versionen 1 bis 17?
Sag ich doch.
Wannabe Look-Alike – 14. November 2025
Abwechslung ist der schönste Zeitvertreib. Besuch aus Berlin stand an. Fahrradfahren und Philosophieren – das volle Programm. Wir kennen uns schon seit den Achtzigern – da gehen die Themen nie aus. Pedalieren mit Gesprächspflicht.
Trotz der 344 Päckchen Butter, die ich immer mit mir herumschleppe, habe ich mir irgendwann redlich den Radlerspitznamen „Bergziege“ verdient. Udo Bölts brachte es 1997 während der Tour de France auf den Punkt: „Quäl dich, du Sau.“ Klingt zwar etwas un-woke, allerdings lag er damit goldrichtig. Sein Teamkapitän Jan Ullrich gewann danach die Tour. Ich gewinne mit dieser Maxime vielleicht noch die „Mit Erfolg teilgenommen“-Urkunde, aber die vereinfachte Form des olympischen Gedankens ist am Ende die, die zählt: Dabei sein ist alles.
„Sagt mal, hab ich euch eigentlich schon die Geschichte erzählt, als ich damals mit dem Rad – ich glaube es war 1981 – von ähm, wo war das noch mal …?“
Im ersten Arztgespräch nach der Diagnosestellung hieß es, ich würde durch die Hormontherapie Testosteron, Muskelmasse und dadurch Kraft verlieren – und wahrscheinlich ebenso meine Oberkörperdefinition. Ha, ich wusste gar nicht, dass ich eine hatte. Egal. Danach vernahm ich noch, dass ich Männerbrüste bekommen könnte. So geht die einseitige Gleichstellung der Geschlechter. Meinem Namen fehlt dann nur noch das „a“.
Trenantone und Darolutamid – das Dreamteam der Gleichmacher. Entmännlichung mit System. Meinem Körper wird die Testosteronproduktion nun komplett blockiert. Ich höre mir gleich mal den Song von Dax an: Man I used to be.
Ich sehe im Spiegel eigentlich noch so aus wie früher. Also gut, mein Resthaar … aber mein Körper – die gleiche Form, gleiche Muskeln, gleiches Gewicht. Nur dass jemand offenbar fast alle roten Blutkörperchen aus meinem Blut abgesaugt und dafür flüssigen Zement reingespritzt hat. Sieht optisch gut aus, aber komplett nutzlos. Speziell im Bergziegenmodus.
Früher bin ich mit dem Rad Berge hochgeflogen – jetzt bin ich froh über jeden Sightseeing-Spot in der Natur. „Du, warte mal kurz, das sieht echt schön aus. Ich mach’ mal schnell ein Foto.“ Ich bin nur noch ein Wannabe-Look-Alike. Die Biochemie hat im Hintergrund die Lichter gedimmt. Der Weg ist das Ziel. Ja, man kann es sich auch schönreden. Ich googelte derweil schon mal camouflierte E-Bikes. Wäre doch gelacht.
In vielen Kulturen symbolisiert die Dunkelheit die Transformation.
Euch allen noch einen schönen Tag – eure Roberta.
Bilder im Kopf
Mein Blog von vor ein paar Tagen beschäftigte mich weiter. Ich hatte vorgestern ein gutes Gespräch, das nachhallte. Wir unterhielten uns über das Thema Krebs versus Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das Missverhältnis der Angst – bezogen auf die Sterblichkeit. Das Thema hatte ich ja schon einmal beschrieben.
Wir wissen: Statistisch betrachtet sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die deutlich häufigere Todesursache. Und doch ist der Krebs derjenige, vor dem wir uns fürchten. Mein Freund brachte eine Erklärung, die hängen blieb: „Vielleicht weil man ihn einfach zu oft gesehen hat. Zu viele Bilder, zu viele Geschichten, zu viele Gesichter.“
Wir alle tragen Bilder im Kopf, sobald wir das Wort Krebs hören. Köpfe ohne Haare. Infusionsständer. Krankenhausneonlicht. Hoffnung und Rückschlag, Sieg und Niederlage – alles innerhalb weniger Sekunden, zusammengeschnitten zu einem kollektiven Film der Angst. Krebs ist in unserer Wahrnehmung kein medizinischer Begriff mehr. Er ist ein Synonym für Kontrollverlust. Ein fast unsichtbarer Feind. Der Krebs bleibt still – und genau das macht ihn so laut in unseren Köpfen. Mein Gesprächspartner hatte recht – es sind die Bilder, die wirken.
Vielleicht spielt auch die mediale Inszenierung eine Rolle. Krebs lässt sich erzählen – in Reportagen, in Filmen, in persönlichen Geschichten. Das Herz dagegen hat keine gute Dramaturgie. Es stoppt. Es ist vorbei. Das ist keine Geschichte, das ist eine Schlagzeile. Krebs dagegen ist wie ein Roman, eine Serie, unzählige Geschichten. Die Kapitel: Schock, Hoffnung, Schmerz, Therapie, Rückfall, Überleben, Tod.
Geschichten bleiben. Sie werden weitergetragen, wiederholt, ausgemalt – und irgendwann zu kollektiven Wahrheiten. Man muss sie nur oft genug wiederholen. Bilder im Kopf. Man kann sich fast nicht dagegen wehren.
Hat jemand gerade „Stadtbild“ gesagt? Da reicht manchmal schon ein Wort – und alle denken an etwas anderes. „Fragen Sie mal Ihre Töchter …“
Eventuell hat Krebs ein Branding-Problem – oder besser gesagt einen Branding-Erfolg, leider nur im falschen Sinne. „Marketing der Angst“ als Markenbildung.
„Wir dachten, sie wäre durch … doch nur zwei Wochen später …“
Solche Sätze bleiben hängen. Sie schaffen Narrative, die stärker sind als jede Statistik. Der Herzinfarkt dagegen ist – brutal gesagt – ein alltagstauglicher Schrecken.
Ich habe gelernt, dass man die Bilder im Kopf nicht löschen kann. Aber man kann neue hinzufügen. Auch ich kann das. Ich mache das – jeden Tag. Bilder von mir – so, wie ich jetzt bin. Im Augen- und Innenblick. Und Bilder von Menschen um mich herum, die leben, trotz allem. Von Tagen, die gut sind. Von Momenten, in denen Angst keine Rolle spielt. Von Lachen in Wartezimmern. Von Kaffee mit Freunden. Vom In-der-Natur-Sein. Neue Bilder eben.
Es geht nicht darum, die Angst vor Krebs zu besiegen, sondern vielleicht darum, die Geschichte, die wir über sie erzählen, neu zu schreiben. Eventuell sollten wir einfach weniger über Angst reden – und mehr über den Umgang mit der Krankheit. Mit den Menschen. Angst ist ein schlechter Lebensberater, aber ein hervorragender Drehbuchautor. Es ist Zeit, das Drehbuch umzuschreiben.
Mit klarem Sehen. Mit Gelassenheit. Mit mehr Licht zwischen all den Schatten.
Die Macht der Bilder.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – 15. November 2025
Selbstliebe ist die schönste Liebe. Roberto Goldmundo – auf Erlebenswanderschaft. Liebe, Leiden und der schöne Rest des Lebens. Mein Narziss hat mir das ja auch so beigebracht. Ich wollte mir wieder mal etwas Außergewöhnliches gönnen. Verwöhnen lassen stand auf dem Programm. Die letzte Massage lag schon Monate zurück und alle beteiligten Körperpartien votierten einstimmig für professionelles Durchkneten von Haut, Faszien und Muskulatur. Ich lag innerlich bereits auf dem Massagetisch, konnte das entspannende Meeresrauschen aus den Lautsprechern hören und das warme Kokosnussöl auf meiner Haut spüren. Totale Hingabe.
„Sorry, Krebspatienten dürfen wir leider nicht behandeln.“
Die Spa-Managerin sah zwar mitfühlend aus, aber sie war nicht zu überreden. Ich befand mich in einer Überzeugungs-Sackgasse. Habe ich am Ende neben meinen Haaren auch meinen Charme verloren?
Früher hieß es „Der Robert verkauft bestimmt auch Eskimos Kühlschränke.“ Ups – das darf ich so ja nicht mehr schreiben. Also gut, heute hieße das: „Der Robert verkauft bestimmt auch den Inuit, den Inupiat, den Sugpiaq und den Yupik Kühlschränke.“ So geht diskriminierungssensible Sprache. Konform mit der Norm.
Die Wellness-Abteilungsleiterin war unnachgiebig und im Umsatzverhinderungsmodus. Oder es lag an mir und sie wollte mich nicht als Kunden. Verspannt verließ ich wieder das Spa und bat die Kah-ieh um Aufklärung. Hier die Roberto Zusammenfassung:
„Krebspatienten dürfen wir leider nicht behandeln.“ Übersetzt hieß das: „Wir finden Sie sehr nett, aber unsere Haftpflichtversicherung findet Sie schwierig.“ Es ist nicht die Massage, die gefährlich ist. Keine Hand verschiebt Metastasen durch den Körper oder in den Blutkreislauf. Aber mein Körper ist unter Therapie empfindlicher: Blutwerte, Kreislauf, Haut, manchmal Lymphsystem – und Wellness-Therapeuten sind nun mal keine Onkologen. Also sagen sie lieber grundsätzlich ab, statt individuell zu überlegen. Nicht weil sie mich schützen wollen. Sondern weil sie sich schützen müssen.
Die Wahrheit ist: Eine Massage würde meinem Krebs nichts ausmachen. Hände massieren keine Tumorzellen durch den Körper, sonst wären alle Krebspatienten schon nach dem Duschen tot. Was passieren kann, sind eher harmlose Dinge: eine Blaue-Flecken-Versammlung unter der Haut, ein kurz nachgebender Kreislauf, ein Lymphstau, wenn man an der falschen Stelle drückt, oder irgendeine andere Hautreaktion. Nicht dramatisch – aber eben etwas, das ein Massage-Therapeut weder beurteilen noch verantworten kann.
Also dann ist eben Selbstliebe angesagt. In der Drogerie gibt es bestimmt Kokosnussmassageöl. Wie ich mir allerdings selbst den Rücken massieren soll …?!
Seit knapp elf Wochen komme ich mir vor wie A-Hörnchen in der Sammler-Saison. Ich muss mir jedes Krankheits-Erfahrungsnüsschen selbst suchen. Mühsam. Sehr.
Und hinzu kommt: Einige dieser Erfahrungsnüsschen schmecken mir überhaupt nicht.
Die Endlichkeit in der Unendlichkeit – 16. November 2025
Gestern war ein Spätspätsommerabend – na gut, eher schon ein sommerlicher Herbstabend. Ich lag angenehm entspannt auf meinem – nach wie vor unmassierten – Rücken im noch sonnenuntergangswarmen Gras und blickte ziellos in den dunklen Nachthimmel. Um mich herum – niemand. Nur mein steter Begleiter Tinnitus piepste wie immer unermüdlich in meinen Ohren. Auf ihn ist Verlass. Das macht er jetzt schon seit über 37 Jahren. Eine gefühlte Unendlichkeit.
Über mir die wirkliche Unendlichkeit. Zumindest das, was wir Menschen darunter verstehen. Ein paar Sterne blinkten, als wollten sie mich daran erinnern, dass sie schon geleuchtet haben, als es mich noch gar nicht gab. Mein Leben ist – erdgeschichtlich gesehen – nicht mal ein Wimpernschlag. Eine kaum messbare Störung im Kontinuum der Zeit.
Der Was-ist-Was-Robertiño in mir kann’s einfach nicht lassen: Die Erde entstand vor etwa 4,55 Milliarden Jahren. Der Mensch – Homo sapiens, der unvernünftige Mensch – existiert vielleicht seit 300.000 Jahren – danke, KI. Und ich? Ich existiere seit knapp einundsechzig Jahren. Das sind, rein rechnerisch, 0,0000065 Prozent der Menschheitsgeschichte. Selbst mein Taschenrechner hat da Mitleid und schaltete sich einfach ab.
Und trotzdem bin ich – aus meiner Perspektive – das Zentrum der Welt. Meiner Welt. Ich sehe, denke, fühle. Also bin ich. Ich messe meinen Kosmos in Jahren, Tagen, Stunden, Atemzügen. Das ist menschlich. Und gleichzeitig absurd.
Manchmal frage ich mich, was „Sinn des Lebens“ überhaupt heißen soll. Wir rennen durchs Leben, bauen, planen, versichern uns gegen alles – und vergessen, dass wir in der größten Unsicherheit leben, die es gibt: dem Zufall. Nikolas Taleb hat es schön auf den Punkt gebracht: Das Leben ist nicht planbar, sondern eine Ansammlung von Zufällen, die im Rückblick wie Absicht aussehen.
Wenn meine Eltern sich an einem anderen Abend, in einer anderen Stimmung, an einem anderen Ort begegnet wären – wer wäre ich dann? Hätte ich dann jetzt auch Krebs? Oder gäbe es mich gar nicht? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau hier bin, ist mathematisch fast unmöglich. Und trotzdem bin ich da. Atme. Denke. Schreibe. Ein biologischer Zufall. Wie alle anderen Mitbewohner dieses Planeten.
Geography is destiny, sagt man. Ich hätte überall geboren werden können – in Armut, im Krieg, im Hunger. Aber ich wurde hier geboren, in einem Teil der Welt, der mehr Glück als Verdienst ist. Etwa ein Zehntel der Menschheit lebt in dieser sogenannten „Ersten Welt“ – oder, wie man sie heute nennt, dem globalen Norden. Die anderen neun Zehntel leben zur gleichen Zeit, aber in völlig anderen Realitäten. Und trotzdem teilen wir denselben Himmel, dieselbe Zeit, denselben Planeten. Wie absurd, dass die gleiche Sonne über Luxuswohnungen und Wellblechdächern aufgeht.
Ich weiß, dass ich privilegiert bin. Sehr sogar. Das sagt sich so dahin. So richtig verstehen und begreifen kann ich dieses Privileg nicht. Und ich weiß, dass auch das Zufall ist. So wie alles.
Wir halten unser Leben für planbar, als ob es eine Logik dahinter gäbe. Wir machen Pläne, optimieren Routinen – aber auch das Schicksal ist zufällig. Ein Schritt zu früh, ein Blick zu spät, eine falsche Abzweigung, ein verpasster Flug – und schon ändert sich alles. Vielleicht rettet uns dieser Zufall, vielleicht zerstört er uns. Und genau das macht das Leben so unplanbar lebendig.
Ich habe Menschen getroffen, die haben im Prinzip sehr vieles „richtig“ gemacht – und dann kamen schwere Krankheiten. Krebs. Spieglein, Spieglein an der Wand. Und andere, die alles „falsch“ machten – und ewig gesund blieben. Die Gleichung geht nicht auf. Vielleicht soll sie das auch gar nicht.
Wenn man lange genug in den Himmel schaut, versteht man irgendwann, dass wir Teil von etwas sind, das keine Absicht braucht, um zu existieren. Die Sterne fragen nicht, ob wir an sie glauben. Sie leuchten einfach. Das Absurde: Viele von ihnen sind längst erloschen. Wir sehen sie trotzdem noch, weil ihr Licht weiterhin unterwegs ist – seit Millionen von Jahren durch das Nichts. Die Quelle selbst: häufig ein schwarzes Loch.
Vielleicht ist das der eigentliche Frieden: zu wissen, dass wir eigentlich nichts wissen – und trotzdem weitermachen. Wir lieben, lachen, essen, streiten – alles kleine Akte des Trotzes gegen die kosmische Gleichgültigkeit.
Ja, das Leben ist absurd. Aber vielleicht liegt genau darin sein Sinn: dass wir dem Zufall Bedeutung geben, dass wir ihm Geschichten schenken – und dass wir aus der Unwahrscheinlichkeit unseres Daseins etwas machen, das nach uns bleibt. Selbst wenn es nur eine Spur im warmen Gras ist, in dem ich einmal gelegen habe – und in den Himmel blickte.
„Das Leben ist wirklich einfach, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen.“
– Konfuzius
Eine Prospektive – 17. November 2025
Dröpje voor Dröpje Kwaliteit. Wer kennt diesen Werbespruch von 1973 noch? Welche Marke? Na? Eigentlich hätte es ja lauten müssen: Druppel voor druppel kwaliteit. Das holländische Original klang den deutschen Werbern aber wahrscheinlich nicht Deutsch genug. Docetaxel, mein Chemotherapeutikum, klingt eher wie Latein, das in Frankreich Urlaub gemacht hat. Ergo: Docetaxel – La qualité goutte à goutte. So geht Headline. Werbung hat mich nachhaltig beeinflusst. Von „zum Guten“ hat keiner was gesagt.
Heute ist es wieder so weit. Die dritte Runde Docetaxel steht vor der Tür. Besser gesagt bereits in der onkologischen Abteilung. Ab 12 Uhr wird auch hier wieder gedröpjet. Druppel voor Druppel. Die Metastasen können sich schon mal warm anziehen. Chemohalbzeit also. Ich bin seit neun Wochen in Therapie. Zeit für einen Blick hinter die Therapiekulissen. Dorthin, wo mein Körper seit Wochen seinen stillen Kampf führt, was bis jetzt passiert ist und was wahrscheinlich noch passieren wird.
Mein Testosteron liegt praktisch bei null. Das bedeutet: Die Tumorzellen sind auf Diät gesetzt. Keine Nahrung – kein Wachstum. Der Tumorstoffwechsel-Club wurde geschlossen. Permanent geschlossen. Wünschenswerterweise.
Der PSA-Wert ist von 15,3 auf 0,5 gefallen. Ein Absturz, der selbst an der Börse als historisch gelten würde. Minus 97,6 %. Ein Total-Crash.
Die Bestrahlung der Metastasen in meinen Knochen vor sechs Wochen tut noch immer ihren Job und wirkt nach. Die Zellen sterben langsam ab, werden vom Körper abgebaut und durch Narbengewebe ersetzt.
Die Chemotherapie hat mit bereits zwei Zyklen die sich schnell teilenden Tumorzellen aus dem Verkehr gezogen. Die großen Effekte sieht man normalerweise erst ab Zyklus drei oder vier, aber die Vorarbeit ist schon mal geleistet. Die Zellen, die bisher noch nicht in Panikstarre geraten waren, werden jetzt auch erwischt. Die Lebenszeit der Metastasen verkürzt sich – weniger Zellteilung, mehr Zelltod. Einmal letzte Ölung bitte.
Die letzten Blutwerte zeigen, dass die Gesamttherapie das tut, was sie soll. Insofern sieht die Halbzeitbilanz gut aus. Apropos gut aussehen: Mit nur noch zwölf Haaren auf dem Kopf ist die B-Note für meine Optik – sagen wir mal – ausbaufähig.
Und wie geht’s weiter?
Die zweite Halbzeit der Therapie beginnt mit einer Art medizinischem Feinschliff. Darolutamid blockiert weiter als Türsteher die Testosteron-Androgenrezeptoren. „Sorry, mit dreckigen Cowboystiefeln kommen sie hier nicht rein.“ Die bestrahlten Metastasen bearbeiten somit ihre eigene Abbaubaustelle. Tochtertumore-Dekomposition.
Ab jetzt geht es also um die stillen Mitläufer im Hintergrund – die gehofft hatten unerkannt zu bleiben. Die letzten drei Zyklen der Chemotherapie sind die Aufräumkolonne. Singapur als Vorbild. „Sorry, da liegen noch ein paar Mikrometastasen. Bitte auch entfernen, danke sehr. “
Nach Abschluss der Chemo wird mein Körper weiterarbeiten – monatelang. Die Chemo wirkt nach. Langsam, gründlich, unaufgeregt. Parallel dazu hält der Hormonentzug die Tumorzellen im Winterschlaf. Kein Testosteron, kein Aufwachen.
Kann man die Prostata danach entfernen? Eine OP verbessert manchmal die Kontrolle, manchmal vertieft sie den PSA-Nadir, also den tiefsten erreichbaren PSA-Wert, manchmal auch den Schlaf. Der ursprüngliche Tumorherd wäre damit weg. Das Krebshauptquartier für immer geschlossen. Aber die OP kostet unter Umständen auch Lebensqualität. Inkontinenz. Erektionsfähigkeit. Ein anderes Körpergefühl – speziell beim Sitzen. Ein Deal, den ich sehr bewusst abwägen muss. Ich will leben – aber auch leben. Und genau zwischen diesen beiden Polen liegt die Entscheidung. What do you win – what do you lose?
Und Drahti Kathi – mein friedenstörender Katheter? Der könnte dann hoffentlich in knapp zwei Wochen auch au revoir sagen und nicht à bientôt.
„Nein, gar nichts. Nein, ich bereue nichts.
Weder das Gute, das mir angetan wurde, noch das Böse.
Das ist mir alles egal. Nein, gar nichts. Nein, ich bereue nichts.“
Non, je ne regrette rien.
– Édith Piaf
Men-o-Pause – 18. November 2025
Neulich sah ich eine ausgesprochen zauberhafte Frau. Direktes Ansprechen stößt bei mir traditionell an Grenzen — ich bin ja eher der schüchterne Typ. Dass sich diesmal meine dezente Frauen-Sozialphobie sofort in einem spontanen Schweißausbruch äußerte, war mir allerdings neu.
In der Sauna wurde es nicht besser: Alle saßen entspannt herum und wunderten sich, warum das Schwitzbad so kühl blieb — nur ich hatte das Gefühl, dringend von innen gegossen werden zu müssen. Mein Wasserkessel begann schon zaghaft zu pfeifen. „Oh, the tea is ready, my dear“.
Ein paar Tage später reichte schon der Gedanke, zwei antike Schaukelstühle durchs Haus zu tragen, um mich in einen Modus Duscholux zu verwandeln. Ich sah schon vor dem Möbeltransport aus, als stünde ich unter einem tropischen Regenwald-Duschkopf.
Es lag weder an ihr noch an der fehlenden Hitze, noch war es die Aussicht auf körperliche Arbeit. Ich kam mir vor wie in einer Episode der britischen Serie „Das Haus am Eaton Place“: „Sir, the hot flashes have been served. Can I offer you anything else?“ Ohne Zweifel, höflich sind sie, meine Hitzewallungen. Maybe they’re British.
Wie immer, wenn mein Körper etwas Eigenartiges veranstaltet, will ich verstehen, was da eigentlich passiert. Conclusio: So plötzlich wie diese Schweißattacken kommen, so logisch sind sie im Grunde auch. Fragen Sie eine Frau oder Ihren Apotheker.
Seit Wochen arbeitet meine Kombi-Hormontherapie zuverlässig in meinem Körper. Das Testosteron ist praktisch auf null und hat sich verabschiedet. Und selbst wenn irgendwo noch ein verlorenes Molekül herumgeistert, kann es nicht mehr andocken und seine Wirkung zeigen. Spiel, Satz und Sieg für mein ADT-Doppel.
Was sich indes ebenfalls verabschiedet hat, ist meine körperliche Temperatursteuerung. Normalerweise hält das Testosteron den Hypothalamus – sozusagen den Hausmeister der inneren Temperatur – freundlich, aber bestimmt im Zaum. Ohne dieses Hormon beginnt der Hypothalamus sich zu verhalten wie ein übermotivierter Praktikant am ersten Arbeitstag, der dringend zeigen möchte, dass er die Heizung allein bedienen darf: „Ist ihm heiß? Kalt? Beides? Gar nichts? Ich drücke einfach mal alle Knöpfe!“ Der Hypothalamus glaubt also fälschlicherweise, dass mein Körper überhitzt. Sofort greift das Notfallprotokoll: Gefäße weit stellen. Herzfrequenz hoch. Schweißproduktion maximal.
Und genau so fühle ich mich an: Plötzlich schießt Hitze durch meinen Körper, als hätte jemand einen Liter Chiliöl in die Blutbahn gekippt. Es passiert einfach so. Ohne Warnung. Ohne Rücksicht auf soziale Situationen. Die Chemotherapie trägt übrigens ihren Teil dazu bei, stresst den Stoffwechsel und fordert das Nervensystem heraus. Die Hitzewallungen sind ein Zeichen, dass die Behandlung wirkt. Das Glas ist also halb voll. „Herr Ober, gerne noch mal auffüllen, danke.“
Frauen machen das seit Jahrtausenden durch und managen nebenbei Haushalte, Kinder, Karrieren und den Weltfrieden. In der Theorie wissen Männer das. Wir Männer sind evolutionär betrachtet hormonell schlicht nicht darauf vorbereitet.
„Sag mal Elke, warum bist du denn schon wieder so gereizt? Und warum schwitzt du jetzt so? Alles in Ordnung?“
Und zum Thema „Lebensentdeckungsreise“: Mein neuer Lieblingsort? Das 8-Grad-Tauchbecken des Spa. Am besten Eismeer-Pinguin-Temperaturlevel. An Bo-Frosten habe ich mich ja mittlerweile gewöhnt – mein Körper kennt inzwischen nur noch zwei Aggregatzustände: unfreiwillig kochen und freiwillig frieren.
Hitzewallungen sind ein Zeichen dafür, dass die Hormontherapie wirkt, und das Beste: Sie gehen meistens wieder vorüber. Die meisten Männer berichten, die Symptomatik ist schon wesentlich seltener nach 3–6 Monaten und nach 6–12 Monaten bedeutend schwächer.
Tja, da habe ich nicht ganz so viel Glück abbekommen. Glas eher halb leer, denn ich gehöre zur letzten Gruppe. Für die gilt: Unter einer lebenslangen Therapie werden die vasomotorischen Symptome – also das chaotische Zusammenspiel von Blutgefäßen, Wärmeempfinden und Schweißdrüsen – erträglicher. Egal, sie bleiben ja nur so 1–10 Minuten und verschwinden wieder, als sei nichts gewesen.
„Elke, möchtest du JETZT mit mir darüber sprechen? Elke?“
At the end of the road
Wenn man geboren wird, hat man exakt null Mitspracherecht. Eltern aussuchen? Fehlanzeige. Lieferdatum verändern? Nicht vorgesehen. Das Leben beginnt im Zwangsmodus.
Danach geht es so weiter. Kinderwünsche werden mit dem universellen „Nein!“ abgewehrt – auch in Variationen: „NEIN!“ „Auf gar keinen Fall!“ „Ich zähle jetzt bis drei!“ Erst in der Pubertät erringen Jugendliche ihre ersten kleinen Siege. Das berühmte Eskalationsprinzip. Am Ende geben die Eltern auf – nicht aus Einsicht, sondern aus Erschöpfung.
Mit 18 ist man volljährig, lebt aber meist noch im guten alten „Hotel Mama“. „Solange du deine Schuhe unter meinen Tisch stellst …!“ Der Klassiker. Born free gab’s immerhin als Serie in den Siebzigern — frei war man dabei allerdings nur vor der Realität.
Dann der Führerschein. Falls man den besteht – heute ja keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Autovermieter setzen noch eins drauf: Mindestalter 21. Also wieder hinten anstellen. Ab 21 jedoch darf man – juristisch gesehen – endlich „machen, was man will“.
Alkohol trinken. Rauchen. Drogen ausprobieren. Jeden Tag beim Mäckes essen. Und auch lebensgefährlichen Hobbys nachgehen. Alles erlaubt. Alles legal. Die Krankenversicherung fängt einen immer auf. Solidaritätsprinzip. Prävention? Ein hübsches Konzept, das in der Realität bestenfalls angewendet wird wie gute Vorsätze zu Silvester. Kurz: Mit dem eigenen Körper darf man alles anstellen. Da mischt sich niemand ein. Theoretisch.
Denn eines darf man nicht: selbstbestimmt entscheiden, wann man gehen möchte, wenn man wirklich nicht mehr mag. Zumindest nicht ohne längeren Hürdenlauf. Der Suizid selbst ist straffrei – die Begleitung jedoch streng reguliert, moralisch überfrachtet und politisch vermint. Das Strafrecht beginnt erst dort, wo eine andere Person beteiligt wäre. Man darf tot sein wollen. Aber niemand darf einem helfen, diesen Willen geordnet umzusetzen. Ein Paradox, das niemand so richtig erklären kann.
Und dann kam diese Meldung – am 17. November 2025. Die Tagesschau berichtete über das berühmte Duo: Alice und Ellen Kessler – beide 89 – gemeinsam in München gestorben. Die Formulierung klang wie die Ankündigung eines synchronen Herzinfarkts. Oder eines eleganten Doppeltanzschrittes in die Unendlichkeit. Oder hatten die einen Autounfall? Echt jetzt? Fehlte da nicht das Wesentlichste?
Erst im Kleingedruckten der Berichterstattung tauchte die ganze Wahrheit auf: Die beiden hatten assistierte Sterbehilfe in Anspruch genommen. Der Tod der Kessler-Zwillinge zeigt dieses Paradox wie ein Brennglas: Sie haben etwas heimlich getan, das offiziell erlaubt ist, aber praktisch kaum zugänglich. Ein Detail, das offenbar so diskret war, dass es der Redaktion zwischen die Nachrichtenspalten gefallen ist. Nebensächlichkeit. Kann passieren. Sollte es aber nicht. Oder ist es vielleicht ein gesellschaftlicher Reflex? Sterben ja – aber bitte ohne Philosophie. Ohne Debatte. Möglichst geräuschlos.
Da musste ich unweigerlich an meine eigenen Themen denken: Leben. Krankheit. Tod. Und die Frage, die sich zwischen diesen drei Polen immer wieder stellt: Wie viel Kontrolle haben wir – habe ich – eigentlich? Und wo halten wir nur an der Illusion fest, sie zu besitzen? Ich möchte gehen dürfen, wenn ich nicht mehr mag. Ohne Hürdenlauf. Ohne Strafrecht. Ohne moralischen Zeigefinger.
My body, my choice.
Die Tagesschau – die erste Adresse für Nachrichten und Information: an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr aktualisiert – die wichtigsten News des Tages.
Bitte wörtlich nehmen.
Auch Fortecortin verleiht Flügel – 19. November 2025
Wenn man mal wieder keine Lust auf Schlaf hat – Fortecortin. Man wartet vergeblich auf den Übergang in die Hypnagogie, also dieses sanfte Absinken kurz vor dem Traum, und bekommt nicht einmal einen Gähnimpuls. Man liegt hellwach im Bett oder schaut sich die komplette Mission-Impossible-Saga auf der Couch an. Genau das hatte ich getan. Meinen viel zu hohen Blutdruck konnte ich der onkologischen Abteilung vorgestern früh daher gut erklären. Die letzten schlaflosen Nächte hatten einen Schuldigen. Fortecortin. Brauche ich ab jetzt nicht mehr zu nehmen. Und tschüss. Heute Abend werfe ich zwei, drei Zolpidem ein – dann schlafe ich wie ein Alpenmurmeltier.
Die dritte Chemo verlief komplikationslos. Hände und Füße sind zwar erst wieder halb aufgetaut, aber ansonsten verlief alles in einer fast vertrauten Routine. Ich fühle mich dort fast schon familiär aufgehoben. Das Team der Onkologie besteht ausschließlich aus aufmerksamen, hilfsbereiten und unglaublich freundlichen Mitarbeiterinnen. Therapeutische Geborgenheit. Fehlen nur noch ein Schnuller und ein Mobile mit Schmetterlingen über dem Behandlungsstuhl.
Was hat mein Körper zwischen Chemorunde zwei und drei gemacht? Kurz: erstaunlich viel.
Gesamtfazit:
Blutbild – Knochenmark im Marathonmodus
Leukozyten hoch, Neutrophile sehr hoch – genau so sieht ein Knochenmark aus, das unter Chemo Vollgas gibt.
Elektrolyte – alles im grünen Bereich
Natrium, Kalium, Calcium – alles so sauber, dass man es einrahmen möchte.
Sexualhormone – ADT trifft voll ins Ziel
Testosteron praktisch nicht mehr messbar – mein endokrinologischer Winter hält.
Rote Blutkörperchen & Hämoglobin
Etwas niedriger, aber absolut normal unter Chemo. Keine Anämie.
Thrombozyten – stabil wie eine Zugspitze
Kein Blutungsrisiko.
Nieren – laufen wie ein Schweizer Uhrwerk
Kreatinin top, GFR top.
Leber – entspannt, bis auf einen Wert
AST, ALT, GGT, AP alles ruhig. LDH leicht erhöht – bei Chemo völlig typisch, das zeigt, dass Zellen abgebaut, umgebaut oder repariert werden.
Tumormarker – ohne Auffälligkeiten
Kein Hinweis auf andere Tumorquellen.
Und dann der PSA. Meine Diva. Immer ein bisschen dramatisch und leicht beleidigt. Ein sensibler Marker mit einer Vorliebe für Theater. Er reagiert auf alles: Medikamente, Stress, Labore, den Mondstand. PSA heute: 0,76 (vor zehn Tagen: 0,50). Ich wollte schon wieder meinen Patientenverfügungsordner alphabetisch neu sortieren.
Die Wahrheit: ja, leicht gestiegen. Aber anderes Labor, andere Maschinen, andere Kalibrierung – PSA ist kein absoluter Wert. Und ADT + Chemo erzeugen kleine PSA-Flare-Effekte. Unter 1,0 befindet man sich im onkologischen Sonnenscheinbereich. Der Trend ist entscheidend – und der ist seit Monaten massiv fallend.
Und dann schrieb mir ein guter Freund gestern diese Nachricht:
„Ich freue mich, dass die Entwicklung in die richtige Richtung läuft – was mir klar war. Du bist dem Krebs einfach zu unbequem.“ Solche Sätze wirken besser als jedes Kortison.
That’s what friends are for.
Der Kreislauf des Lebens
Eben gerade hatte ich ein unbeschreibliches Gefühl. Eine Art tiefstes Begreifen – ganz innen, jenseits von Sprache und Worten. Pure Energie.
Ich spürte ganz klar, dass ich dieses Leben – mein Leben – irgendwann verlieren werde.
Ein Gefühl, als hätte mich eine riesige Welle mitgerissen. Und obwohl ich die Luft anhalte, weiß ich, dass ich ertrinken werde.
Eine unfassbare Hilflosigkeit.
Ich bin aufgetaucht. Ich atme wieder.
Ich darf ja auch mal träumen – 20. November 2025
Es ist schon erstaunlich, auf was für Gedanken ich komme, wenn die Chemo-Rekonvaleszenz mir etwas mehr Leerlauf schenkt. Zum Beispiel auf diesen hier: Was passiert eigentlich, wenn die Prostata im nächsten Frühjahr operativ entfernt wird – mitsamt den Lymphknoten, der Samenblase und dem ganzen restlichen biologischen Anhang? Der Krebs hatte seinen Ursprung ja in der Prostata. Also: Brandursache raus, Feuer gelöscht, Laden gerettet. Ein schöner Traum. Wirklich. Leider nur – ein Traum.
Denn die Wirklichkeit ist: Wenn beim Prostatakarzinom bereits Metastasen im Gepäck sind, dann sind die längst selbstständig geworden und ausgezogen. Die haben sich schon vor Monaten eine eigene Wohnung genommen. Der Primärtumor ist da eher der Vater, der irgendwann mal gesagt hat: „Also, macht’s gut, ihr Lieben. Lasst euch noch mal drücken.“
Wenn man nun Papa Prostata herausoperiert, ist das allerdings für die metastasierte Brut nicht relevant. Wie im richtigen Leben. Insofern ist das Gedankenspiel „Wenn der Ursprungsbrandherd weg ist, dann kann ich doch sicher die Hormontherapie absetzen, oder?“ leider sehr gefährlich und falsch. Klingt eigentlich gut und logisch. Aber logisch ist nicht automatisch richtig.
Denn die Metastasen – diese kleinen energiefressenden Tanzmäuse – warten nur darauf, dass wieder Musik gespielt wird. Und Testosteron ist in dieser Analogie das DJ-Mischpult-und-Beschallungssystem. Ohne Testosteron: Stille. Müdigkeit. Gähnen. Katerstimmung. Mit Testosteron: Bass. Licht. Alkohol. Eskalationspotenzial. Der DJ Prosta-Papa mag aus dem Vorsteher-Club entfernt worden sein – aber die Afterhour findet längst vor dem Tanzlokal statt, angefeuert von metastatischen Partygästen, die sich null für Sperrstunden interessieren. Und wenn ich die Hormontherapie beende, bedeutet das: Party time. Licht aus. Spot an. „Macht Lärm, wenn ihr da seid! Wir wollen eure Hände in der Luft sehen!“ Die Musik dröhnt. Die Tanzfläche bebt. Das geht dann schneller, als ich „PSA“ sagen kann.
Und ja, ich habe darüber nachgedacht, wie schön es wäre, wenn die Operation alles wieder auf null setzen würde. Ein Reset. Ein Neustart. Der berühmte Knopf im Leben, den wir sonst nie finden. Eine zweite Chance für meinen Körper. Aber dann kommt sofort die Realität um die Ecke, legt mir fürsorglich die Hand auf die Schulter und sagt: „Hasilein, schön wär’s.“
Die Wahrheit ist: Die Prostata zu entfernen kann sinnvoll sein, um Komplikationen zu vermeiden. Um ein paar Tumorlastpunkte zu löschen. Um lokal Ruhe reinzubringen. Vielleicht sogar um dem Immunsystem das Leben leichter zu machen. Aber sie heilt keinen metastasierten Krebs. Dafür bräuchte ich eine Zeitmaschine. Hat zufälligerweise jemand die Telefonnummer von Dr. Emmett „Doc“ Brown? Also sitze ich hier, schaue den Fakten ins Gesicht und denke: Ich darf ja trotzdem träumen.
Und manchmal – das ist das eigentlich Tröstliche – schließen sich diese beiden Haltungen gar nicht aus. Denn wenn ich realistisch bleibe, bleibt mir immer noch das Träumen. Ich träume dann nur anders: Nicht mehr von der Magie der vollständigen Heilung. Sondern vom Leben dazwischen. Vom Leben währenddessen. Vom Leben trotz alledem. Und auch das kann eine verdammt gute Party werden. Auch nach 4 Uhr morgens. Don’t stop ’til you get enough. Who the f* is Tony Manero?
Macht mal Platz da. Na gut, ohne vordere Kreuzbänder allerdings nicht ganz so einfach. Na ja, dann eben Isolations-Tanztechnik. Füße wie festgenagelt und dann oben mit den Armen wedeln, oder so. Oder ich mache den Wandsteher. Geht auch.
„Ja, klar, geht schon mal Tanzen. Ich komme gleich nach. Ich trinke nur noch meine Cola aus.“
Die imaginären Leiden des jungen Robert – 21. November 2025
Heute stand die Fortsetzung an. Herzensangelegenheiten zweiter Teil. Zur Halbzeit der Metastasen-Eliminier-Behandlung sollte wieder meine Pumpe untersucht werden. Sicher ist sicher. Die Echokardiographie verlief vorbildlich. Keine Herzerkrankungen, keine Herzschwäche, kein Herzklappenfehler und keine Herzwandveränderungen. Das EKG war laut meinem Kardiologen exakt so, wie es sein sollte. Darüber hinaus hätte sich mein Sportlerherz etwas verkleinert – was in meinem Alter durchaus ein Vorteil ist. Die Bergziege geht ja nicht mehr so wie früher. Stattdessen absolviere ich jetzt Arthrose-Prävention fürs Kniegelenk auf einer Art Fahrrad-Heimtrainer im Fitnessstudio. Zumindest kann ich dabei die Tageszeitung lesen.
Wir wollten uns nach der letzten Chemotherapie – irgendwann Ende Januar 2026 – dann zur Abschlussuntersuchung wieder sehen. Die Befunde und das EKG würden mir später per E-Mail zugeschickt werden. Wenn man von seinem Facharzt mit den Worten verabschiedet wird, dass alles in bester Ordnung sei – Deckel zu und fertig.
Am Nachmittag kamen die Unterlagen. Ich hätte meinen Neugierdedeckel wirklich geschlossen lassen sollen. Auf dem EKG stand:
Möglicher alter Vorderwandinfarkt.
Ich sterbe also nicht an Krebs, sondern an einem Herzinfarkt. Hätte ich meine Blogs über Koronare Herzkrankheiten mal lieber nicht mit so viel Verve verfasst – sich selbst erfüllende Prophezeiung. Schnappatmung. Auf Knien und mit letzter Kraft ergriff ich mein Telefon und schickte meinem Herzspezialisten eine Nachricht. War dies vielleicht meine letzte WhatsApp?
Seine Antwort kam prompt: „Dir eine schnelle Genesung von der Krebserkrankung. Ein Herzinfarkt ist ausgeschlossen. Keine Gedanken mehr darüber machen.“
Und hier die Erläuterung, warum der Computer-Kommentar des EKG „möglicher alter Vorderwandinfarkt“ (20.11.2025) klinisch nicht sein kann:
– Keine ST-Hebungen oder ST-Senkungen
– Keine pathologischen Q-Zacken in V1–V4
– Echo zeigt normale Wandbewegungen (beide Termine)
– EF bleibt 50 %, unverändert
– Keine Symptome
– Ein klassischer Fehlalarm der automatischen Software
Gesamtbeurteilung: Das Herz ist stabil, strukturell normal und zeigt keine durch die Chemotherapie bedingte Verschlechterung. Das heutige EKG zeigt keine pathologischen Veränderungen. Der automatische Hinweis auf einen alten Infarkt ist klar ein Fehlbefund.
Wenn es einem wieder mal zu gut geht: EKG – Euphorie-Killer-Gerät.
Nachdem ich wieder zu mir gekommen war und meinen Resthumor reaktiviert hatte, war mir auch schon wieder nach Fabulieren: Also, mein Herz verhält sich wie ein souveräner Türsteher vor meinem Körperclub: „Chemo? ADT? Alles klar, ihr könnt rein, aber benehmt euch.“ Es lässt sich nicht stressen, nicht beeindrucken und schon gar nicht von einem Computerkommentar aus der Ruhe bringen. Na gut – außer kurz vom Algorithmus.
Also: Keine neuen Probleme, keine stillen Katastrophen, keine heimliche Sabotage.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
– Antoine de Saint-Exupéry
Daran sollte ich mich mal besser halten.
As time goes by – 22. November 2025
Vor zwei Monaten habe ich angefangen zu schreiben. Nicht, weil ich das vorhatte. Eher, weil irgendetwas in mir beschlossen hat, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Erst schrieb ich im Rückspiegelmodus – wie jemand, der versucht, seinen eigenen Fußspuren zu folgen, um zu verstehen, wie ich überhaupt hier gelandet bin. Dann, irgendwann Ende September, hat sich mein Blog in ein Tagebuch verwandelt. Und ich bin einfach mitgegangen. Von Post zu Post. Blogbeiträge, die sich fast von alleine geschrieben haben. 120 Einträge bis dato. Eine neue Grundmelodie meines Alltags, die man sonst kaum bemerkt. Wie auch? Jetzt ist da täglich Bewegung. Manchmal zart, manchmal überfordernd – aber immer lebendig. Das Schreiben hat etwas verändert. Die Blickrichtung. Die Tiefe. Das Tempo. Mich. Die letzten zwei Monate fühlten sich an wie ein seziertes Leben. Nah. Roh. Aufrichtig. Ich habe Gefühle getroffen, denen ich früher wahrscheinlich höflich ausgewichen wäre. Ich habe Angst und Mut gleichzeitig getragen. Ich habe Momente erlebt, die mich immer noch sprachlos machen – vor Liebe, vor Fürsorge, vor Menschlichkeit. Meine Liebsten haben mich gehalten, ohne mich festzuhalten. Mein Ärzteteam hat mich durch dieses Labyrinth geführt. Und ich? Ich habe mir selbst zugehört. Wirklich.
Wie lange meine innere Blogstimme noch mit mir spricht, weiß ich nicht. Vielleicht schreibt sie morgen weiter. Vielleicht wird sie irgendwann müde. Vielleicht schließt sie eines Tages einfach die Tür des letzten Kapitels. Nicht dramatisch – eher wie jemand, der das Licht ausmacht, weil es Zeit ist.
Was ich jetzt aber weiß: Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit wird irgendwann das Buchlicht der Welt erblicken. Manche Geschichten wollen nicht verschwinden. Vielleicht sollen sie es auch nicht. Sie wollen Gestalt annehmen. Auf Papier. Im Kopf. Im Herzen.
Und der Blog? Der wird weiterleben. Weil das Leben weiterlebt. Weil es viel zu viel Schönheit gibt, selbst jetzt, selbst hier. Und weil ich begriffen habe, dass man manchmal nur schreiben muss, um zu merken, wie sehr man noch da ist.
„Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.“
– Haruki Murakami
Nebenwirkung – Sie will mich – Sie will mich nicht – Sie will mich
Fünf Tage nach der dritten Chemo bin ich heute Morgen aufgewacht, habe kurzsichtig in den Spiegel geschaut und dachte mir: „Eigentlich geil, offenbar wieder keine Nebenwirkungen gehabt.“ Sofort betrat mein Hypochonder – „Ich bin’s, dein Gewissen“ – die Bühne und fragte: „Bist du dir sicher, dass die Therapie bei dir überhaupt wirkt? Ich meine ja nur.“ Danke, ich wollte mich ja eigentlich gut fühlen.
Bei der Weichspülerwerbung der 70er-Jahre klang diese kleine, weiße, etwas neblige Figur, die aus der Frau heraustrat, weit freundlicher und ermutigender.
Sollte ich mich nicht elendiger fühlen?
Was-ist-was-Fakten: Nebenwirkungen sind nicht automatisch eine Eintrittskarte ins Wirksamkeitstheater. Und keine Nebenwirkungen sind kein Grund, misstrauisch zu werden. Mein Körper ist kein Normprodukt. Er ist eher eine Art biologisch-emotionales Mischpult, an dem Hunderte Regler gleichzeitig drehen. Manche Menschen bauen Medikamente ab wie olympische Sprinter. Andere eher wie Spaziergänger am Sonntagnachmittag. Beides völlig normal. Ein Schnellmetabolisierer hat in der Regel weniger Nebenwirkungen. Ein Langsammetabolisierer eher mehr. Das ist angewandte Biochemie.
Hinzu kommt: Ein starkes Immunsystem löscht kleine Entzündungen, repariert, räumt auf. Wenn es geschwächt ist, brennt es öfter. Allerdings: Nicht jeder, der während der Chemo hustet, kämpft schlechter, und nicht jeder, der sich stabil fühlt, ist gleich ein Superheld. Auch die körperliche Reserve – das, was man hat, wenn man glaubt, nichts zu haben – spielt eine Rolle. Muskeln, Fitness, Ernährung, innere Stabilität. Menschen, die vorher schon in Bewegung waren, schleppen sich normalerweise nicht so schnell in den Keller. Das spricht klar für mich. Ich kann die fünf Stufen der Eingangshalle immer noch ohne Belastungsdyspnoe hochgehen.
Blutdruckmittel, Antidepressiva, Schmerzmittel, Nahrungsergänzung – auch all das verändert, wie eine Chemo oder ADT im Körper landet. Manche Wirkstoffe verstehen sich besser als andere. Und auch der pure Zufall spielt eine Rolle. Manchmal treffen einen die Nebenwirkungen, manchmal nicht. Völlig ohne vorhersehbares Muster. Bei der Menge der Tabletten, die ich jeden Tag einnehmen muss, eliminieren die sich wahrscheinlich alle gegenseitig.
Und was bedeutet das alles für mich?
Dass meine (fast) nicht existenten Nebenwirkungen kein Warnsignal, sondern einfach meine persönliche Körperarchitektur sind. Mein Körper, der gerade sagt: „Ich arbeite. Ich mach das schon. Du kannst weiterleben.“ Dann höre ich mal lieber auf meinen Körper als auf meinen eingebildeten Kranken.
Nebenwirkungen sind keine Währung, in der man Therapieerfolg misst. Keine Nebenwirkungen bedeuten nicht „nichts passiert“, sondern wahrscheinlich eher: Es passiert leise. Stabil. Verlässlich.
Hypo wollte daraufhin noch etwas sagen. Natürlich hatte er eine andere Meinung.
Apropos Nebenwirkungen – 23. November 2025
عوارض جانبی عزیز،
میخواستم از شما خیلی تشکر کنم که حتی بعد از سومین دور شیمیدرمانی هم سر نزدید. دعوت به زبان فارسی احتمالاً برای شما خیلی سخت است که ترجمهاش کنید.
پس لطفاً دور بمانید و جمع خوبی داشته باشید.
Tja, Persisch müsste man können. Oder sie versuchen, das Ganze mit Duolingo zu übersetzen. Vielleicht sind die Nebenwirkungen da auch schon draufgekommen. Aber weiter scheint’s noch nicht gereicht zu haben. Meine Tür steht nach wie vor weit auf. Kein Türsteher, keine Gästeliste. Open Bar und All-You-Can-Eat-Buffet. Selbstbedienung natürlich. Oder liegt’s an der Musik? Ich meine, Polonäse Blankenese lädt doch eigentlich sofort zum Mitmachen ein. „Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse …“ Hmm, warum kommt dann niemand?
Tja, so darf das bitte auch bei Chemo vier, fünf und sechs weitergehen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Nicht nötig. Ich habe keine. Mir kann es nur recht sein. Chemo drei reiht sich brav hinter eins und zwei ein.
Die Einladungen in Farsi scheinen zu wirken. Ich habe mich oben schon bei den des Persischen nicht mächtigen Begleiterscheinungen bedankt. Vielleicht haben die auch versucht, das Persische von links nach rechts zu lesen: Negnukriwneben Ebeil.
Eine Nebenwirkung scheine ich neuerdings dennoch zu haben: Pausbäckchen.
Chemo und ADT führen in meinem Körper eine Art WG-Streit – allerdings einen sehr einseitigen. Die Chemo hat sich bisher überraschend höflich verhalten: kein Appetitverlust, kein Energiedieb, kein Muskelräuber – zumindest keinen, den man sieht. Alles läuft, alles stabil. Und trotzdem zeigt die Waage seit einiger Zeit regelmäßig zwei bis drei Kilo mehr an. Die einzige, die da als Täterin übrigbleibt, ist die Hormonbehandlung: mein neuer „Weichzeichner deluxe“, der sich in mein System schleicht und alles ein bisschen runder und … glatter gestaltet. Photoshop – aber von innen.
Botox? Hyaluronsäure? Das kann ich mir zukünftig sparen. Ich gehe jetzt als Roberto „Chubby“ Cheeks durchs Leben. Mein neues Pseudonym: Hamsterbacke.
ADT-Glow – Antifaltentherapie für sichtbar straffere Haut. Jetzt mit verjüngendem Effekt.
Weil ich es mir wert bin.
Über Lebensstufen und Lebensschlösser – 24. November 2025
Es gibt Dinge im Leben, die sind so sicher wie das Amen in der Kirche: Alles hat seine Zeit. Die Kindheit, die Jugend, die Rushhour des Lebens, die Midlife-Crisis, die erste Lesebrille – und irgendwann sogar die Gelassenheit, dass man nicht mehr alles erklären muss.
Jede Lebensphase kommt, macht Krach, bringt Chaos, Erkenntnisse und ab und zu kleine Wunder – und dann zieht sie weiter. Manchmal sehr höflich und angekündigt. Manchmal wie ein Umzugsunternehmen namens Prost Atakrebs, das unangekündigt vor der Tür steht und behauptet, es sei „Zeit zum Weiterziehen“.
Wir müssen das aushalten. Ich muss das aushalten. Loslassen. Annehmen. Weitergehen. Türen hinter mir schließen und neue öffnen, auch wenn ich noch im Flur stehe und nicht weiß, ob der nächste Raum eine Lounge oder eine Abstellkammer wird. Wobei, unser Bobbele fand Abstellkammern ja ziemlich gut.
Das Leben ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass wir uns an einem Ort festkleben wie ein Kaugummi unter dem Schultisch. Es will uns bewegen. Stufe für Stufe. Mit Neugier. Mit Humor. Mit Gelassenheit. Immer weiter.
Kaum hat man es sich in einem Lebensabschnitt gemütlich gemacht, ruft es schon wieder: „Weitergehen, bitte.“ Gewohnheit schläfert uns langsam ein. Leben heißt Reisen. Stillstand heißt Sofa. „Schatz, hast du die Fernbedienung gesehen? Ich kann diesen schwachsinnigen Kampf der Realitystars nicht länger anschauen.“
Und vielleicht – für alle, die sich das so vorstellen können – ist sogar die letzte Tür kein Ende, sondern einfach der nächste Raum. Mit neuem Licht. Mit neuer Akustik. Mit neuer Perspektive.
Oder um Nicholas Taleb sinngemäß zu zitieren: Stellen wir uns mal vor, die mathematische Wahrscheinlichkeit unserer Geburt wäre ein winziges Staubkorn. Und direkt daneben steht ein Planet, so groß, dass unsere Erde im Vergleich dazu wirkt wie ein Sandkörnchen – sagen wir mal: ungefähr eine Milliarde Mal größer. Ich nehme es vorweg: unvorstellbar.
Und dieser Planet steht für all die Varianten, in denen wir nicht geboren worden wären. Mit anderen Worten: Wir hätten mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht existieren sollen. Und trotzdem sind wir hier. Ein kosmischer Zufall.
Was genau sind nochmal unsere Alltagsdramen?
Also vielleicht sollten wir damit aufhören, uns über die kleinen Unebenheiten des Lebens aufzuregen. Nicht wie ein Mensch sein, der ein riesiges Schloss – mit unzähligen Zimmern – geschenkt bekommt und sich ausschließlich über den Schimmel in einem der Badezimmer aufregt. Vielleicht sollten wir uns ab und zu daran erinnern.
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Dieses Sprichwort existiert wahrscheinlich nur, weil es sich reimt. Warum, bitte schön, sollte man ihm nicht ins Maul schauen dürfen? Hier kommt Roberto-Unreim:
Wer ein Schloss geschenkt bekommt, sollte nicht nach dem Schimmel suchen.
Wenn die Hormontherapie an den Knochen sägt – 25. November 2025
Es gibt Themen, die man sich während einer Krebsbehandlung nicht freiwillig aussucht. Die Knochen gehören dazu. Ich selbst dachte ja immer: Meine sind superstabil. Bis mir meine Onkologin erklärte, dass ADT – also meine Hormontherapie – nicht nur den Krebs in die Knie zwingt, sondern leider auch meine Knochen. Eine Art Begleitschaden. Bis zu 10 % Knochenverlust pro Jahr. Schluck. Mal schnell Kopfrechnen: 10 % × 10 Jahre × (ADT² ÷ Resttestosteron) = Aua.
Testosteron hat viele Fans. Die Muskeln mögen es. Die Libido sowieso. Und die Knochen lieben es wirklich. Wenn Testosteron fällt – und das tut es bei mir unter ADT ja geradezu enthusiastisch – sinkt auch meine Knochenmasse. Still, leise, ohne Alarm. Man merkt es nicht, bis etwas passiert. Und das ist der Punkt: Es passiert nicht sofort, aber es passiert zuverlässig. Leider. Deshalb gehört Knochenschutz bei ADT nicht in die Kategorie „kann ja, muss nein“, sondern eher in die Kategorie „unbedingt machen“.
Nach der dritten Chemo soll ich deshalb mit einem Medikament beginnen, das normalerweise bei Osteoporose eingesetzt wird (für Robertas und Robertos), aber auch bei bestimmten Krebsarten die Knochen schützt.
Hier kommt Denosumab ins Spiel. Ein Antikörper, der das Knochenabbau-Protein RANKL blockiert. Dadurch verlangsamt er die Aktivität von knochenabbauenden Zellen (Osteoklasten) und hilft so den Knochenabbau zu verringern. Er erhöht die Knochendichte und senkt das Risiko für Wirbelbrüche. Klingt gut – hat aber wie immer zwei Seiten.
Denosumab kann – sehr selten – dafür sorgen, dass Knochen im Kiefer schlechter heilen. Das nennt man dann Osteonekrose. Mit anderen Worten: Knochengewebe stirbt ab. Das passiert vor allem nach Zahnextraktionen oder Implantaten. Also: Bevor man mit der Denosumab-Therapie beginnt, erst zum Zahnarzt und schauen, ob irgendwas gemacht werden muss. Und dann gibt es auch noch das Thema Calcium. Denosumab ist ein Calciumdieb. Daher muss man zusätzlich Calcium und Vitamin D einnehmen – sonst rutscht der Calciumspiegel zu tief.
Der natürliche – nicht medikamentöse – Gegenspieler der Osteoporose? Sport. „Muskeln schützen Knochen.“ Je mehr man die Muskeln aktiviert, desto mehr sagen die Knochen: „Ah, wir werden doch noch gebraucht. Prima.“ Krafttraining, einfaches Training im Fitnessstudio, Walking (nein, bitte nicht Nordic-Stöckchenschieben!), Radeln, Yoga, Balance-Übungen – und ganz wichtig: nicht zu viel sitzen. Richtig: Sitzen ist kein Training. Auch nicht, indem man Workout-Videos auf dem Bildschirm nach rechts oder links wischt. Mit richtigen Trainingsmaßnahmen kann man das Risiko des Knochenschwunds fast halbieren.
Allerdings werden beim Training nicht automatisch alle Knochen stärker. Der Knochen ist nämlich ein sehr lokales Sensibelchen. Er reagiert nur dort, wo er tatsächlich belastet wird, und ist überhaupt nicht solidarisch mit dem Rest seiner Verwandten. Also: am besten immer den ganzen Körper trainieren.
Meine unendliche Reise geht weiter. In diesem Fall nicht mit Fuchur, dem Glücksdrachen, sondern mit Denosumab. Therapiestufe fünf. Mission: stärkere Knochen. Ich schütze, was mich trägt – bevor es knirscht.
„Robert, warum liegt hier immer noch dein Knochenmehl auf dem Fußboden?“
Wenn alles egal wird – 26. November 2025
Das Wort Schmerz klingt an sich schon wehleidig. Die korrekte deutsche Aussprache hilft da kräftig nach. Schmäärrrrtz. Das englische Pain klingt dagegen eher wie das nicht korrekt ausgesprochene französische Wort für Brot. Bon appétit. Im Spanischen klingt die Leidensempfindung fast wie ein schöner weiblicher Vorname: Dolor, im Plural Dolores. Die Verniedlichungsform, also wenn man nur ein bisschen Schmerz empfindet, nennt man dann Lola.
Das unsägliche Wort Krankenhaus landet in derselben Kategorie: Krrrrrankkkenhausss. Das tut schon beim Lesen weh. Im Französischen viel, viel schöner: Opital … das H wird ja bekanntermaßen nicht ausgesprochen. Vive la France.
Ich hatte gestern Schmäärrrrtz. Starken noch dazu. So viel zum Thema Tagesplanung. „Hmm, mal sehen, heute mache ich als Erstes … und danach … “
Es gibt im Leben Momente, in denen der Körper beschließt, das komplette Programm runterzufahren. Einfach so. Ohne Vorwarnung. Ein Millimeter entzündetes Gewebe und zack ist man im Ganzkörper-Alarmzustand. Der gute alte Doppel-J-Katheter – Drahti –, diese glorreiche „Inneneinrichtung“ meines Harnleiters, hatte beschlossen, sich bemerkbar zu machen. Und zwar nicht flüsternd. Nein, eher so wie eine wütende Nachbarin, die mit dem Schrubber an die Bauchdecke klopft. Brennen, Ziehen, Stechen – und jeder Gang zum stillen Örtchen ein kleiner Ausflug in die Schattenseiten des Lebens. Und da wurde mir mal wieder klar, wie gnadenlos konsequent Schmerz ist. Er duldet keine Konkurrenz. Keine Termine. Keinen guten Willen. Nichts. Schmerz hat Vorrang. Basta.
Man kann schön abgelenkt sein, euphorisch, inspiriert – aber wenn ein einziges Organ beschlossen hat, „aua!“ zu rufen, dann übernimmt es das Kommando. Das Gehirn misst Schmerz auf derselben Stufe wie: „Gefahr. Kümmert euch sofort. Vergesst alles andere.“ Ein evolutionäres Überfallkommando. „Ja, Robert, wir verstehen ja, dass du jetzt Fahrradfahren wolltest, aber …“
Nicht das Organ tut weh, in meinem Fall mein Harnleiter, sondern mein Gehirn. Es bekommt elektrische Krisenmeldungen aus meinem Körper – Nervenenden feuern, Nervenbahnen melden, Rückenmark filtert – und mein Gehirn sagt: „Alles klar, wir schalten mal auf Rot.“ Das erklärt, warum selbst ein winziger Entzündungsherd im Harnleiter dafür sorgen kann, dass ich plötzlich wie ein erschöpfter Yeti durch die Wohnung schlurfe und zu allem „später“ sage. Schmerz ist nicht demokratisch. Er ist ein Diktator mit Kurzschlussmentalität.
Und was macht man? Genau: Man greift zur Apotheke des Vertrauens. Paracetamol, Ibuprofen, Novalgin, Tilidin & Tramadol. Genau in dieser Reihenfolge. Späßchen. Eine Ibuprofen alle sechs Stunden hat das Feuer dann gelöscht. Bis dahin lag ich allerdings eine gute halbe Stunde antriebs- und bewegungslos auf dem Sofa. Morgen erfahre ich, ob Drahti sich am Freitag verabschieden darf. Dieser Wunsch steht schon seit langem auf meinem Wunschzettel fürs Christkind. Hoffentlich wird meine Erwartungshaltung nicht enttäuscht.
Schmerzmittel sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind nur Werkzeuge – und jedes Werkzeug hat seinen Zweck. So wie ein Hammer keine Bohrmaschine ersetzen kann, nimmt man die oben aufgeführten Schmerzmittel – eigentlich ja Antischmerzmittel – je nach Indikation, sprich Schmerzform.
Und Schmerz ist auch kein Feind. Er ist eine extrem engagierte Sicherheitskraft unseres Körpers. Manchmal übermotiviert. Manchmal nervig. Zumindest fühlt er sich so an. Was ich auch gelernt habe: Schmerzmittel sollte man nie nach dem Belohnungsprinzip einnehmen. Also nicht: „Wenn’s ganz schlimm wird, gönn ich mir eine Tablette.“ Das klingt logisch – ist aber das Gegenteil von sinnvoll.
Der Körper reagiert auf Schmerz wie auf ein Feuer: Wenn man zu lange wartet, brennt die ganze Garage. Deshalb ist es viel klüger, Schmerzmedikamente nach einem festen Zeitschema zu nehmen. Also bevor der Schmerz das Ruder übernimmt, nicht erst danach. Das Gehirn bleibt dann ruhig, das Nervensystem fährt nicht hoch und die Schmerzspirale beginnt gar nicht erst.
Alle seriösen Studien zeigen, dass eine zeitgesteuerte Einnahme selbst bei zentral wirksamen Schmerzmitteln – also auch bei Tilidin, Morphin & Co. – nicht zu Abhängigkeit führt, solange man sie medizinisch begründet einsetzt, regelmäßig und nicht impulsiv nimmt und rechtzeitig reduziert, sobald der Körper wieder Ruhe gibt. Abhängigkeit entsteht fast immer dann, wenn Schmerzmittel wie kleine Trostpflaster eingesetzt werden: als Belohnung, als Flucht, als Notfallknopf für schlechte Tage. Nicht, wenn man sie konsequent und geplant nimmt, so wie es Therapeuten empfehlen.
„Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt.“
– von Abraham Lincoln – sagt man. Glauben muss man es nicht.
Schön wär‘s.
Bilder sagen mehr als tausend Worte – 27. November 2025
Es gibt Bilder, die vergisst man nicht so schnell. Urlaubsfotos, Hochzeiten, die ersten Kinderzeichnungen, auch die nicht so schönen aus den Medien – und dann gibt es PET-CTs. Molekulare Selfies, die zeigen, wie es wirklich in einem aussieht – schonungslos ehrlich. Ohne Filter, ohne Weichzeichner, ohne „sorry, war gerade schlechtes Licht“.
Meine Positronen-Emissions-Computertomographieaufnahme vom vergangenen September – beim Scrabble auf dem dreifachen Wortwert gewinnen Sie damit das komplette Spiel – sah aus wie … nun ja … ich sag mal: mein Oberkörper als Addams-Family-Weihnachtsbaum. Wednesday lässt grüßen. Überall kleine und große schwarze Lichtflecken, die wie schwarze Weihnachtskugeln aussahen und sich von oben nach unten durch meinen Lymphabfluss zogen. Wenn es einen Adventskalender für Metastasen gäbe – das wäre das perfekte Foto für die Vorderseite gewesen.
Und jetzt, knapp zweieinhalb Monate später: das Kontroll-PET-CT zur Chemohalbzeit. Und was soll ich sagen? „Das Licht ist ausgegangen. Fa–a–ast ü–ü–berall. “ Die Gesangsmelodie dazu wäre die aus Es ist ein Ros entsprungen – in F-Dur. Fast alles ausgeknipst. Die vielen schwarzen Punkte von damals? Großteils verschwunden. Andere deutlich kleiner. So darf es weitergehen. Yay.
Uff. Die Therapie wirkt wirklich. Die metabolische Aktivität der Metastasen – also deren „Energiehunger“ – ist massiv heruntergefahren. Man könnte sagen: Mein Krebs ist jetzt im Energiesparmodus – und bleibt hoffentlich dort. Viele Läsionen haben aufgehört zu „leuchten“. Andere sind kleiner, blasser, unbedeutender geworden. Aus einem stark befallenen Lymphbahnbild wurde ein deutlich beruhigtes Muster mit klarer Remissionstendenz. Oder anders gesagt: Das Tumorgeschehen ist zurückgedrängt worden. Erfolgreich. Und, so ungewöhnlich das klingen mag: Ich habe ja zum Glück noch drei Metastasenkiller-Sessions vor mir. Die Reise war und ist nicht nur strapaziös, sondern auch wirksam. Gröni hat es so wunderschön formuliert:
Ich gehe nicht weg
Hab’ meine Frist verlängert
Neue Zeitreise
Offene Welt
Ich zünde die erste Adventskerze einfach schon heute an.
Was bedeutet das für mich? Es sieht so aus, als sei ich auf einem sehr guten Weg. Ende Februar – gut vier Wochen nach der letzten geplanten Chemotherapie – gibt es noch ein Kontroll-PET-CT und erst Anfang März darf ich mich dann endlich von Drahti verabschieden. Das Christkind wollte also meinen Weihnachtswunsch nicht erfüllen. Die Begründung leuchtet jedoch auch ein: Ich wollte definitiv keine Niereninsuffizienz haben. Die beiden Entgiftungs- und Filterungsorgane seien während der Chemotherapie die absolut entscheidenden Helfer und der Doppel-J eine wichtige Stütze. Also gut, dann wird der Untervermietungsvertrag noch einmal verlängert.
Es ist einer dieser seltenen medizinischen Momente, in denen nicht Worte, Tabellen oder Werte entscheiden – sondern Bilder. Manchmal braucht es gar keine tausend Worte. Ab und zu reicht ein Blick auf zwei Fotos. Vorher und nachher. Meine Reise geht also weiter. Schritt für Schritt. Vor gut zwei Monaten hatte ich nicht mal mehr einen Wegweiser erkennen können.
„Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen.“
– Johann Wolfgang von Goethe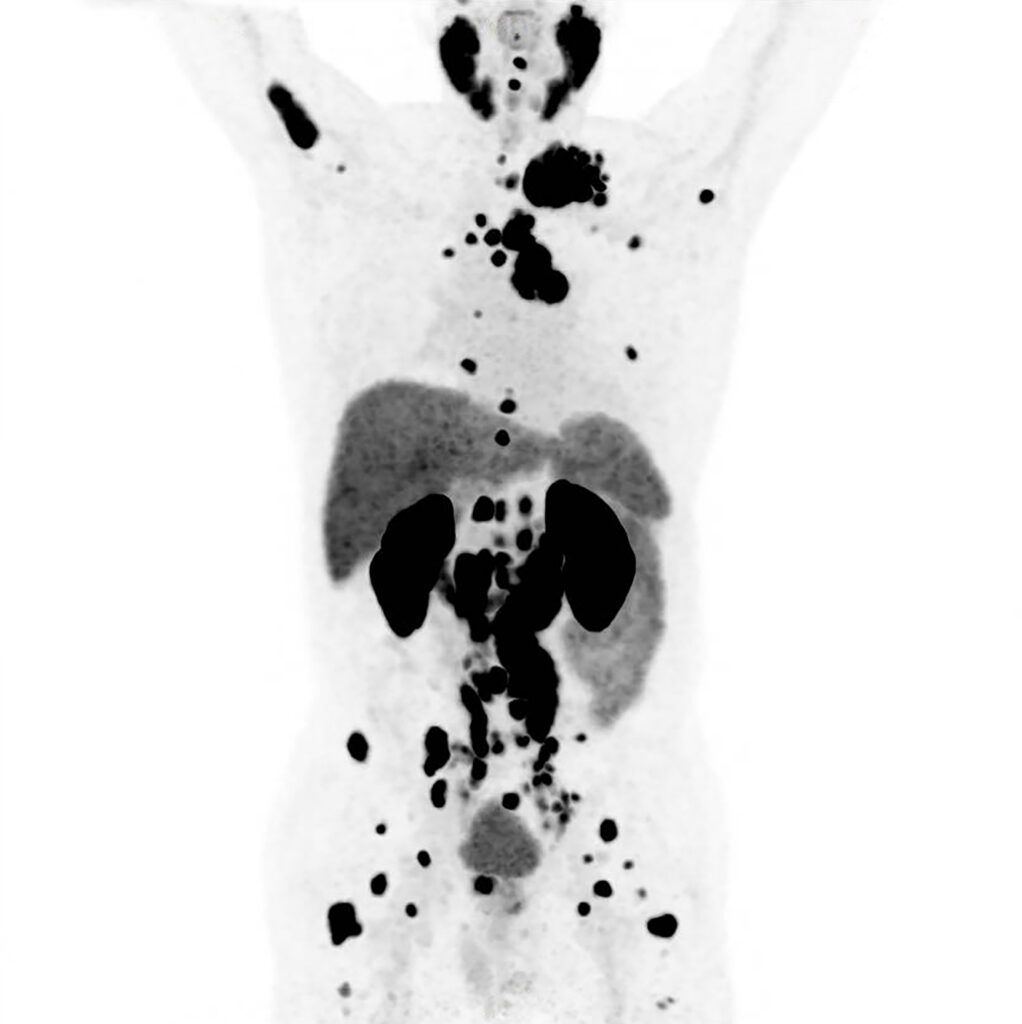
PET-CT vor der Chemotherapie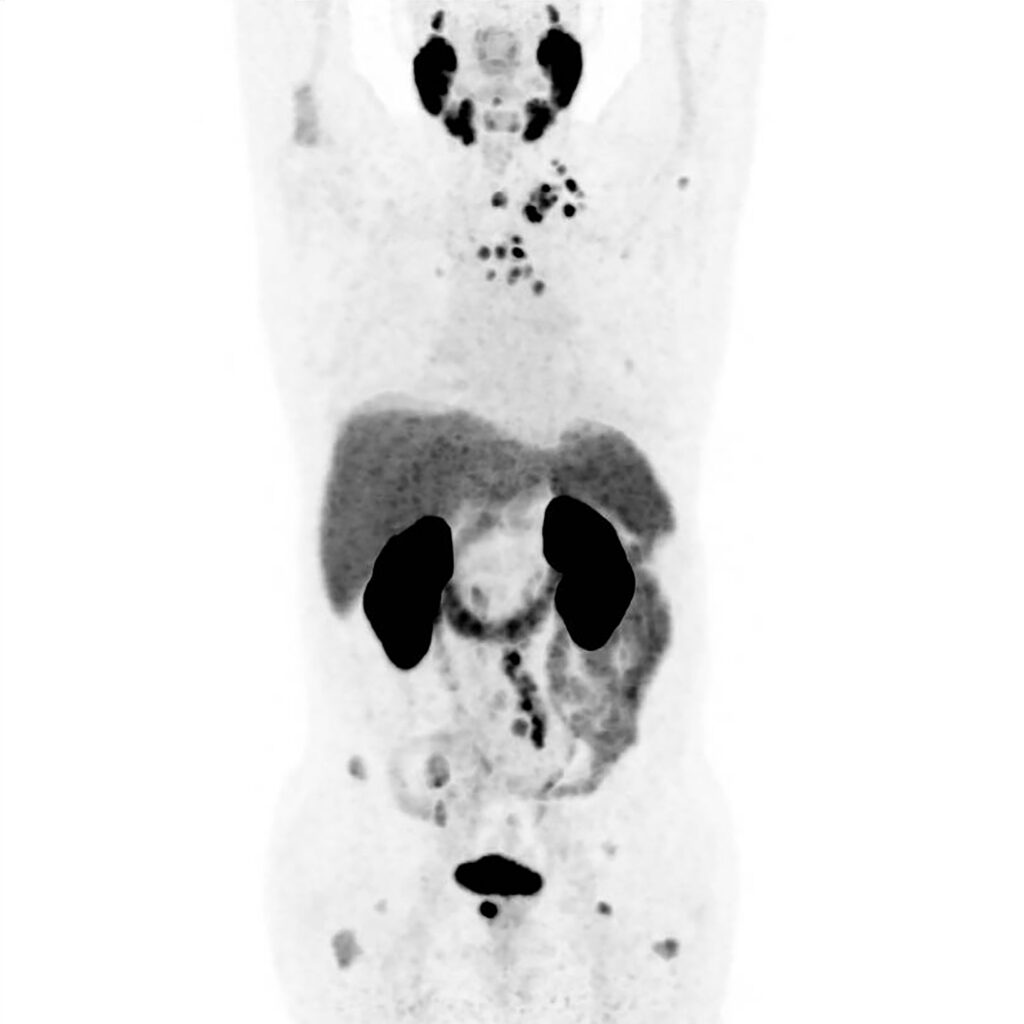
Halbzeit: PET-CT nach der dritten Chemotherapie
Epilog
Es gibt Momente, in denen eine Geschichte nicht endet, sondern einfach leiser wird. Nicht abgeschlossen, nicht fertig erzählt – nur weniger laut. So fühlt sich dieses Kapitel an.
Nach über 120 Texten über Ohnmacht und Hoffnung, über Behandlungen, Röhren, Diagnosen, Irrwege, Umwege und richtige Wege, nach all den Gesprächen, Befunden, Zweifeln und kleinen Triumphen, stehe ich an einem Punkt, an dem das Leben selbst das nächste Wort haben darf. Nicht der Krebs. Nicht die Medizin. Und auch nicht der Blog.
Das letzte Kapitel war kein Finale – sondern eine geöffnete Tür. Ein guter PET-CT-Befund. Eine starke Reaktion auf die ADT. Noch drei Chemo-Etappen, dann Trenantone im vertrauten Dreimonatsrhythmus. Mein tägliches Darolutamid. Denosumab dann erst nach der Chemotherapie. Die Verabschiedung von Drahti Anfang März. Der Rest: heilen. Und entsprechend leben.
Die Metastasen haben ihren Glanz verloren, ihre Unruhe, ihren unersättlichen Hunger. Die Herde sind kleiner, blasser, stiller geworden. Vielleicht ist das die eigentliche Pointe: Nicht alles muss verschwinden, um Frieden zu geben. Manchmal genügt es schon, wenn es ruhiger wird. In den vergangenen Monaten habe ich oft versucht, das Unfassbare durch Sprache zu fassen. Manchmal ist mir das gelungen. Aber vielleicht geht es beim Schreiben – und beim Leben – gar nicht darum, alles erklären zu können. Sondern darum, nicht zu verstummen.
Jetzt beginnt eine neue Zeit. Der Blog bleibt – aber er atmet freier. Er erscheint, wenn es etwas zu sagen gibt. Nicht aus Pflichtgefühl. Nicht um Lücken zu füllen, sondern um Räume zu öffnen. Ich habe in den letzten Monaten viele Wegweiser verloren – und neue gefunden. Manche waren medizinische, manche menschliche, manche stille innere Signale. Wenn es etwas gibt, das bleibt, dann ist es dies:
Dass das Leben sich immer wieder bemerkbar machen will.
In Warteräumen.
In Röhren.
In Momenten, in denen ich glaubte, nicht mehr weiterzukönnen.
Und besonders dann, wenn ich merkte:
Doch. Es geht weiter. Schritt für Schritt.
Vielleicht ist das der wahre Sinn eines Epilogs: nicht zurückzublicken, um die Geschichte abzuschließen, sondern dankbar festzustellen, dass sie weitergeht.
Ich gehe also weiter. Langsamer vielleicht. Bewusster – ganz sicher. Mit guten Menschen, guter Medizin, guten Nachrichten – und meinem Herzen, das gelernt hat, dass Hoffnung nicht laut sein muss, um mich zu tragen.
Und der Blog? Der bleibt mein Reisejournal. Nur nicht mehr täglich. Sondern wie das Leben selbst: dann, wenn etwas geschieht, das erzählt werden will.
Bis dahin:
Ich bin hier. Und unterwegs. Im Leben.
Warum ich plötzlich überall von Krebs lese – 01. Dezember 2025
Es ist eine dieser Fragen, die ich mir immer häufiger stelle, wenn ich mich durch die Nachrichten scrolle: Warum lese ich gefühlt jeden Tag von einer neuen Krebserkrankung? Jetzt auch Thomas Gottschalk. Willkommen im Club. Wird die Welt kränker? Oder medizinisch besser? Oder ich neugieriger? Oder bin ich nur sensibler geworden für dieses Thema?
Die kurze Antwort ist: Ja. Und ja. Und ja. Und nochmal ja. Die lange Antwort ist ein bisschen komplexer.
Wir werden älter. Und das ist der größte Faktor. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk. Aber er hat einen Haken: Je länger er läuft, desto mehr kleine Fehler sammeln sich in den Zellen an. Mehr alte Menschen = mehr potenzielle Krebsfälle. Ein 85-Jähriger hat einfach mehr Zellteilungsrunden hinter sich als ein 25-Jähriger. Allein die Tatsache, dass wir heute so alt werden, wie frühere Generationen nie durften, erklärt einen riesigen Teil der steigenden Fallzahlen. Ein paradoxes Kompliment an die moderne Medizin.
Man muss allerdings der Diagnostik auch ein Kompliment machen. PET-CTs, MRTs, Labore, molekulare Marker, Screening-Programme: Heute entdeckt man Tumoren, die früher einfach unentdeckt geblieben wären. Nicht jeder Krebs wäre früher aufgefallen. Nicht jeder hätte Beschwerden gemacht. Nicht jeder wäre im Leben eines Menschen überhaupt „sichtbar“ geworden. Heute findet man winzige Herde, die bei früheren Generationen nie diagnostiziert worden wären. Das ist gut, weil man früher behandeln kann. Es führt aber auch dazu, dass die Statistik wächst — einfach weil wir genauer hinschauen.
Es wäre bequem, alles auf die Alterung und Diagnostik zu schieben. Aber ganz so einfach ist es nicht. Wir bewegen uns weniger. Wir essen anders. Wir schlafen schlechter. Wir leben in Großstädten – mit der einhergehenden Luft-, Lärm- und Lichtverschmutzung. Und wir sitzen zu viel. Und der Cocktail an Chemikalien, Kunststoffen und Umweltfaktoren, den die moderne Welt mit sich bringt, hat ebenfalls Einfluss – nicht überall gleich stark, aber spürbar.
Es ist also kein Wunder, dass bestimmte Krebsarten häufiger werden. Nicht wegen eines einzelnen Übeltäters, sondern weil unser Leben ein bisschen mehr „Gegenwind“ erzeugt, als wir wahrhaben wollen. Und was viele aufhorchen lässt: In einigen Ländern steigt die Zahl bestimmter Krebsarten bei den Jüngeren, also bei den unter 50-Jährigen.
Darmkrebs. Brustkrebs. Nierenkrebs. Hautkrebs. Vermutet werden Veränderungen im Stoffwechsel, in der Ernährung, im Stresslevel. Die Forschung gräbt gerade tief. Die Entwicklung ist real.
Das klingt jetzt alles ein bisschen düster. Darum hier der Gegenpol – und der ist entscheidend:
Die Sterblichkeit durch Krebs sinkt. Weltweit. Jahr für Jahr. Man stirbt heute seltener an Krebs als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Das gilt dann hoffentlich auch für mich. Bitte. Nicht weil es weniger Krebs gibt, sondern weil man ihn früher findet, besser versteht, präziser behandelt und verständnisvoller begleitet. Krebs wird immer öfter zu einer Erkrankung, mit der man lebt – nicht an der man zwangsläufig stirbt.
Der vielleicht emotionalste Grund: Mehr Menschen überleben. Und wer überlebt, redet darüber. Früher wurden Krebserkrankungen hinter Gardinen versteckt. Heute sind Betroffene sichtbar, laut, mutig, präsent. Sie schreiben Bücher. Sie machen Podcasts. Sie starten Blogs. Und ja, manchmal liegen sie in einer PET-CT-Röhre, steigen heraus und schreiben anschließend den einhundertdreiundzwanzigsten Blogtext darüber.
Krebs ist sichtbarer geworden. Und das ist gut. Nicht weil die Zahlen steigen, sondern weil die Gemeinschaft derer, die weiterleben, wächst. Mehr Daten bedeutet nicht mehr Untergang. Mehr Diagnosen bedeuten nicht mehr Dunkelheit. Mehr Berichte bedeuten manchmal einfach nur: Wir reden darüber.
Gut so.
Alles Gute, Thomas.
Der freundlichste Imperativ der Medizin – 04. Dezember 2025
Es gibt Sätze, die in Arztzimmern ausgesprochen werden, ohne wirklich ausgesprochen zu werden. Einer davon lautet: „Leben Sie bitte ganz normal weiter.“ Das klingt harmlos. Fast banal. Ein sanfter Imperativ, höflich verpackt – wie ein Kalenderblattspruch. Aber wenn man ehrlich ist, steckt dahinter eine ziemlich radikale Idee: Einfach wie bisher weiterleben. Trotz allem. Und damit beginnt das Paradox der Krankheit, über die alle reden, die sich aber erstaunlich gut verstecken kann: Krebs.
Ich hatte meinen Prostatakrebs wahrscheinlich schon ein Jahr lang, bevor irgendjemand ihn diagnostiziert hat. Gespürt? Nichts. Kein Stechen, kein Drücken, kein blinkendes Warnlämpchen auf der Anzeigetafel meines Körpers. Ein stiller Untermieter, der die Miete nicht zahlt – allerdings auch keine Partys feiert. Ein Phantom, das seinen Job in erstaunlicher Diskretion erledigt. Und ich bin mit Sicherheit keine Ausnahme: Viele Krebsarten sind still. Leise. Unauffällig. Brustkrebs oft lange symptomlos. Darmkrebs gern auch. Nur der Pankreaskrebs, der ist brutal ehrlich. Der sagt sofort, wenn er schlechte Laune hat. Die meisten Krebsarten marschieren schweigend durchs Gewebe, während man selbst ahnungslos seinen Alltag verrichtet.
Die Katastrophe entsteht nicht nur langsam im Körper, sondern vor allem im Kopf. Diagnosetage sind irgendwie surreal. Da betritt ein Wort den Raum – Krebs – und plötzlich schaltet das Gehirn in den IMAX-Kino-Modus. Dabei hat sich im Körper gar nichts verändert. Nur die Wahrnehmung. Die Gedanken, die man plötzlich hat. Am Ende hat man Albträume – nur eben bei Tageslicht.
Nachts träumt man, dass ein Tiger einen durch den Dschungel jagt und verköstigen will. Man rennt um sein Leben, schwitzt, der Puls explodiert – und dann wacht man schweißgebadet auf und merkt: Oh, da ist ja gar kein Tiger. Glück gehabt. Aber: Die Reaktion war echt. Es fühlte sich echt an. Der Auslöser: Gedanken. Also nichts Reales. Man legt sich wieder gemütlich ins Bett und kuschelt sich in den Schlaf zurück.
Und tagsüber? Da läuft das gleiche System, nur ohne Bettdecke: Das sind dann Tag-Albträume. Gedanken, die dieselben körperlichen Reaktionen auslösen wie ein echter Tiger – und das, obwohl überhaupt (noch) nichts passiert. Im Hier und Jetzt durchleben wir nach der Diagnose die nächsten Jahre im Schnelldurchlauf und bekommen Panikattacken und alle anderen Begleitsymptomatiken gleich mit dazu.
Ich habe irgendwann beschlossen, nur noch auf meinen Körper zu hören. Natürlich habe ich die Diagnose: Prostatakrebs. Aber: Ich spüre den Krebs nicht – also habe ich ihn auch nicht. Bluthochdruck oder Diabetes spürt man auch nicht direkt. Meine Schmerzen kommen ausschließlich von Drahti. Der meldet sich zuverlässig. Wahrscheinlich damit ich nicht vergesse, dass ich lebendig bin. Das macht dann auch wieder Sinn.
Meine Therapie – Hormontabletten, Chemo-Etappen, Blutwerte – ist inzwischen so normal geworden, wie andere Menschen ihre Blutdrucktabletten oder Diabetesmedikamente schlucken. Das gehört dazu. Einfach Alltag. Und weil mein Körper schweigt, mache ich etwas radikal Einfaches: Ich lebe. Weiter. Ganz normal. Nicht als Ablenkung. Nicht als Flucht. Sondern weil das alltägliche Leben, die Alltagsroutine selbst die beste Erdung ist.
Wer einen dauerhaften Tinnitus (Ohrgeräusche) hat, kennt das Prinzip: Wenn man nicht daran denkt, ist er weg. Oder sagen wir: Er ist da, aber er hat die Freundlichkeit, sich unbemerkt im Hintergrund aufzuhalten. Nur wenn jemand fragt „Wie geht es eigentlich deinem Tinnitus?“, – zack! – springt er wie ein schlecht gelaunter Azubi durchs Bewusstsein. Also: Bitte nicht fragen – sonst hör’ ich ihn wieder.
Genauso ist es mit dem Krebs. Er ist da. Aber er muss nicht ständig IMAX spielen. Das Krebskino bleibt geschlossen. Je weniger Raum man ihm gibt, desto weniger Raum nimmt er ein. Normal weiterleben – kein Imperativ, sondern ein Angebot.
Ich habe gelernt: Der freundlichste, leiseste und zugleich effektivste Satz der Medizin lautet: „Leben Sie bitte ganz normal weiter.“ Nicht weil man etwas verdrängen soll. Nicht weil man mutig sein muss. Sondern weil Normalität das perfekte Gegenmittel gegen Tag-Albträume ist.
Und wenn der Tiger im Kopf brav schläft, kann man E-Mails schreiben, Witze machen, Freunde treffen, Sport treiben, Spazieren gehen, Essen genießen, Blogtexte verfassen, und plötzlich feststellen: Das Leben – es geht einfach weiter. Trotz Krebs.
„Verstehen kann man das Leben rückwärts; leben muss man es aber vorwärts.“
– Søren Kierkegaard
Meet Drahti – noch Fragen?
Für alle, die beim Betrachten meines Röntgenbildes spontan eine Zusatzdiagnose parat hätten: Bitte nicht. Ich habe schon eine. Die genügt mir.
Ein Drahti, metallisch und klein,
beschloss bei mir Mieter zu sein.
Er stört mich bisweilen,
doch ohne sein Weilen
käm’ manches nicht wieder in Reih’n.
Vielleicht funktioniert’s ja doch noch mit der Reimkarriere.
Happy Nikolausi – 06. Dezember 2025
Wir sind reich, wenn wir gesund sind –
denn Gesundheit erlaubt uns die Welt zu betreten,
ohne dass jeder Schritt verhandelt werden muss.
Sie schenkt uns Tage, an denen wir nicht an uns denken müssen,
weil wir selbstverständlich sind.
Alles, was darüber hinaus in unser Leben tritt:
Komfort, Besitz, Erfolg, Beifall –
all das ist im Grunde nichts weiter als Luxus.
Ergänzung.
Zugabe.
Der eigentliche Schatz bleibt unsichtbar,
solange wir ihn besitzen.
Ich habe meine spiegelblank geputzten Wildlederstiefel vor die Eingangstür gestellt und bin gespannt, womit Knecht Ruprecht meine Langschäfter füllen wird. Sicherheitshalber habe ich sogar schon mal gedichtet. Ein Geschenk hätte ich ja damit eigentlich verdient.
Also, Nikolausi: mein Wunsch: Ich wäre dann gerne reich. Sehr reich. So wie Onkel Dagobert. Ich würde dann den ganzen Tag in meinem Schatz schwimmen. In Gesundheitstalern.
Robobert Duck. Ich benötige nächstes Jahr ohnehin einen neuen Pass.
Polysemische Sprachfallen und Buchstabensalat – 07. Dezember 2025
Reizend im Sinne von entzückend hat nichts mit reizend im Sinne von irritierend gemeinsam. Außer der etymologischen Wurzel. Beide stammen vom Verb reizen ab, das ursprünglich „kratzen bzw. ritzen“ bedeutete. Das Wort „reizen“ entwickelte sich ursprünglich aus einer alten Wurzel für „reiben“. Interessiert wahrscheinlich niemanden. Egal. Man kann jedoch beide Versionen problemlos in einem Satz verwenden.
In diesem Sinne war meine heutige Fahrrad-Natur-Tour reizend und reizend. Vom Gym-Fitness-Fahrrad-Pedalieren auf dem Dekubitussattel hatte ich die Nase gestrichen voll und wollte mal wieder etwas Rennrad-Frischluft schnuppern. Natur und Außenluft – herrlich. Allerdings bringt es die Google-KI so treffend auf den Punkt: Radfahren mit einer Harnleiterschiene ist zwar möglich, aber anstrengende Aktivitäten sollten vermieden werden, da diese zu mehr Reizung, Krämpfen, Blut im Urin und Schmerzen führen können. Fragen Sie nicht Ihre Ärztin oder Ihren Arzt – fragen Sie Robert. Am besten nach der Freiluftradlrunde. Strafe folgt auf dem Fuße.
Während ich so im Wiegeschritt und auf den Pedalen stehend die letzten Kilometer vor mich hin litt, meldete sich mal wieder Fronti, mein Ablenkungsdirigent, und wollte wissen, ob ich die Melodie im Temporallappen – Hörrinde klingt auch nicht besser – erkennen würde. Das tat ich und sang sofort mit. Demenz scheint an mir noch kein Interesse zu haben, ich konnte den Text auch noch nach knapp 50 Jahren mitsingen. Ich fühlte mich wieder wie mit 14.
Otto Waalkes hat dieses deutsche Gesangsgut 1978 komponiert und besingt in diesem Lied, wie man aus verschiedenen Buchstaben, die selbst für wunderschöne Worte stehen, ein neues Wort kreieren kann. „G steht für Güte, N steht für Nähe, L steht für Leidenschaft, P steht für Poesie, F steht für Freundschaft, T steht für Treue, H steht für Herz. Am Ende des Songs singt er: „Tu alles zusammen: Ja, dann heißt es GNLPFTH.“ Genau so fühlte ich mich nach der Ausfahrt übrigens auch.
Fronti schlug die Stimmgabel leicht auf meinen Hinterkopf. Aber bevor er zu singen begann, fragte er mich, ob ich die einzelnen Buchstaben, die er jetzt beschreiben würde, ebenfalls zusammensetzen könnte. Fronti imitierte Ottos Stimme und schmetterte los:
D, das steht für Druckgefühl, das ich dir gern bescher’, O wie Ohren anlegen, wenn du wieder mal zehrst, P ist für das Pieksen, das ich ständig exerzier’, ein weiteres P für Pochen, das dich heimlich irritiert, E steht für die Enge, die ich in dir erzeug’, L wie Lästigkeit, mit der ich deinen Alltag beug’, J das ist dein Jaulen, wenn ich wieder rebellier’. Tu alles zusammen: Ja, dann heißt es …
Vielleicht sollte ich doch mal einen Neurologen konsultieren. Rein prophylaktisch. Für Fronti.
Es geschah an einem Dienstagmorgen – 09. Dezember 2025
Meine beiden Broca- und Wernicke-Sprachareale brummten wie zwei Transformatoren und waren maximal gefordert. Der virtuelle Gesundheits-Frühschoppen war eröffnet. Auf meinem mentalen Podium nahmen Platz:
H. Y. Pochonder, Pseudowissenschaftler, Hobbymediziner, Vollzeitpaniker,
P. R. Ostata, der Urologe, der traditionell erst zugeschaltet wird, wenn der Rest vollständig entgleist ist,
und natürlich ich selbst, Roberto, Gastgeber, Protagonist und hauptberufliche Leidfigur.
Heute auf der Tagesordnung:
„Verschobene vierte Chemo: War’s das? Ist das Projekt Überleben jetzt in Gefahr?“
„Ziehen, Brennen, Druck im Hals: harmlos oder metastasenbedingtes Endspiel?“
„Brennen beim Wasserlassen: Geschlechtskrankheit oder einfach mal wieder der DJ-Katheter, der seine Partynadel in die Schleimhaut rammt?“
Ich:
„Guten Morgen allerseits. Die vierte Chemo wurde verschoben. Nur eine Woche, aber mein Gefühl fragt sich: Ist das der Anfang vom Ende?“
Pochonder:
„Eine Woche reicht völlig! In sieben Tagen kann ein metastasierender Tumor laut meiner selbst entwickelten Mitochondrien-Thermo-Stress-Theorie bis zu 14 neue Kolonien gründen!“
Ich:
„14?“
Pochonder:
„Mindestens! In besonders kooperativen Milieus auch 21. Man weiß ja nicht, wie gastfreundlich dein Hals derzeit ist.“
Ich:
„Ich merke schon ein Brennen …“
Pochonder:
„Na bitte! Die Kolonialisierung hat begonnen. Eine Woche zu spät, und schon werden im Halsbereich neue Metastasen aktiv.“
Ich:
„Echt jetzt? Apropos Hals: Es zieht seitlich, manchmal brennt es, und wenn ich draufdrücke, fühlt es sich an, als hätte ich eine Entzündung oder einen fiesen Halsmuskelkater.“
Pochonder:
„Ganz klar: metastasenkonforme Hypertonie der Skalenusmuskulatur. Wahrscheinlich interagieren deine Halslymphknoten mit den taxantischen Medikamentenresten.“
Ich:
„Taxan… was?“
Pochonder:
„Taxantische Residual-Neurotoxizität. Gehört zur Untergruppe der pseudosensorischen Phantomsyndrome. Sehr selten. Die allermeisten Ärzte kennen das nicht.“
Ich:
„Warum nicht?“
Pochonder:
„Weil ich es gerade erfunden habe.“
Ich:
„Und dann das Brennen beim Pinkeln. Was meinst du? Eine Harnwegsinfektion?“
Pochonder:
„Eventuell eine Geschlechtskrankheit oder wahrscheinlich eher eine neue Pandemie. Patient Zero? Wir müssen wachsam sein!“
Ich:
„Aber ich habe doch einen Doppel-J-Katheter.“
Pochonder:
„Aha! Dann ist es eindeutig der Katheter. Du hast dann offensichtlich ein JJ-Syndrom. Das ist schlimmer als alles, was in urologischen Lehrbüchern beschrieben wird – und die sind bereits dramatisch genug.“
Ich:
„Ist das wissenschaftlich belegt?“
Pochonder:
„Nur von mir. Aber ich bin zuverlässig. Meistens.“
Der Urologe wird zugeschaltet.
P. R. Ostata wirkt, als ob er seit 27 Jahren täglich denselben Blödsinn hört – und trotzdem höflich bleibt.
Ich:
„Herr Ostata, wir hätten da einige Befunde … also, empfundene Befunde … zu klären.“
Ostata:
„Dann mal los.“
Ich:
„Die Chemo wurde verschoben – bedeutet das, dass die ganze Therapie scheitert?“
Ostata:
„Nein.“
Ich:
„Mein Hals brennt. Neue Metastasen?“
Ostata:
„Nein.“
Ich:
„Beim Pinkeln brennt es ebenfalls.“
Ostata:
„Das tut es bei jedem mit einem DJ-Katheter.“
Pochonder (dazwischen):
„Aber meine taxantische Residual-Neurotoxizität …“
Ostata:
„Gibt es nicht.“
Pochonder:
„Aber die Kolonialisierung der Halslymphkno…“
Ostata:
„Nochmal: Gibt. Es. Nicht.“
Ich:
„Aber mein Körper fühlt sich anders an! Seit Tagen! Ich und mein Paniker machen uns Sorgen.“
Ostata:
„Ihr Körper hat Krebs, Chemo, ADT, Stress, Schlafmangel und einen Katheter.
Er dürfte sich wundern, wenn er sich nicht anders anfühlen würde.“
Ich:
„Und der heutige Ultraschall?“
Ostata:
„Ohne Befund.“
Ich:
„Und das PET/CT der vergangenen Woche?“
Ostata:
„Spricht eine klare Sprache: alles unter Kontrolle und gutes Therapieansprechen.“
Ich:
„Also … nichts Dramatisches? Ich muss mir dann keine Sorgen machen?“
Ostata:
„Nein. Wenn etwas Dramatisches wäre, wäre ich der Erste, der es Ihnen sagt. Und ich würde nicht dabei lächeln.“
Pochonder:
„Aber – ich – die Mitochondrien …“
Ostata:
„Hören Sie auf, dem Mann Angst zu machen.“
Der Urologe nickt und verabschiedet sich. H. Y. Pochonder zieht verschnupft seine imaginäre Brille gerade. Ich atme durch.
Ich:
„Dann … ist ja alles gut?“
Pochonder:
„Kommt drauf an, wen du fragst.“
Das letzte Wort hat der Urologe
„Wir versuchen Ihren Prostatakrebs in eine chronische Krankheit zu verwandeln, die wir dann ganz normal behandeln können.“
Ich hoffe, er behält recht.
Über Numerik und Mächtigkeiten – 13. Dezember 2025
Vor fast genau einem Jahr – an meinem 60. Geburtstag – sagte mir ein guter Freund: „Alles Gute zum Geburtstag, und jetzt, ab 60, geht alles den Bach runter.“ Tja, so ganz Unrecht sollte er damit nicht haben. Er hat es allerdings sehr freundlich gesagt und mir dabei aufmunternd auf die Schulter geklopft. Zumindest fühlte sich das Schulterklopfen gut an. Wenn ich jetzt so rückblickend darüber nachdenke, fallen mir folgende Reimzeilen ein:
Natürlich geht es nur hinunter,
das Leben folgt der Schwerkraft leis.
Geboren wurd’ ich leicht und munter,
der Rest ist Abbau – stufenweis.
Mein Leben befindet sich sozusagen auf dem Endstück der 11.674 Stufen langen Niesen-Treppe, das tiefe Tal bereits in Sichtweite. Holadio, Heidi, Heidi …
Diese Zahlen helfen ein wenig beim Einordnen des Abstiegs auf der Lebenstreppe.
– noch nicht mal ein Jahr her seit der Bach-runter-Ansage
– 120 Tage seit dem 60. Geburtstag bis zum ersten medizinischen Abstieg
– 261 Tage bis zur alles verändernden Diagnose
– heute: 100 Tage nach dem MRT-Befund
– noch 46 Tage bis zur letzten Chemo (theoretisch)
Mathematisch betrachtet also eine überschaubare Strecke. Emotional eher eine unendliche Reihe.
Vielleicht gefällt mir Mathe am Ende ja doch noch. Mein ehemaliger Gymnasial-Mathelehrer würde dem vermutlich bis heute widersprechen. Mengenlehre allerdings war wirklich nichts für mich. Nicht wegen der Logik, sondern wegen der dauerhaften Ablenkung. In der Klasse 5a waren wir nämlich lediglich 4 Jungs. Das Verhältnis Mädchen zu Jungen betrug 6:1. Wenn ich also die Mächtigkeit von Mädchen-Mengen bestimmen und Jungs-Teilmengen bilden möchte, müsste ich folgende Aufgabe lösen:
Gesucht ist die Anzahl der Mädchen,
– die Primzahlen attraktiv finden,
– durch 3 teilbar sind,
– sich freiwillig mit mir unterhalten hätten
– und sich trotz pubertärer Unübersichtlichkeit unerklärlicherweise nicht für mich interessierten.
Aufgabe: Bestimme die Mächtigkeit dieser Menge (Hinweis: Die Lösung ist eine saubere Nullmenge).
Zumindest habe ich ja schon 22.258 Tage auf meinem Erleben-Konto. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 30.000 Tagen befinde ich mich damit in einer deutlich nicht-leeren Teilmenge. Über die Mächtigkeit der Restmenge liegen derzeit jedoch noch keine verlässlichen Daten vor.
Da es mit meiner Reimkünstlerkarriere wohl nichts wird, versuche ich es mal als mathematischer Poetry-Slammer:
Mathematiker sterben nicht, sie verlieren nur ihre Funktion und damit haben sie nicht gerechnet.
Das passiert allerdings auch Nicht-Mathematikern.
Doppel-Wumms. Doppel-Schwupp – 16. Dezember 2025
Das mit dem Doppel-Wumms war zwar gut gemeint, hat allerdings trotzdem nicht richtig funktioniert. Das monoton und kühl vorgetragene Preisbremsen- und Investitionskonzept von Herrn Komakanzler war von Anfang an eher ein Doppel-Null-Wumms. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Da kann ich mit meinem Doppel-Schwupp schon etwas mehr glänzen.
Der Doppel-Wumms schlug bei mir allerdings mit voller Kraft und völlig unerwartet zu.
Um 04:26 Uhr warf ich im Bad gestern früh das Handtuch. Sozusagen. Normalerweise meldet sich Drahti gerne kurz nach einer intensiven Radlrunde aufREIZEND zu Wort und möchte dann mit Aufmerksamkeit bedacht werden. In der Regel, also nach einer guten Stunde auf dem Sofa mit einem Wärmekissen auf dem Unterleib, hat er genug Zuneigung erfahren und gibt dann Ruhe. Gestern hat er sich das erste Mal nicht daran gehalten. Es fühlte sich so an, als hätte er im gesamten Abdomen kleine Baby-Drahties verteilt. Rostige Rasierklingen. Und dann: Angriff. Jede Bewegung fühlte sich extrem schmerzhaft an. Habe ich jede entsprechend betont? Die Blase, der Harnleiter / die Harnröhre und auch die rechte Niere. Ein Schmerz-Triumvirat mit heftiger Harnwegsinfektions-Symptomatik. Ibuprofen hatte überhaupt nichts zu melden und das vielversprechendere Novalgin war diesmal ebenfalls stumm. Ich hätte auch Smarties schlucken können. Die hätten wenigstens einen schokoladigen Nachgeschmack gehabt.
Während des Nachmittags und Abends ging es noch einigermaßen – Reizablenkung sei Dank –, aber als ich im Bett lag und den Schmerz mit allen Sinnen wahrnahm, konnte ich nach gut fünf Stunden Leiden nicht mehr. Ich stand auf und ging ins Bad. Dort stellte ich mich auf die Waage, betrachtete die digitalen fünf Kilo Übergewicht, sah meinen Blähbauch an und dachte „das war’s. Die Metastasen und der Tumor haben den Bauchraum übernommen und drücken auch Drahti in die Ecke.“
Das alles ging schneller durch meinen Kopf, als ich es hier aufschreiben kann.
In kompletter Verzweiflung nahm ich ein Zolpidem und ein Tilidin und verkroch mich ins Bett. Der vierten Chemo – nur Stunden später – sah ich mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Der gemessene Blutdruck in der Onkologie von 183 zu 113 mmHg spiegelte meinen psychisch komplett ausgelaugten Zustand perfekt wider. So fühlt sich also der wirkliche Doppel-Wumms an. Das Pre-Chemo-Rasierklingen-Burnout-Syndrom. Wumms.
Aber zum Glück gibt es ja noch Blutbildanalysen. Doppel-Schwupp, Nummer eins.
Mein Testosteron ist nicht „ein bisschen niedrig“. Es ist praktisch nicht vorhanden. Gesamt-Testosteron: 0,03. Freies Testosteron: kaum messbar. Bioverfügbares Testosteron: so niedrig, dass es eher eine Fußnote ist als ein Wert. Die ADT-Therapie wirkt also absolut nach Plan. Tumormarker & Prostata: CEA unauffällig im Verlauf. PSA sehr niedrig (0,36) und das ist klar beruhigend. Leber, Nieren, Elektrolyte – alles stabil.
Nur das „rote“ Blutbild schmollt ein wenig. Hämoglobin und Hämatokrit sind leicht erniedrigt. Das bedeutet, dass insgesamt etwas weniger roter Blutfarbstoff im Blut vorhanden ist. Die roten Blutkörperchen selbst sind jedoch normal groß und gut „gefüllt“. Mein Körper arbeitet momentan eher im Sparmodus. Meine Onkologin empfahl mir, dass ich einmal die Woche entweder zwei Kilogramm Miesmuscheln oder ein blutiges Steak essen soll. Es wurden heute Kürbiskerne mit Linsen und Spinat. Ropeye lässt grüßen.
Chemo Nummer vier verlief glücklicherweise wie die Sessionen zuvor. Reibungslos und ohne Nebenwirkungen. Selbst an die Kälte-Accessoires habe ich mich mittlerweile sehr gut gewöhnt. Vielleicht verbringe ich die Feiertage in Thief River Falls, Minnesota. Die dortigen minus 28 Grad fühlen sich für mich jetzt bestimmt normal und angenehm an.
Doppel-Schwupp Nummer zwei: Agent Doppel-J wird am kommenden Donnerstag um 11 Uhr ausgewiesen. Das One-Way-Ticket habe ich ihm schon ausgestellt. Die Druckertinte ist noch frisch. Meine Urologin hatte letztlich ein Einsehen mit mir und ich bin ihr unendlich dankbar. Drahti und ich hatten von Anfang an eine tragische Liebesbeziehung. C’est quoi l’amour? Das konnten wir beide nicht beantworten. Ich werde ihn einrahmen lassen und ihm einen gebührenden Ehrenplatz geben.
Erst kam der Wumms, frontal und roh,
riss mir den Schlaf aus dem System.
Dann kam der Schwupp, ganz leis’ und froh:
Ich bleib’ noch hier, mach’s mir bequem.
Ich gebe nicht auf.
Irgendwann knacke ich das Reimgeheimnis.
So, oder so – Happy Anniversary
Heute auf den Tag genau vor drei Monaten hatten wir unser erstes Date. Drahti & Robert. Eine kurze, intensive Beziehung. Mit klarer Rollenverteilung.
If you never try, you never know.
I have tried, now I know.
Kann man eigentlich auch mit einer Niere leben? Späßle.
Und ganz ehrlich: Der externe Urinbeutel wäre zwar eine Alternative gewesen, aber wahrscheinlich nicht die bessere.
Seitdem ich Drahti gestern vom bevorstehenden Abschied erzählt habe, ist er im Schmollmodus und hat sich wieder ein wenig beruhigt. Bringt ja auch nichts mehr.
Dem heutigen Ibuprofen hat er sich offensichtlich auch ergeben.
„Pain is inevitable. Suffering is optional.“
– Haruki Murakami.
Dopamin mal unfreundschaftlich betrachtet – 18. Dezember 2025
Drei Dinge braucht der Patient zum Glück: einen ofenwarmen Rosinenzopf, frische Süßrahmbutter und einen guten Freund am Frühstückstisch. Bonjour avec un petit-déjeuner. Der Café au Lait versteht sich von selbst.
„Wie fühlst du dich so nach der vierten Chemo?“, fragte mein fastenbrechender Gesprächspartner. Ich antwortete ihm, dass ich glücklicherweise wieder keine Nebenwirkungen hätte und es mir erstaunlich gut ginge. Ein wenig Magengrummeln hier und da und eben meine haarige Situation. Auch meine Augenbrauen und Wimpern haben jetzt beschlossen der Schwerkraft nachzugeben. Ich merkte noch an, dass der Haarverlust nicht spurlos an mir vorbeigehen würde.
Er schaute mich etwas verständnislos an und fragte dann, was ich denn wolle. Ich wäre in der siebten Dekade und für das Spiel der Verabredungen und Partnersuche würde ich längst nicht mehr aufgestellt werden. Warum ich mich so anstellen würde. Wenn ich in meinen Vierzigern bereits den kreisrunden Haarausfallsklassiker erlitten hätte, würde heute auch kein Hahn danach krähen. Wofür ich denn die Haare noch bräuchte?
Eben noch nebenwirkungsfrei – und zack – schon wieder auf dem Boden der Tatsachen. Hing ich doch an meinem Äußeren? Bin ich oberflächlich? Eitel? Und wenn ja, warum? Gute Frage. Ich beschloss die interessante Antwort darauf zu verschieben und machte mich auf den Weg in eines meiner Lieblingscafés. Dort angekommen bestellte ich mir einen leckeren Ingwertee und blätterte mich durch den Onlinethemen-Blätterwald. Ich hätte lieber etwas vom schönen März als von Herrn Merz gelesen, aber offensichtlich muss ich mich noch vier Monate gedulden.
Die Eingangstür ging auf und der Inhaber des Cafés kam herein und lief direkt auf mich zu. Wir kennen uns schon seit über dreißig Jahren und sind sehr gut befreundet. Er sah mich kurz an und sagte dann „Hallo, einen kleinen Moment bitte, ich bin gleich bei Ihnen.“
Ich muss ziemlich verwirrt dreingeschaut haben, als er sich noch einmal nach mir umdrehte, mich diesmal wirklich erkannte und sagte „Ach du Scheiße, das bist ja du! Wie siehst du denn aus? Ich dachte da sitzt ein nerviger Typ von der Behörde, den ich schon seit Monaten ignoriere. Ich habe dich überhaupt nicht erkannt.“
Ich bestellte spaßeshalber schon mal die Rechnung und wollte direkt gehen. Er setzte sich zu mir an den Tisch und sagte „Alter, du musst die Haare schwarz färben, so wie Roberto Blanco. Du bist ja schneeweiß! Das geht ja gar nicht.“
Zwei freundschaftliche Bemerkungen in nur einer Stunde. Mein zartes Selbstbewusstsein hatte kurz einen Totalausfall. Ich googelte schon mal sicherheitshalber „bestes Männerhaarfärbemittel zum Selbstauftragen“.
Ich hoffe, heute läuft wenigstens medizinisch mit dem Doppel-J alles glatt. Mein Selbstbild braucht etwas Rückenwind.
In meinem Zustand eher Sturm.
Time To Say Goodbye
„Je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in stille Freude.“
– Dietrich Bonhoeffer
Drahti ergab sich und wurde heute komplikationslos entfernt.
Meine Chef-Urologin konnte sich ein sehr zufriedenes Lächeln nicht verkneifen, als sie den abermals gesunkenen PSA-Wert in meine Patientenakte eintrug.
Dann sagte sie: „Alles deutet darauf hin, dass Ihre Prognose sehr gut ist.“
Beim Verabschieden fügte sie noch hinzu: „Wenn ich zufrieden bin, können meine Patienten auch zufrieden sein.“
Das war mein verfrühtes Geburtstagsgeschenk.
Freiheit und andere Plaisirs – 24. Dezember 2025
Wie singt Marius Müller-Westernhagen so treffend:
„Freiheit, Frei-ha-ha-ha-heit, ist das Einzige, was zählt.“
Den Text kapiere ich auch knapp 40 Jahre später immer noch nicht. Motto: Egal, Hauptsache die Leute singen irgendwie mit. Life is Life von der Gruppe Opus – drei Jahre früher – war noch unerträglicher. Toleranz ist nicht uneingeschränkt.
Wie auch immer, einhundert Stunden nach der Doppel-J-Extraktion empfinde ich genau das: Freiheit. Frei-ha-ha-ha-heit. Aber so was von. Wer schon mal Babys hatte, kennt diesen Moment ganz genau. Sobald man den Kleinen die Windel ausgezogen hat, strampeln die Bälger wie wild um sich, schauen den Windelentferner mit einem fahrradlenkerbreiten Lächeln und großen Augen an und lassen allem freien Lauf. Genauso fühle ich mich jetzt auch.
Zwei Tage nach der OP hatte ich noch unangenehmes Brennen beim Toilettengang, aber seit letztem Sonntag bin ich harntrakttechnisch symptomlos und ich sitze wieder jungfräulich auf meinem Rennradsattel, so, als wäre nie etwas passiert. Entzückt und zufrieden zu sein ist so einfach. Das Glück der Erde liegt auf dem Sattel der Drahtesel.
Heute hatte ich den Kontrolltermin beim Urologen. Mittelstrahlurinabgabe, Blutspende und Nieren-Ultraschall standen auf dem Programm. Freiheit hin oder her – der medizinische Alltag bleibt wachsam. Ersteres habe ich geradeso hinbekommen, ohne das Bad in einem desolaten Zustand zu hinterlassen. Mit der Schallung war der Facharzt grundsätzlich zufrieden. Am 05. Januar 2026 werden die Testergebnisse besprochen und dann bekomme ich auch meine nächste Trenantone-Spritze. Hypophysen-Abschaltung. Dem Testosteron keine Chance.
Eine Woche nach Chemo vier meldete sich Herr Pochonder wieder zu Wort. Kribbelnde Finger. So, als hätte ich stundenlang auf meinen Händen gesessen, bis sie eingeschlafen sind und dann wieder langsam wach werden. Muskuläre Probleme im linken Kniebereich mit Einknick- und Hinfall-Tendenz sowie Fußsohlen-Spontanschmerzen. Fast wie ein Bienenstich. Der Urologe ist immer wieder begeistert, mit welchen hypochondrischen Nebenwirkungen wir bei ihm aufschlagen. Seine Antwort dazu war: „Nein, nein und nein.“
Man kann es ja mal versuchen.
Ich habe – fast – mein altes Leben wieder. Das schönste Geschenk überhaupt. Lediglich die Medikamentenbox erinnert mich dreimal am Tag an etwas, das ich nicht spüre und daher auch nicht wahrnehme. Ich bin, wie ich mich fühle. In einem guten Monat bin ich mit der Chemo durch. Etwas, was ich mir vor knapp vier Monaten überhaupt nicht hätte vorstellen können.
Frohe und vor allem gesunde Feiertage. Und falls 2026 friedlich wird – umso besser.
Ich wäre bereit.
Ze den wihen Nahten – 25. Dezember 2025
Mittelhochdeutsch würde weiterhelfen. Zu den heiligen Nächten. Neudeutsch: Weihnachten. So gegen 336 n. Christus legte die Kirche mal eben das Geburtsdatum von Jesus Christus fest, um heidnische Bräuche zu christianisieren. Wer Böses dabei denkt. Und erst weitere 500 Jahre später wurde das Fest offiziell gefeiert. Vielleicht feiern wir dann doch nicht wirklich die Geburt Jesu am 25.12. Und der weltweite Einzelhandel hatte dann auch noch seine Finger im Spiel. Andere Religionen und ihre Bräuche und den Weihnachtsbaum mal ganz außen vor gelassen.
Mein Weihnachtsgeschenk – in Form eines 30 Zentimeter langen Doppel-J-Katheters – hing ja bereits am Weihnachtsbaum wie eine J-förmige rot-weiße Zuckerstange. Die Kalorienbombe ist die moderne Form des Abendmahls. Sie ist ein beliebter Weihnachtsklassiker und symbolisiert das Blut Christi (rot) und seine Reinheit (weiß), wobei die J-Form an den Namen Jesu erinnern soll. Absolution beim Aufspecken. Na dann.
Ich feiere dann mal sicherheitshalber das Leben, mein Leben. Und weil selbst Troubadix an Weihnachten singen darf, habe ich mal wieder die Reimfeder ins Tintenfass getunkt und vor mich her gedichtet:
Stille Nacht, heilige Nacht – Roberto-Edition
Stille Nacht, heilige Nacht,
Nichts mehr ziept, nichts mehr zwackt.
Doppel-J ist ausgepackt,
Hoffnung wird langsam aufgetankt.
Chemo und ADT
sagen dem Tumor ade.
Stille Nacht, heilige Nacht,
PSA sinkt leis’ und sacht.
Weiterleben, ganz offiziell,
alles genießen, sonnig und hell.
Nicht geheilt, neu sortiert –
Robert marschiert. Und marschiert.
Und nur für den Fall, dass die Geschichte doch nicht erfunden ist:
Alles Gute zum Geburtstag, Jeschua von Nazareth.
Danksagung – 26. Dezember 2025
Und da ich noch in weihnachtlicher Stimmung bin, möchte ich eines noch sagen: Dieser Blog wäre ohne die Menschen, die medizinisch, fachlich und menschlich an meiner Seite standen und stehen, nicht denkbar.
Mein besonderer Dank gilt den Ärztinnen und Ärzten, die mit Wissen, Erfahrung, Sorgfalt und Verantwortung dazu beigetragen haben, mein Leben zu erhalten und mir eine Zukunft zu ermöglichen.
Was sie tun, ist für sie Alltag. Für mich ist es alles. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank.
Dr. Sandra Lossau – Allgemeinmedizin
Dr. med. Uta Hofmeister – Allgemeinmedizin
Dr. med. Luai Chadid – Gastroenterologie
Dr. med. Stefan Kamp – Urologie
Dr. med. Oliver Reinecke – Radiologie
Facharzt Stephan Fischer-Wasels – Allgemeinmedizin
Prof. Dr. med. Manfred Wiesel – Urologie
Prof. Dr. med. Inga Peters – Urologie
Prof. Dr. med. Christian Menzel – Radiologie
Prof. Dr. med. Markus Giessing – Urologie
Farsad Freund – Zahnmedizin
Dr. Ionescu Bogdan Gabriel – Kardiologie
Dr. Marta Casasús Farré – Onkologie
Dr. Teresa Acuña Gutiérrez – Onkologie
Dr. Hermann Eisele – Lektorat
Team der Onkologie Krankenhaus Quirónsalud, Palma
Team der Urologie Krankenhaus Nordwest, Frankfurt
Mein Dank gilt außerdem meiner BarmeniaGothaer-Krankenkasse, die die notwendigen medizinischen Maßnahmen zuverlässig, zügig und ohne unnötige Hürden ermöglicht hat.
2.000.000.000.000
Fronti, Pochonder und mir war es etwas langweilig, also mikroskopierten wir meinen Körper auf der Suche nach möglichen Nebenwirkungen. Die Fingernägel sehen definitiv dunkler aus, leicht bräunlich verfärbt – fast wie Raucherfingernägel. Kann gut sein, schließlich schädigen Chemotherapeutika auch die Zellen der Nagelmatrix. Voilà.
Im Leberbereich unter dem rechten Rippenbogen braut sich bestimmt auch schon etwas zusammen. Leichte Druckdolenz. Und der leicht rötliche Urin stammt sicher nicht nur von der Roten Bete oder den Himbeeren. Pochonder schlug vor, vorsorglich Fieber zu messen, und Fronti tippte bereits die ärztliche Notrufnummer 116117 ins Handy, als ich gestern im Radio Folgendes hörte:
Hier die Kurzversion dessen, was mir da ins Ohr fiel:
Im beobachtbaren Universum soll es inzwischen nicht mehr nur ein paar hundert Milliarden, sondern womöglich rund zwei Billionen Galaxien geben. Hallo! Zweitausend Milliarden galaktische Systeme. Jede davon mit Milliarden, manche mit hundert Milliarden oder mehr Sternen. Sterne, die oft nicht allein sind, sondern von Exoplaneten begleitet werden – die nennt man so, weil sie nicht um unsere Sonne kreisen. Ob wirklich jeder Stern ein eigenes Sonnensystem hat, weiß niemand. Aber dass sehr viele welche haben, gilt inzwischen als ziemlich wahrscheinlich. Moderne Methoden und Daten (z.B. aus dem Hubble-Teleskop oder dem James-Webb-Teleskop) zeigen, dass viele sehr lichtschwache und weit entfernte Galaxien existieren, die früher einfach nicht gesehen wurden.
Zwei Billionen Galaxien sind keine Metapher, sondern eine rechnerische Annäherung. Und selbst das ist nur der Teil des Universums, den wir überhaupt sehen können. Was dahinter liegt, wissen wir schlicht nicht.
Fronti übernahm dann noch schnell das Kopfrechnen: Zwei Billionen Galaxien mal hundert Milliarden Sterne (angenommener Mittelwert) ergeben zweihundert Trilliarden Sterne. Plusminus ein paar.
Als ich diese Zahlen einen Moment wirken ließ, fühlte sich mein eigenes Weltbild plötzlich etwas übermöbliert an. Auch meine imaginierten Nebenwirkungen schlichen sich auf leisen Sohlen aus meinem Gedankenstübchen. Die Zahlen relativieren so manches: meine Sorgen, meine Gewissheiten und meine Wichtigkeiten. Und sie erinnern mich daran, dass Staunen eine ziemlich vernünftige Reaktion auf Fakten sein kann. Kein Beweis für irgendetwas Höheres. Es ist einfach Astronomie.
Selbst rhetorische Fragen wie „Oh man, warum läuft das nie einfach mal glatt? Ich könnte heulen“ erübrigen sich dann in der Regel recht schnell. Und die meisten meiner/unserer Probleme werden zu Selbstgesprächen.
Dazu passt ein Satz aus dem Buch der Bücher: „Was von der Stimme bleibt, ist die Botschaft, und der Überbringer der Botschaft verschwindet wieder.“
Mit anderen Worten: Selbst wenn die Person, mit der wir eine Auseinandersetzung haben, nie geboren worden wäre, hätten wir das gleiche Problem – und zwar mit uns selbst. Denn vieles spricht dafür, dass wir in der nächsten vergleichbaren Situation – mit einer anderen Person – wieder ähnlich reagieren würden.
Wenn wieder mal etwas klemmt, einfach in den Himmel schauen.
Is it just me? – 28. Dezember 2025
Mir fällt gerade auf, dass ich schon länger nichts über Schlafes Bruder geschrieben habe. Aus den Augen, aus dem Sinn. Schön wär’s. Er ist noch da. Vielleicht etwas hintergründiger als früher, aber man kann sich auf ihn verlassen. Er meldet sich gern, wenn eigentlich nichts anliegt. Unangekündigt. Manchmal aber auch ganz banal tagsüber, als Gedankenspiel beim Fahrradfahren. Man muss dann nur genau achtgeben.
Neulich habe ich im Internetradio eine Sendung aus den USA gehört. Formatradio. Keine großen Gedanken, keine tiefen Analysen. Viel Musik und viel egal. Der Moderator hat dort eine feste Rubrik. Sie heißt: Is it just me? Er erzählt darin von Dingen, die ihm wichtig erscheinen. Oder die ihn beschäftigen. Ohne Anspruch darauf, dass das für andere genauso relevant ist. Eher so: Das ist mir aufgefallen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Oder eben nicht.
Und genau das möchte ich heute auch mal tun. Ohne These. Ohne Pointe. Nur mit einer Beobachtung. Und der Frage: Bin ich der Einzige?
Ich fuhr gestern mit dem Fahrrad auf eine Ampel zu. Sie war grün. Noch. In meinem Kopf passiert Folgendes: Ich denke: Wenn ich es schaffe, noch bei Grün rüberzukommen, dann wird alles gut. Dann besiege ich die Krankheit. Zumindest fühlt es sich in diesem Moment so an. Best Case Scenario. Mein ganzer Körper schaltet auf Vorfreude. Während ich näherkomme, schätze ich die Entfernung ab. Das Tempo. Die verbleibenden Sekunden. Ich könnte ein bisschen schneller treten. Würde vermutlich reichen. Tue es aber nicht. Das fühlt sich falsch an. Als würde ich das Schicksal bescheißen. Ich muss fair bleiben. Auch bei diesen stillen Abmachungen. Ich kann kaum hinschauen. Schaue nach links oder rechts und tue so, als ob es dort etwas Wichtiges zu sehen gäbe. Pure Ablenkung. Nur nicht die Ampel im Blick haben, die plötzlich auf Gelb und dann eventuell auf Rot springt. Dann hätte ich gefühlt verloren. Wenn ich noch über Gelb fahre, wäre das ja noch in Ordnung. Gelb heißt: gerade nochmal gutgegangen. Rot hingegen … nun ja.
Ich weiß, wie das klingt. Wahrscheinlich kindisch. Oder irrational. Aber es ist erstaunlich tröstlich. Diese kleinen Deals. Diese Mikroverhandlungen mit etwas, das größer ist als ich selbst und gleichzeitig völlig uninteressiert an mir. Universum, Schicksal, Zufall – sucht euch was aus.
Ich nenne es Hoffnung. Fronti nennt es Kontrollillusion. Pochonder hebt warnend den Finger und fragt, ob das nicht schon wieder ein Zeichen einer Nebenwirkung sei.
Vielleicht ist das alles absurd. Wahrscheinlich sogar. Aber es ist auch menschlich. Wir wissen, dass wir sehr wenig bis keine Kontrolle haben. Und trotzdem versuchen wir, versuche ich es immer wieder. Mit kleinen Gesten. Mit inneren Abmachungen. Mit grünen Ampeln. Dem Schicksal ist das allerdings egal. Mir in diesem Moment nicht. Die grüne Ampel zu überfahren, fühlt sich dann für einen kurzen Moment so an, als hätte ich einen wichtigen Sieg errungen.
Vielleicht will ich Joe Black, dem Sensemann, auch nur sagen: Du kannst gerne noch warten. Ich bin noch beschäftigt. Sehr.
Is it just me?
Vielleicht. Aber selbst wenn – mir hilft’s.
Also sprach Zarathustra – 30. Dezember 2025
Taaaaa … taaaaaaaa … taaaaaaaaaaa … Ta. Taaaaaaaa …
Man muss nicht wissen, wer der musikalische Urheber ist, um die Musik zu kennen. Sie ist einfach da. Wie ein Sonnenaufgang, der sich ein wenig zu wichtig nimmt. Also sprach Zarathustra. Alle kennen die Melodie. Kaum jemand weiß, worum es eigentlich geht. Was vermutlich ganz gut passt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, worum es geht. Ich habe Ariadnes Faden schon vor einiger Zeit verloren und irre ein wenig im Labyrinth des Lebens herum. Meinen Metastaurus habe ich allerdings noch nicht erledigt.
Ich hatte die Melodie von Richard Strauss als Hintergrundmusik im Kopf, als mir klar wurde: Noch 28 Tage bis zur letzten Chemotherapie. Achtundzwanzig. Ein Mondumlauf. Ein Countdown. Mein Countdown? Eine Zahl, die überschaubar genug ist, um Hoffnung zuzulassen, und groß genug, um ein bisschen Drama zu rechtfertigen. Zarathustra passt da dann doch ganz gut dazu.
28 Tage sind nichts. Und alles. Für mich.
Nietzsche hätte das vermutlich nicht beeindruckt. Er war kein Freund von linearen Erlösungsfantasien. Keine Heilsgeschichten, kein „danach wird alles gut“. Eher: Danach wird es anders. Und das muss reichen.
In „Also sprach Zarathustra“ lässt Nietzsche seinen Propheten verkünden, dass es keinen höheren Sinn von außen mehr gibt – und dass der Mensch lernen muss, sein Leben selbst zu bejahen, immer wieder, ohne Trost von oben. Vielleicht bin ich ja doch auf dem richtigen Weg.
Chronisch. So soll meine Krankheit dann heißen. Ein Wort wie ein weiches Kissen. Chronisch klingt nach Alltag, nach Management, nach etwas, das man sich einrichtet. Ist aber kein Ende. Eher eine neue Vereinbarung. Mit meinem Körper. Mit der Zeit. Mit meiner Geduld.
Die sechste – und hoffentlich letzte – Chemotherapie wird nachwirken. Wochenlang. Monatelang.
Vielleicht ist das der eigentliche Zarathustra-Moment: zu akzeptieren, dass ich nicht auf einen Gipfel zusteuere, sondern auf ein Plateau. Keine Apotheose. Kein Sieg. Nur der nächste Takt.
C – G – C – C – C
Die Musik darf dramatisch sein. Das Leben danach darf gerne undramatisch bleiben. Dramatik hatte ich in den letzten Monaten genug.
Das reicht fürs Erste.
Altruistischer Egoismus – 31. Dezember 2025
Die evolutionäre Psychologie sagt, dass es keinen Altruismus gibt. Das seien nur Hormone. Eine kryptische Wissenschaft, die erstaunlich gut darin ist, alles, was wir tun, auf unser steinzeitliches Verhalten zurückzuführen. Partnerwahl, Freundschaft, Großzügigkeit – am Ende geht es angeblich immer nur um eines: die bestmögliche Verzinsung unserer Gene. Die evolutionäre Psychologie beruft sich gern auf Darwin – geht aber oft sehr viel weiter, als Darwin selbst je gegangen wäre. Also: Lang lebe der Egoismus. Zumindest in der Theorie.
Wir investieren also unser Risikokapital in andere Menschen. In Beziehungen. In Geschenke. In angebliche Hilfsbereitschaft. Und wenn dann nach neun Monaten etwas zur Welt kommt, das den Erwartungen entspricht, war es ein gutes Investment. Radikal und konsequent zu Ende gedacht. Selbst dann, wenn wir scheinbar selbstlos handeln, tun wir es angeblich nur, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Wir erwarten dann, dass von der anderen Person irgendwann etwas zurückkommt. Manchmal genügt schon eine fast beiläufige Bemerkung, um eine Gegenleistung einzufordern:
„Schatz.“
„Ja?“
„Ich liebe dich.“
„…“
„Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe?“
„Ja, klar.“
„Und?“
Oder weil wir uns damit Dankbarkeit sichern. Oder – im religiösen Fall – einen besseren Platz im Himmel. Ich hoffe, das ist nicht zu blasphemisch gedacht. Zum Thema Egoismus ein Zitat von Michael Ghiselin: „Kratz einen Altruisten, und du siehst einen Heuchler bluten.“ Heuchler kann man hier alternativ auch durch Egoisten ersetzen.
Das alles klingt kalt. Und zynisch.
Ich musste daran denken, als ich kürzlich wieder mal in meinem Lieblingsbrillengeschäft war. Den Inhaber und seine Frau kenne ich seit fast 35 Jahren. Beide lesen diesen Blog. Vor allem sie hat mir erzählt, wie sehr sie meine Geschichte berührt hat. Fast beiläufig. Nicht aufdringlich. Nicht mitleidig. Einfach ehrlich und völlig unerwartet.
Und dann stellte sie eine Frage, mit der ich nicht gerechnet hatte. Wie sie denn dem Krankenhaus, aus Dankbarkeit, etwas spenden könne. Nicht öffentlich. Nicht symbolisch. Genauer gesagt der urologischen Abteilung, die mich begleitet, behandelt, trägt. Einfach nur so. Herr Ghiselin, Sie haben das Wort.
Sie ist gläubig. Nicht missionierend. Sehr leise. Vielleicht möchte sie das tun, weil ihr Glaube Nächstenliebe vorgibt. Vielleicht weil es sich für sie einfach richtig anfühlt. Ehrlich gesagt: Der Grund, ihre Motivation, ist nicht entscheidend. Letztlich kommt es auf die Folgen ihrer selbstlosen Geste an.
Wenn wir wirklich alle Egoisten sind – dann ist mir ein Ichmensch, der spendet, lieber als einer, der sein ganzes Kapital für sich behält. Selbst wenn der Selbstsüchtige nur spendet, um sich gut dabei zu fühlen. Ein gutes Gefühl auf der einen Seite und gleichzeitig echte Hilfe auf der anderen sind kein Widerspruch. Sie können koexistieren. Müssen es vielleicht sogar.
Vielleicht gibt es keinen Altruismus, sondern nur altruistischen Egoismus. Aber es sind dann am Ende Handlungen, die anderen helfen. Und das ist wundervoll.
Wenn selbstloses Verhalten Egoismus ist, wünsche ich uns allen sehr viel davon. Und: uns allen ein gesundes neues Jahr 2026.
Vor allem mir. Natürlich völlig altruistisch gedacht.
Auf ein Neues – 01. Januar 2026
Der Jahreswechsel ist ja so eine merkwürdige Sache. Ein Datum, das so tut, als hätte es Macht. Als würde um Mitternacht etwas klicken, ein Schalter umgelegt, ein Reset stattfinden. Die berühmte New Years Resolution. „Dieses Jahr werde ich endlich …“. Und doch weiß man: Das Leben macht bei alldem oft nicht mit. Es fließt einfach weiter. Unbeeindruckt. Eigenwillig. Manchmal gnädig, manchmal grob. Unberechenbar.
Ich gehe in dieses Jahr mit weniger Selbstverständlichkeiten als früher. Mit mehr Demut. Und auch mit mehr Zuversicht. Nicht weil alles gut ist oder sicher, sondern weil ich gelernt habe, dass Hoffnung eine Haltung ist. Eine Entscheidung. Mind over matter.
Die nächsten vier Wochen sind keine Fußnote. Da stehen noch zwei Chemos im Kalender. Und irgendwo am Horizont wartet Ende Februar dieses PET-CT, von dem ich hoffe, dass es freundlich zu mir ist. Mehr erwarte ich gerade gar nicht. Keine Wunder. Freundlichkeit reicht.
Was ich mir für dieses neue Jahr wünsche, ist erstaunlich unspektakulär: Zeit. Gute Gespräche. Momente, die nicht fotografiert werden müssen, um zu bleiben. Und die Fähigkeit, das, was da ist, zu bemerken, zu spüren. Wahrzunehmen.
Ich habe im letzten Jahr gelernt, dass Nähe nichts mit Reden zu tun hat. Dass Menschen manchmal einfach da sind – ohne Lösung, ohne Rat, ohne Agenda. Und dass genau das oft alles ist, was ich brauchte. Ein Mitgehen. Eine Umarmung. Dafür bin ich unendlich dankbar.
Dankbar für Familie. Für Freunde. Für Begegnungen. Das ist ein Geschenk, das ich nicht planen kann.
Ich weiß nicht, was dieses Jahr bringen wird. Aber ich weiß, wie ich ihm begegnen möchte: neugierig. Wertschätzend. Genießend. Und so liebevoll wie möglich – mir selbst gegenüber eingeschlossen.
Falls 2026 also ein Motto braucht, dann vielleicht gar keins.
Danke, dass ihr da seid.
Die Grammatik meines Lebens – 04. Januar 2026
Die Diagnose vor vier Monaten kam wie ein Ausrufezeichen. Prostatakrebs. Plötzlich war alles laut. Ein Wort, das den Lebenssatz unterbricht und dann dominiert. Die Zeit stand still, oder vielleicht stand nur ich still, während alles andere weiterlief. Ein Ausrufezeichen duldet keinen Widerspruch, es lässt keinen Raum, es ist einfach da. Es behauptet sich. Es reißt das Drehbuch an sich. In diesem Moment gab es nichts anderes.
Dann, fast unmerklich, schlich sich das Fragezeichen ein und schob das Ausrufezeichen ganz sanft beiseite. Was wird sein? Was kommt? Was passiert jetzt mit diesem Satz, mit diesem Leben, mit meiner Geschichte? Das Fragezeichen ist zwar wesentlich leiser als das Ausrufezeichen, aber nicht weniger mächtig. Es bohrt, es bleibt, es lässt mich nicht los. Es zwang mich zwar nicht zu einer Antwort, aber es verlangte Aufmerksamkeit. Von mir. Ich sollte alles hinterfragen. Meine weitere Lebensplanung: Water under bridges that have already burned. Gregory Porter skizziert das in seinem Song genial.
Solange Fragen da sind, ist noch nichts entschieden. Solange gefragt wird, ist der Satz offen.
Danach rutschte dann ein Komma in meine Geschichte. Kein Punkt. Kein Ende. Ein kurzes Innehalten. Ein Atemholen. Das Komma verändert den Rhythmus, nicht den Sinn. Der Satz läuft weiter, aber anders. Langsamer vielleicht. Bewusster. Ein Komma sagt: Da ist noch ein Nebensatz. Ein Relativteil. Es ist noch Zeit. Es geht weiter. Der Satz – mein Lebenssatz – ist noch nicht zu Ende.
Der Punkt steht noch aus. Der Punkt wäre endgültig. Er beendet, was war, und lässt nichts folgen. Vielleicht gehört er irgendwann ans Ende dieses Satzes. Sehr wahrscheinlich. Vielleicht setzt ihn das Leben selbst. Aber nicht jetzt. Jetzt wäre er falsch. Jetzt würde er für etwas stehen, das grammatikalisch noch nicht an der Reihe ist.
Ein falsch gesetztes Komma kann über Leben und Tod entscheiden:
„Kill him not, let him live.“
„Kill him, not let him live.“
Ich werde sehr genau darauf achten, die Satzzeichen meines Lebens richtig zu setzen.
Der Satz ist hoffentlich noch lange nicht zu Ende.
Es ging und geht immer weiter – 05. Januar 2026
Es gibt Zeiten, in denen sich die Welt schwerer anfühlt als sonst. Die Nachrichten klingen dunkler, die Zukunft wirkt enger und Gewissheiten sind brüchiger. Krisen sind nicht mehr Randnotiz, sondern Dauerzustand. Krieg in der Ukraine. Spannungen rund um Taiwan. Jetzt auch Venezuela. Die Klimakrise und die globale wirtschaftliche Unsicherheit. Man muss sie nicht im Detail kennen, um zu spüren, dass sie da sind. Sie liegen wie ein Grundrauschen unter dem Alltag. Viele Menschen sind davon müde geworden. Ängstlich. Oder beides. Nicht aus Schwäche, sondern aus Überforderung.
Dabei ist das Leben der Menschheit fast durchgehend von Krisen begleitet worden. Der Dreißigjährige Krieg. Zwei Weltkriege. Der Kalte Krieg. Die Kubakrise. Zeiten, in denen Menschen ernsthaft glaubten, am Rand des Endes zu stehen. Jede Generation hatte ihre Gründe dafür. Und jede hielt sie für einzigartig. Und doch ging es weiter. Nicht immer gut. Nicht immer gerecht und vor allem nicht ohne Verluste. Aber es ging weiter. Irgendwie.
Ich denke in solchen Momenten oft an meine Großmutter. Geboren 1921. Eine junge Frau in einer Zeit, in der das Wort Hoffnung keinen großen Stellenwert hatte. Hoffnung war einfach stilles Überleben. 1943/44 schwanger mit meiner Mutter. Am 19. März 1944 verliert sie bei der Hauptbombardierung Frankfurts alles. Am 20. März 1944 wird meine Mutter geboren. Einen Tag nach dem Totalverlust. Nur einen Tag nach der Zerstörung.
Ihr Mann, mein Großvater, war zu dieser Zeit an der Ostfront, in Tschenstochau. Später jahrelang in russischer Kriegsgefangenschaft. Sie war allein. Ohne Besitz. Ohne Gewissheit. Mit einem Neugeborenen und einem Bollerwagen mit Habseligkeiten. Sie überlebte unter Umständen, die man sich heute kaum vorstellen möchte. Ich kenne ihre Geschichte. Aber ich erzähle sie hier nicht im Detail. Sie braucht keine Ausschmückung.
Was mich an ihr immer wieder berührt, ist nicht Heldentum. Es ist etwas viel Nüchterneres: Sie lebte weiter. Nicht, weil sie musste, sondern weil sie wollte. Und weil das Leben offenbar stärker ist als jede Krise.
Vielleicht denke ich deshalb in meiner eigenen Situation ähnlich. Meine Krankheit ist meine Krise. Sie ist real. Sie ist fordernd. Sie stellt Fragen. Aber sie ist nicht alles. Ich versuche, den Alltag nicht zu verlieren. Routinen zu pflegen. Das zu tun, was möglich ist. Und das zu lassen, was ich nicht kontrollieren kann. Leben – nicht als Parole, sondern als Haltung.
Ich glaube weder an Verdrängung noch an Dauerpanik. Ich versuche wach zu bleiben. Informiert zu sein. Und trotzdem glaube ich – allen Diagnosen zum Trotz – an das Leben. Das Weiterleben. Das will ich.
Wenn ich eines aus all dem gelernt habe – aus der Menschheitsgeschichte, aus den Geschichten meiner Familie und aus meiner eigenen –, dann vielleicht dies: Krisen kommen. Manchmal bleiben sie lange. Sie verändern Leben. Sie zerstören Illusionen. Aber sie beenden nicht zwangsläufig alles. Es ging immer weiter. Und es geht immer weiter. Das Leben hat einen eigenartigen und stillen Drang, sich fortzusetzen.
Das ist Hoffnung genug.
13 Wochen routiniert – 06. Januar 2026
Chemo, die fünfte. Klappe. Cut. Danke. Das onkologische Team war zufrieden und verabschiedete mich sehr freundlich. Das fühlt sich mittlerweile alles wie eine erfolgreiche Routine an. En route, wie die Lehnwort-Franzosen dazu sagen würden. Je suis en route. Très bien.
Das gilt auch für das regelmäßige Blutspenden. Noch vor einigen Wochen fühlten sich die Blutwertanalysen für mich eher wie eine zusätzliche Baustelle an. Heute wirken sie nüchterner, ruhiger. Ja, es gibt Veränderungen – die Chemotherapie hinterlässt ihre Spuren. Das merke ich auch im Alltag, vor allem in Form von muskulärer Kraft- und Saftlosigkeit. Gleichzeitig ist vieles stabil geblieben: die weißen Blutkörperchen, die Blutplättchen, die Nierenwerte. Auch die Leber macht weiterhin unauffällig ihren Job. PSA und Testosteron sind nach wie vor sehr niedrig. Der PSA-Wert sinkt weiter – und das ist im Moment die entscheidende Botschaft. Der Unterschied zu früher: weniger Anspannung und Unruhe, mehr Gewohnheit. Notwendige Kontrollen. Teil der Routine. Es ist alles schon etwas anstrengend, keine Frage – aber es fühlt sich jetzt entspannter an. Erfolgreiche dreizehn Wochen.
Auch die 260 ml Docetaxel tröpfelten anschließend während der einstündigen Infusion anstandslos in meinen Blutkreislauf und haben sich hoffentlich an die noch verbliebenen, sichtbaren, aktiven Metastasen angedockt und mit der Hemmung der Zellteilung begonnen. My name is Doce. Doce Taxel – with a license to kill.
So schnell können Nebenwirkungen einsetzen. Im Fachjargon heißt dieser Zustand: Chemo-Brain. Also: Konzentrations-, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen. Was wollte ich eigentlich nochmal sagen?!
Ich war sehr froh, dass ich die – hoffentlich – vorletzte Chemosession hinter mir hatte. Jetzt werde ich alles tun, um meinen Körper in den nächsten drei Wochen so fit wie möglich zu bekommen, um dann Nummer sechs im Chuck-Norris-Stil willkommen zu heißen: Mein Docetaxel greift keine Krebszellen an. Die Krebszellen lösen sich freiwillig auf.
Und da man auf einem Bein nicht stehen kann, dachte ich mir: Chemotherapie allein ist ja mittlerweile keine Aufgabe mehr, am besten auch noch nachmittags beim Urologen vorbeischauen. Chemo-Brain eben. Die zweite Trenantone-Spritze stand ja noch aus. Der leichte Regen machte die Urologen-Radrundfahrt weder einfacher noch angenehmer. Seine Untersuchung schon. Alles so, wie es sein soll. Beide Nieren und Untenrum geschallt. Unauffällig. Und die nächste Geschlechtshormon-Reduktionsspritze wurde auf Ende nächster Woche verschoben. Er meinte, man müsse es nicht übertreiben.
Allerdings hatte ich mit dem Urologiefacharzt ein Déjà-vu. Als er mich im Wartezimmer abholen wollte, schaute er erst mich an, dann den freundlich dreinschauenden Herrn zu meiner Rechten und dann wieder zu mir. Er war sichtlich unsicher, wen er als Nächstes in sein Besprechungszimmer bitten sollte. Er hatte mich schlicht nicht (mehr) erkannt.
Hair is everything.
Morgen gehe ich zu Dominique und kümmere mich um das Wesentliche: meine Perücke.
Ich dachte schon … – 08. Januar 2026
Nach der vierten Chemo dachte ich, das würde sich wohl weitgehend geräuschlos erledigen. So nach dem Motto: ein bisschen Infusion – und gut ist. Chuck Robert Norris lässt grüßen. Docetaxel als unauffälliger Mitläufer. Sehr höflich. Wie eine Vitamininfusion in einer dieser hippen Drip Bars. Vom Preis her kann Docetaxel da ja locker auf die Klammer hauen und schön angeben. Der Porsche unter den Infusionen.
Tja.
Offenbar hat Doce spätestens nach der fünften Gabe beschlossen, mich freundlich daran zu erinnern, dass er keine Vitamininfusion ist. Schöne Vorstellung eigentlich. Leider falsch.
Es fing schleichend an. Ein leichtes Brennen in der Leiste, so vage, dass ich es erst einmal ignoriert habe. Hat nicht geholfen. Dann eine kleine Ausstrahlung in den oberen Oberschenkel – nichts Dramatisches, eher so, als würde jemand unter der Haut leichte Stromimpulse setzen. Ein Dauerkribbeln.
Dazu gesellten sich leichte Ansatzkrämpfe in den hinteren Oberschenkeln, vor allem nach zu langem Sitzen. Und dann – mein persönlicher Favorit – ab und zu dieses Brennen in den Fußsohlen. Kurz, überraschend, intensiv. Wie barfuß auf eine Zigarette treten. Ohne Zigarette. Einfach so. Hinterhältig.
Und als wäre das nicht genug, kommt auch noch Müdigkeit dazu. Diese spezielle Form von Schlappheit, bei der man glaubt, man sei eigentlich völlig okay – bis man im Stehen fast einschläft. Rein hypothetisch natürlich. Allerdings fielen mir tatsächlich im Sitzen die Augen zu. Vielleicht habe ich auch Monotonieintoleranz und sollte mir einen neuen, abwechslungsreicheren Job suchen. Oder es liegt an langweiligen Nachrichten. Ist ja auch kaum etwas los in der Welt.
Das alles ist nichts, was mir Sorgen oder gar Angst bereitet. Es ist eher eine Erinnerung daran, dass mein Körper gerade ziemlich beschäftigt ist. Dass Docetaxel seinen Job macht. Nicht laut, sondern hartnäckig. Allerdings nicht mehr klammheimlich. Diese Nebenwirkungen nehme ich gerne in Kauf, wenn sich dafür die Metastasen verabschieden. What do you win. What do you lose.
Ich hatte wirklich kurz geglaubt, ich käme unbemerkt durch die Chemotherapie. Aber offenbar gilt auch hier: Wer zu früh auf Entwarnung setzt, kann freundlich eines Besseren belehrt werden. Kein Sieg der Hoffnung über die Vernunft. Eher ein bewusstes Festhalten. Doce hatte da offensichtlich etwas dagegen.
Also nehme ich es zur Kenntnis. Beobachte weiter. Passe mich an. Ziehe noch bequemere Hosen an. Stehe öfter auf. Und merke mir: Der Weg ist noch lang.
„Nur wer das Ziel kennt, findet den Weg.“
– Laotse
Werde ich doch noch sentimental und empathisch? – 10. Januar 2026
Ich lauschte verträumt einer schönen Ballade, während ich mit meinem Stahlross durch die Gegend pedalierte und – allem Anschein nach – von der Emo-Muse geküsst wurde. Passiert, allerdings selten. Meine linke Gehirnhälfte hat ja typischerweise das Lenkrad in der Hand. Also so ungefähr 99 % der Zeit.
Das eine Prozent brach sich allerdings unerwartet Bahn und meine rechte Hemisphäre (Spitzname: Rehemi) stand plötzlich mit dem Talking Stick in der Hand am Selbstgespräch-Rednerpult. Apropos Talking Stick: Das wäre doch eventuell wieder mal was für die Roberto-was-ist-was-Abteilung:
Der Talking Stick – auf Deutsch ungefähr so etwas wie ein Redestab – ist eine alte Idee indigener Kulturen Nordamerikas. Eigentlich verdächtig simpel: Wer den Stab in der Hand hält, darf sprechen. Alle anderen hören zu. Wirklich zu. Keine Zwischenrufe, kein „Ja, aber …“, kein gedankliches Vorformulieren der eigenen Genialität. Erst zuhören, dann reden. Allein das wäre schon revolutionär genug. Aber der Talking Stick kann noch mehr. Denn man bekommt ihn nicht einfach so weitergereicht. Wer danach etwas sagen möchte, muss zuerst wiedergeben, was der Vorredner (gerne auch weiblich) gesagt hat. Zeigen, dass man verstanden hat. Erst wenn das Gesagte wirklich angekommen ist, darf man selbst etwas hinzufügen. Oder schweigen.
Das ist konsequente Kommunikation. Zuhören als Eintrittskarte zum Reden. Verstehen als Voraussetzung für Meinung. Und – vielleicht – liegt genau darin seine stille Weisheit: Der Stab ist weniger ein Werkzeug zum Sprechen als eines zum Denken. Und vielleicht manchmal auch eines zum Bremsen. Ich frage mich gerade, wie Gespräche heute klingen würden, wenn wir Talking Sticks benutzen müssten. Eine sehr schöne Vorstellung.
Zurück zu Rehemi an der Bütte: Der Song sei doch eine schöne Inspiration, und ich sollte mir doch mal ein paar schöne Analogien einfallen lassen, also meine innere emotionale Sprache zu Wort kommen lassen. Nach einundsechzig Jahren endlich auch mal mit dem Herzen sprechen. Aus den Augenwinkeln sah ich noch, wie meine Ratio das Handtuch warf.
Der Song handelt von unerwiderter Liebe und dem tiefen, schmerzhaften Wunsch, dass die Person, die die Protagonistin verlassen hat, deren Gefühle verstehen und die wahre Tiefe ihrer Liebe erkennen möge, bevor sie gegangen ist. Ups, das ist dann doch etwas zu viel Romeo & Julia für mich. Allerdings inspirierte mich der Titel des Songs. Auf Deutsch in etwa „Hast du jemals …?“
Und ich fragte mich selbst: „Hast du jemals …?“
„Hast du jemals gespürt,
dass Staunen nichts mit Wissen zu tun hat?“
„Hast du jemals bemerkt,
dass manche Dinge einfach sind
und nicht erklärt werden wollen?“
„Hast du jemals erfahren,
dass das Leben manchmal nicht beantwortet werden muss,
sondern gelebt?“
„Hast du jemals verstanden,
ohne etwas begreifen zu müssen?“
„Hast du jemals etwas angeschaut
wie ein Kind, das zum ersten Mal
einem alten Baum gegenübersteht?“
Aus der Ratio-Ecke vernahm ich ein dezentes Schnarchen. Rehemi allerdings war schon ein bisschen stolz auf mich und gab mir zufrieden und lächelnd den Redestab.
Ich hatte nichts mehr zu sagen.
Nur weil man etwas nicht sehen kann …
… bedeutet das nicht, dass es nicht da ist.
Dieses Statement habe ich das erste Mal in dem Film Small Soldiers aus dem Jahr 1998 wahrgenommen. Weihnachtsfilme haben diesen Satz bestimmt auch mehrfach gekapert. „Doch, du Süßer. Den Weihnachtsmann gibt es wirklich. Den kann man nur nicht sehen, weil er so schnell unterwegs ist.“
Gestern gab es hier Windböen bis zu 75 Kilometer pro Stunde. Herrlich. Ich stand einfach da und ließ mich so richtig durchlüften. Die Pochondergedanken gleich mit.
Apropos Wind: Obwohl ich ein Feuerzeichen bin – also ein waschechter Schütze gepaart mit Lóng, dem chinesischen Drachen – ist mein Lieblingselement die Luft. Womit wir wieder bei der Kapitelüberschrift wären. Da kommt dann wohl auch meine aszendentische Waage ins Spiel. Allgemein heißt es ja, dass der Aszendent im Alter stärker zum Vorschein kommt. Und offenbar hat das Luftelement inzwischen – wie es seine Art ist – unsichtbar das Heft in die Hand genommen. Mein Sternzeichenelement, das Feuer, das während meiner Jugend dominanter war, hat sich bei mir inzwischen still und leise verabschiedet. Nix mehr mit Energie, Leidenschaft und Abenteuer. Der Ofen ist offenbar aus.
Der Grundstoff Luft dagegen verbindet das Geistige mit dem Körperlichen und wird mit dem Atem, dem Denken, der Kreativität, Anpassungsfähigkeit und sozialem Austausch assoziiert. Hm. Bis auf den Atem auch nicht so wirklich zutreffend für mich. Vielleicht sollte ich doch nochmal mein Geburtshoroskop bei einem Profi erstellen lassen. Element Holz würde jetzt eigentlich ganz gut passen.
Zurück zum Gasförmigen: Ohne Luft ist schnell Schluss. Kein Leben, kein erster Gedanke, kein letzter. Der erste Atemzug ist der Startschuss, die letzte Ausatmung: der Abspann. Dazwischen atmen wir uns durchs Leben – meist ohne groß darüber nachzudenken. Luft ist immer da, aber selten Thema. Außer sie ist verschmutzt. Man sieht sie nicht, man besitzt sie nicht, und trotzdem trägt sie so viel: Stimmen, Musik, Gerüche. Sie kann flüstern oder brüllen. Sanft streicheln oder ganze Landstriche umräumen. Luft ist leicht und gleichzeitig unfassbar stark. Immer unberechenbar. Und vielleicht gerade deshalb mein Lieblingselement. Außer als Gegenwind beim Fahrradfahren. Speziell bei einem Testosteronwert nahe null.
Wahrscheinlich könnte ich ähnlich wichtige und interessante Punkte über die anderen drei Elemente schreiben.
Mache ich aber nicht.
Au Restaurant La Chimio – 12. Januar 2026
Die sehr freundliche Bedienung stellte sich kurz vor und reichte mir das Menü. „Mein Name ist Zyto und ich bediene sie wie immer.“ Sie sagte mir, ich solle mir ruhig Zeit lassen, sie würde meine Bestellung aufnehmen, sobald ich so weit sei. Das Menü an sich sah nicht wirklich anregend aus und auch die verschiedenen Optionen waren eher unleserlich. Die Lesebrille hatte ich wie immer nicht dabei und entsprechend Mühe, die Alternativen zu entziffern. Ich glaube, da stand:
Sehr häufig:
– Erschöpfung (Fatigue)
– Haarausfall
– Abfall der weißen Blutkörperchen
– erhöhte Infektanfälligkeit
Häufig:
– Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen
– Schleimhautreizungen
– Geschmacksveränderungen
– Wassereinlagerungen
– Nagelveränderungen
Mit zunehmender Zykluszahl häufiger:
– Neuropathien (Kribbeln, Taubheit)
– verlängerte Erholungsphasen
– allgemeine Kraftlosigkeit
Schon kurze Zeit später stand Zyto wieder neben mir und wollte wissen, ob ich mich denn schon entschieden hätte. Ich war noch unentschlossen und fragte sie, ob es denn auch ein Degustationsmenü geben würde. Also lieber von allem etwas. Sie lächelte mich freudig an und sagte: Natürlich bieten wir Ihnen das gerne an. Einmal Degustation. Und da ich jetzt schon seit der Eröffnung vor gut vierzehn Wochen Stammgast sei, würde sie den Maître de Cuisine bitten sein Bestes zu geben.
Mit anderen Worten: Nach der fünften Session hatte Docetaxel keine Lust mehr, sich zurückzuhalten.
Jetzt ist alles da. Nicht wirklich spektakulär. Nicht richtig fies. Aber eben: komplett. Das ist ein Chemo-Degustationsmenü, bei dem man am Ende merkt, dass man zwar nichts ablehnen musste – aber auch nichts mehr bestellen würde.
Es beginnt harmlos. Ein leichter Schwindel, der kurz fragt, ob man gerade aufgestanden ist oder ob der Boden ein bisschen nachgegeben hat. Der Puls ist wesentlich schneller als sonst, dabei erstaunlich schüchtern – hochfrequent, aber beim Tasten eher zurückhaltend. Ich musste den Puls elektronisch messen, um mich zu vergewissern, dass ich noch einen hatte. Dazu gelegentlich ein paar Extrasystolen, die sich anfühlen wie ein kleiner Schluckauf im Brustkorb. Nichts Bedrohliches. Aber auch nichts, was sich angenehm anfühlt. Lub-Dub – Lub-Dub – Lub-Dub – Lub-Dub – Lub-Dub.
Ein Hoch auf die Herzaussetzer.
Die Muskeln machen jetzt gerne ihr eigenes Programm. Krämpfe hier, ein Ziehen da. Auch nicht dramatisch, eher so, als hätten sie beschlossen, jetzt regelmäßiger aus der Reihe zu tanzen.
Dann diese punktuellen Dinge. Kurze, stechende Schmerzen, die kommen und gehen, ohne sich groß vorzustellen. Ein Brennen in der Fußsohle – als hätte jemand dort testweise eine Teelichtflamme platziert. Und eine leichte neuropathische Ausstrahlung in der rechten Leiste und im Oberschenkel. Kein Feuerwerk. Eher ein leises Nachglimmen. Die Finger der rechten Hand gesellen sich jetzt ebenfalls dazu.
Die Fatigue ist natürlich auch dabei. Alles geht – aber langsamer. Mit Sofapausen. Und ja, die Haare. Die haben sich fast alle verdünnisiert. Im Sinne des Wortes.
Das Ganze fühlt sich tatsächlich wie ein sorgfältig komponiertes Menü an: von allem ein bisschen. Nichts wirklich ungenießbar. Aber am Ende sitze ich da, lehne mich zurück und denke: Okay. Jetzt reicht’s eigentlich.
Der Maître weiß offenbar, was er tut. Und ich darf darauf vertrauen, dass nach dem Degustationsmenü irgendwann wieder à la carte bestellt werden kann. Mit Appetit auf weniger. Gerne auch mit Heilfasten.
Weniger ist in meiner Situation wahrscheinlich mehr.
Nachtisch – 13. Januar 2026
Wenn der Preis für die Wirkung der Chemotherapie zusätzliche Nebenwirkungen sind, dann gehören die ebenfalls ins Degustationsmenü. Also dann, her mit den Entremets. Und wie sich das für ein Degustationsmenü gehört, wurden alle aufgetischt:
Desserts – au choix
– Geschmacksverlust
– eine etwas pelzige Zunge
– teilweise taube Lippen
– polyneuropathische Fußzehen und Finger (fühlen sich zusätzlich auch kalt an)
– Gehen wie auf Wattebäuschen
– Dazu ein dezentes Taubheitsgefühl unter den Fußballen – wie nach einer lokalen Anästhesie. Ich habe das Bedürfnis, permanent Wiederbelebungsversuche zu starten.
– Und auch der Magen-Darm-Trakt trollt nun spürbar vor sich hin
Auf Französisch klingen einige der Nachspeisen wie aus dem Menü eines Sternerestaurants:
– Perte du goût
– Langue légèrement pâteuse
– Lèvres partiellement engourdies
– Polyneuropathie au niveau des orteils et des doigts
Lecker. Ich wollte schon auf Französisch bestellen, sagte der Kellnerin dann aber, dass mir die Reihenfolge egal sei, ich müsste ja sowieso alle nehmen und brav aufessen. Zyto nickte mit dem Kopf und verabschiedete sich mit einem Bon appétit!
„Man lernt viel über jemanden, wenn man gemeinsam mit ihm isst.“
– Anthony Bourdain
Situationsabhängige Symptomfluktuation – 15. Januar 2026
Wenn ich stattdessen „Schrödingers Symptom“ in der Headline verwendet hätte, wüsste vermutlich trotzdem niemand – mich eingeschlossen –, worum es in diesem neuen Kapitel eigentlich geht. Die Worte Vorführeffekt oder Weißkittel-Effekt wären da bestimmt besser für die bildhafte Vorstellung gewesen.
Wer kennt eigentlich noch diesen Spruch aus meiner Kindheit?
„Die voluminöse Expansion der Knolle verhält sich reziprok zum geistigen Potenzial des Agrarökonomen.“
Wer unangenehm auffallen wollte, sprach dann eben so daher. Alle anderen sagten dazu: „Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln.“
Das alles erinnert mich an die Phrasendreschmaschine. Die kam Anfang der 1980er Jahre auf den Markt. Sie hatte drei doppelseitige Drehscheiben mit konservativen und progressiven Begriffen, die man beliebig kombinieren konnte – und zeigte das Phrasenpotenzial der deutschen Sprache in seiner Reinform. Hier ein paar Beispiele:
– Es wird Zeit für eine „abendländische Gewissens-Aussage“.
– Wir sollten einstehen für eine „funktionale Innovation-Struktur“.
Für mich und meine Situation fällt mir da spontan Folgendes ein: „Hör auf deinen Körper, verliere dabei aber nicht den Fokus auf deine innere Balance im Außen.“
Ich glaube, ich habe den Faden ein wenig verloren.
Also zurück zum Weißkittel-Effekt. Ich war heute wieder mal beim Urologen. Halbzeit zwischen Chemo fünf und sechs. Blutspenden stand auf dem Programm. Je näher ich der urologischen Praxis kam, desto mehr verabschiedeten sich die Nebenwirkungen. Kaum angekommen hatte ich eine Spontanheilung. Quasi. Glücklicherweise hatte der Doc keine Zeit und die freundliche Arzthelferin zapfte mich an. Die Ergebnisse und alles weitere könne ich ja am kommenden Freitag direkt mit ihm besprechen.
Seit dem Besuch heute Vormittag sind nun gut zehn Stunden vergangen und die Nebenwirkungen haben offensichtlich immer noch keine Sperrstunde.
Symptomfreiheit kann man erst dann wirklich genießen, wenn man keine Symptome hat.
Das Leben ist viel zu kurz, um normal zu sein.
Früher war mehr Lametta – 16. Januar 2026
Präsenzerziehungsunterricht durch meine Mutter ist recht häufig ausgefallen. Meine Zwillingsschwester und ich wurden großteils von unserer Oma versorgt. Ist ja auch eine Mutter. Allerdings eine große. Von Großeltern großgezogen zu werden, hat Vor- und Nachteile. Die Nachteile: Wir durften machen, was wir wollten. Diese Form der frühkindlichen Konditionierung erklärt heute fast alles. Die Vorteile: Dinge, die vor sechzig, siebzig Jahren sinnvoll und gut waren, sind es heute immer noch.
Zum Beispiel: Wassersparen. Natürlich kann man sich ein Bad auch zu dritt teilen. Erst der fünf Jahre ältere Onkel. Danach meine 23 Minuten ältere Schwester. Und zum Schluss durfte ich ins Brackwasser. Wahrscheinlich rührt daher auch meine heutige Aquaphobie.
Wasserscheu zu sein hat allerdings auch Vorteile. Man verbraucht weniger Wasser. Das ist gut für die Umwelt und gleichzeitig tut man seiner Haut einen Gefallen. Dasselbe gilt für Haarewaschen. Kann man jeden Tag machen, muss man aber nicht. Als ich noch im Vollbesitz meiner gut 200.000 blondgrau-weißen Haare war, bekamen die lediglich warmes Wasser zu spüren. So einmal die Woche. Shampoo war absolut überflüssig. Ich will es mal so sagen: So ganz unerfolgreich war meine Methode nicht. Mit sechzig Jahren eine vollumfängliche Haarpracht ist eher unüblich.
Seit Chemo zwei haben sich ja sukzessive fast alle Haare verabschiedet. Blickdicht war einmal. Da ich allerdings an meinem Haarwaschstil festgehalten habe, sieht meine ungewaschene Haarpracht bedauernswert aus. Ein bisschen wie damals bei einem bekannten Sportschaumoderator, der sein verbliebenes Resthaar vom linken Ohr aus einmal über den ganzen Kopf kämmte. Ein Linksohrscheitel sozusagen. Ein ganz klein wenig bemitleidenswert.
Ich war gestern seit längerem mal wieder in der Sauna und beim Anblick der Regendusche ließ ich alle Vorsichtsmaßnahmen außer Acht. Normalerweise vermeide ich stärkere Wasserstrahlen und kämme mich so selten wie möglich, also gar nicht, und mein übrig gebliebenes Haar trockenföhnen fällt komplett aus. Kein Gone with the wind. Ich versuche jedes meiner noch ungefähr 700 Haare zu retten.
Die Rainforest-Dusche war ein Traum. Weiches Wasser plätscherte auf meine Kopfhaut und ich stand minutenlang regungslos da. Nebeneffekt des Duschregengusses: Das Hautfett in meinen Haaren wurde dabei offensichtlich komplett weggespült. Als ich nach der Spa-Anwendung in den Umkleideraum ging, hatte ich plötzlich wieder federleichtes und voluminöses Haar. So geht Jungbrunnen.
Ein bisschen sah mein schütteres Haar aus wie toupiert. Apropos toupiert: Meine Mutter verbrachte in den 70er Jahren Stunden im Bad und so wurden – nach der Stylingmethode – aus 169 cm Körpergröße plötzlich 179 cm. Und das ohne hochhackige Schuhe. Die 400 Milliliter Haarspray waren allerdings nicht nur in ihrem Haar, sondern auch in unseren Lungen.
Ich lasse das in meinen Pass nun auch gleich anpassen. Ich bin seit gestern nicht mehr 186 cm, sondern 192 cm.
Toupé.
So geht Selbstbewusstsein.
Whenever I see my smiling face – 17. Januar 2026
Auf dem Weg zum Urologen waren Pochonder und ich einer Meinung. Die Symptome, die sich heute im Laufe des Vormittags eingestellt hatten, waren klar. Stechende Schmerzen im Bereich des rechten Familienjuwels sowie spontaner Verlust der Sehstärke. Alles war plötzlich unscharf – und das trotz gereinigter Brillengläser. Fast gleichzeitig sagten wir: Diagnose: Hoden- und Augenkrebs. Der Tumor hat gestreut. Betroffenheit. Schweigen.
Pünktlich um 14 Uhr kamen wir in der urologischen Praxis an und durften sofort ins Besprechungszimmer. Blutwertebesprechung nach der fünften Chemo stand auf dem Programm. Bevor er mir die Analyse erklärte, wollte er noch kurz die Nieren schallen. Ich erzählte ihm von unserem Verdacht.
Ich glaube, man kann Menschen ansehen, wenn sie ein Lachen unterdrücken müssen. Sieht amüsant aus.
Sowohl die Entgiftungsorgane als auch der Genitalbereich waren ohne Befund. Also alles so, wie es sein sollte. Und auch die anschließende Bauchdeckenpalpation verlief ohne Auffälligkeiten. Zurück im Besprechungszimmer fiel mir auf, dass ich während der Zweiradfahrt meine Sonnenbrille ohne Refraktion getragen hatte. Also die Brille ohne Sehschwächenkompensation. Jetzt konnte er das Lachen nicht mehr unterdrücken.
Na gut. Spontanheilung. Soll es ja geben.
Zu den Blutwerten:
Das PSA hat sich deutlich und tief verbeugt und ist von 0,36 auf 0,11 gefallen. Das nenne ich erfolgreiches Teamwork. Das Testosteron bleibt derweil auch konsequent im Keller – 7 ng/dl. So mag ich das. Die Leukozyten sind nach ihrem Kurzurlaub wieder da, die roten Blutkörperchen arbeiten sehr gemächlich, aber zuverlässig. Leber und Nieren halten sich elegant raus und machen einfach ihren Job nach dem Motto: War was?
Die Therapie, die ich vor genau vier Monaten begonnen habe, funktioniert optimal. Mein Körper zieht mit und ich erlaube mir heute ganz offiziell eine Portion Optimismus – mit einem kleinen Lächeln obendrauf. My smiling face.
Auch der Urologe war recht optimistisch gestimmt. Er erklärte mir, dass ich wahrscheinlich nach der sechsten Chemo ein paar Monate Ruhe haben werde und dann eventuell im Herbst ein bis drei Chemosessionen nachgelegt werden könnten. Aber das würden wir dann besprechen. Auch die Trenantone-Injektion würde er nochmal verschieben. Bei diesem Testosteronlevel sei sie nicht notwendig.
Da sich der hoffnungsvolle Optimist in mir breitmachte, fragte ich ihn, ob wir in zwanzig Jahren zusammen Golf spielen wollen. Er lächelte und antwortete: „Versprechen kann ich Ihnen das nicht, allerdings sieht es gut aus.“
Die einzigen Grenzen, die man hat, sind die Grenzen, an die man glaubt.
Mehr Benjamin Button wagen – 19. Januar 2026
Der Film „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ aus dem Jahr 2008 beansprucht maximal fünfzehn Prozent unseres Denkvermögens. Viel verstanden werden muss da nichts. Kurzweiliges Popcornkino. Das Making-of des Films hingegen ist sehr beeindruckend.
Was viele wahrscheinlich nicht wissen: Brad Pitt wurde in diesem Film nicht einfach nur älter geschminkt. Sein Älterwerden wurde vorausberechnet. Sie haben nicht nur sein Gesicht digital nachgebaut, sondern auch seinen Schädel. Millimetergenau. Knochenstruktur, Proportionen, Volumen. Zwei Jahre Arbeit. Das Ziel war nicht, einen alten Brad Pitt zu zeigen. Sondern den Brad Pitt zu zeigen, der sehr wahrscheinlich mit achtzig so aussehen wird, wie er im Film gezeigt wird. Nicht einfach nur graue Haare. Kein Falten-Make-up. Nicht das übliche Kino-Altern, bei dem ein junges Gesicht einfach müde geschminkt wird.
Sie wollten das sogenannte Uncanny Valley vermeiden. Das beschreibt diesen merkwürdigen Moment, in dem etwas fast menschlich ist – und uns genau deshalb unangenehm wird. Zu humanoid, um klar künstlich zu sein. Aber auch nicht menschlich genug, um uns zu beruhigen. Ein Gesicht, das schaut, aber nicht wirklich blickt. Eine Mimik, die irgendwie stimmt, aber sich nicht echt anfühlt. Unser Gehirn stolpert dann kurz.
Wir wollen entweder Illusion oder Wirklichkeit. Das Dazwischen berührt uns nicht.
Die Präzision, die für Brads Altern angewendet wurde, ist verstörend und faszinierend zugleich. Weil man nicht irgendeinen Effekt sieht, sondern seine mögliche Zukunft. Brad Pitt als alter Mann.
Vielleicht blieb der Film bei mir deshalb so hängen, weil ich mir die Frage stellte, die ich – wie vermutlich die meisten – gerne verdränge: Wie werde ich aussehen, wenn ich alt bin? Wenn mein jetziger Körper nur noch Erinnerung ist.
Mal Hand aufs Herz. Wer von uns kann sich denn vorstellen, dass Brad Pitt alt wird? Brav, die Hände bleiben unten. Natürlich begleiten wir ihn schon seit Jahrzehnten, aber in seinen Filmen, in der Boulevardpresse wird das ewig jugendliche Bild von ihm vermittelt. Und das mit seinen 62 Jahren. Brad Pitt scheint alterlos.
In knapp zwanzig Jahren werden wir wissen, ob die computergenerierten Bilder aus „Benjamin Button“ recht behalten. Brad mit 80. Unvorstellbar.
Ich merke gerade, dass ich ein wenig zum Ausschweifen neige. Ich wollte eigentlich etwas über mich schreiben. Da ich mittlerweile Schwierigkeiten habe, Chemonebenwirkungen von altersbedingten Gebrechen und Dysfunktionen zu unterscheiden, tippe ich auf eine Mischung aus beidem: Chemo-Delir.
Nach der heutigen Radlrunde entledigte ich mich wie gewohnt der Sportkleidung und bemerkte an beiden Unterschenkeln einen leichten Wulst – genau an der Stelle, wo der Sockenrand war. Hoppala. Jetzt habe ich auch noch (bzw. schon) Wassereinlagerungen in meinen Beinen. Wenn ich es mir schönreden wollte, würde ich schreiben: „Hey, die Socken waren auch wirklich eng und einschneidend“. Heute will ich es mir allerdings mal nicht schönreden. Ich hatte meinen persönlichen Benjamin-Button-Moment. Die Realisation, dass nicht nur Brad Pitt altern wird, sondern ich erstaunlicherweise auch. Und ich werde mit Sicherheit nicht einfach nur auf alt geschminkt alt werden.
Oh Mann. Jetzt muss sich mein Magen nicht nur mit der chemobedingten Mukositis rumschlagen. Jetzt bekommt er noch zusätzlich den imaginären Robert-wird-alt-Vomitus.
Ich werde mal im Internet Kompressionsstrümpfe und einen Rollator bestellen. Schönheitsbehandlungen, wie Botox, Filler (Texas Face) und Stammzelltherapie à la Mr. Pitt kann ich mir ohnehin nicht leisten.
Ich glaube, es war Tolstoi, der sinngemäß schrieb, dass die größte Überraschung im Leben eines Mannes das Alter ist. Es schleicht sich an. Unauffällig. Und plötzlich steht es da. Man fragt sich dann, warum ein alter Mann nicht einfach so handeln kann, wie man es von seinem Alter erwarten würde. Wie es möglich ist, dass man noch immer in die sinnlichen Aspekte der menschlichen Komödie verstrickt ist. Denn im Kopf hat sich nichts verändert.
„Alt werden ist wie mehr und mehr für ein Verbrechen bestraft werden, das man nicht begangen hat.“ – Anthony Powell
Wenn dunkle Wolken mich bedrohen – 20. Januar 2026
Akt eins: Dunkle Wolken. Dauerregen. 11 Grad. Null Stunden Sonne. Leider hatte die Wettervorhersage dieses eine Mal im Jahr recht. Und das schon seit drei Tagen. Mein Vitamin D stand mit dem Koffer und dem Reisepass in der Hand an der Haustür und ging, ohne sich zu verabschieden. Meine Fahrräder ließen sich derweil gegenseitig die Luft aus den Reifen. Das allein reicht normalerweise schon, um aus dem Parterre in den Freitod zu springen.
Akt zwei: Dunkle Wolken. Allerdings nicht von oben, sondern jetzt die von innen. Ich las online einen Artikel. Fachlich, sachlich, aufschlussreich geschrieben und mit guter Absicht. Darin stand, dass der Lymphdrüsenkrebs einer Patientin nach nur einem Jahr wiederkam und dass das Wiederauftreten alles verändern kann. Es gibt jetzt allerdings genau dafür neue Behandlungsansätze. Moderne Medizin mit beeindruckenden Fortschritten – Stichwort: CAR-T-Zelltherapie. Klingt gut und vielversprechend. Nach Hoffnung jedenfalls.
Ich schloss den Browser. Und dann passierte das, was nicht im Onlineartikel stand. Meine Gedanken begannen Überstunden einzulegen und wüteten förmlich in meinem Oberstübchen. Oder besser: Es zog ein Gedankensturm auf. Gedankenwolken, die sich zusammenschieben und bedrohlich werden. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich? Was, falls? Was dann?
Mein Tag war zum zweiten Mal versaut. Und während draußen der Regen aufgehört hatte, noch stärker zu regnen, orchestrierte Pochonder das Gedankenorchester nach Herzenslaune. Ich legte mich ins Bett, zog meine Schlafbrille an und steckte mir meine maßgeschneiderten Oropax in die Gehörgänge. Ich hatte quasi das „Bitte nicht stören“-Schild um den Hals hängen.
Später am Nachmittag stieß ich auf einen Bericht der Harvard Medical School, der sich mit der Frage beschäftigt: Kann unser Gehirn mit unserem Immunsystem sprechen? Die Antwort lautet erstaunlicherweise: ja. Und zwar richtig gut.
Gedanken, Stress, innere Alarmzustände können das Immunsystem aktivieren oder aus dem Takt bringen – messbar. Umgekehrt kann mentale Beruhigung Prozesse dämpfen, die sonst unnötig auf Hochtouren laufen. Als Kommunikation zwischen Kopf und Körper. Psychosomatik im besten Sinne.
Mit anderen Worten: Gedanken können krank machen. Aber sie können offenbar auch beim Gesundbleiben helfen – und das nachhaltiger als jedes Nahrungsergänzungsmittel. Weg mit dem Zeug.
In einer Studie wurden Menschen mit Virtual-Reality-Brillen ausgestattet. Sie beobachteten andere Menschen – mal gesund, mal „krank“. Und wenn das Gehirn im virtuellen Raum eine kranke Person erkannte, begann es Signalstoffe auszuschütten, die das Immunsystem auf Zack bringen. Noch bevor ein einziges Virus im Körper war. Unser Kopf reagiert also, bevor der Körper überhaupt weiß, was passiert. Nicht nur denken wir etwas, wir lassen unseren Körper schon handeln. Also nicht wir, sondern unser Nerven- und Hormonsystem.
Das Gehirn und das Immunsystem sprechen miteinander, und sie tun es ständig. Nicht nur nach einer Infektion, sondern im täglichen Austausch – über Hormone, Botenstoffe, Wahrnehmung, Stress, Emotionen. Wenn das stimmt, dann beginnt Gesundheit nicht erst beim Arzt. Sie beginnt in unserem Kopf – in meinem Kopf.
„Gesundheit ist kein Zustand des Körpers, sondern des Geistes.“ Frei nach Aristoteles.
Abgesehen davon: Gedanken sind wie Wettervorhersagen. Und die stimmen nur selten.
Psychosomatik für absolute Anfänger – 21. Januar 2026
Nachdem ich gestern Abend den Bericht über psychosomatische Selbstheilung gelesen hatte, war ich voller Energie und hatte das Gefühl, endlich die Anleitung zu haben, um mich selbst zu heilen. Ohne Arzt. Ohne Nebenwirkungen. Ohne Wartezimmer. Beobachten und sich gesund denken. Nur die Reihenfolge meiner Beschwerden und Krankheiten musste natürlich noch priorisiert werden. Ich will mich ja nicht übernehmen.
An erster Stelle steht natürlich mein Prostatakrebs. May the force be with me. Die Jedis wussten das damals schon. Danach würde ich meine beiden Knie heilen und damit beide Kreuzbandrisse loswerden. Anschließend kommt meine rechte Schulter unters Gedankenmesser. Ich habe mir 1994 mindestens zwei von drei Bändern gerissen und wurde nie operiert. Pochonder besteht darauf, dass es alle drei waren. Klingt auch härter: Schultereckgelenksprengung. Man kann sich leicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Zu guter Letzt, und ich will nicht zu anspruchsvoll sein, würde ich alle meine Lebensmittelallergien loswerden und eine Woche lang in der Naturbar nur frisches Birchermüsli essen.
Es lief bereits „Freedom“ von George Michael auf Spotify in Dauerschleife, ich stellte mir mein neues, stressfreies und vor allem gesundes Leben vor und tanzte knieschonend zum Beat.
Ich schlief sofort wie ein sattgegessenes Baby ein. Gegen 2 Uhr morgens war der Traumschlaf allerdings schon wieder vorbei. Psychosomatik macht offenbar keine Nachtschichten. Beide Nasenlöcher waren dicht. Zuzementiert trifft das Gefühl besser. Dafür war mein Mund komplett ausgetrocknet und ich hatte fiese Hals- und Schluckbeschwerden.
Man sollte beim Sich-Psychosomatisieren immer einen etwas weiteren Blick haben. An Weiterschlafen war nicht zu denken. Ich probierte alle Klassiker aus. Salzwassergurgeln. Eukalyptus-Heißwasser-Inhalation. Vicks VapoRub ca. einen Zentimeter dick aufgetragen und danach ein Nasenpflaster auf den Nasenrücken geklebt. Effekt: 0,1 % Besserung.
Jetzt konnte nur noch die Psychosomatik helfen. Ich setzte mich entspannt im Schneidersitz auf den flauschigen Teppich und stellte mir lauter grippekranke Personen vor. Hustend. Mit triefender Nase, alle mit kränklichem Gesichtsausdruck. Und schon merkte ich eine Verbesserung. Effekt nun: 0,3 %. Geht doch. Man muss nur realistische Ziele haben. Fairerweise standen grippale Symptome nicht auf meinem Lourdes-Spickzettel.
Erstaunlich allerdings sind die grippalen Symptome. Ich habe mich in den letzten vier Monaten nicht einmal auch nur ansatzweise so beschissen gefühlt wie jetzt. Und das will etwas heißen. Meine armen Leukos. Die restlichen 1,7 Tsd./µl vom vergangenen Mittwoch haben sich jetzt wahrscheinlich in Luft aufgelöst.
Und da ich geistig nicht fit bin, benutze ich ein Zitat, das null passt:
„Wenn Sie glauben, Sie seien zu klein, um etwas zu bewirken, versuchen Sie einmal, mit einem Mosquito im Zimmer zu schlafen.“
– Dalai Lama XIV
Ich dachte, er hätte damals gesagt: Wenn Sie glauben, Sie seien groß genug, um eine Krebstherapie zu überstehen, versuchen Sie einmal, mit Grippesymptomen einzuschlafen.
Sinngemäß jedenfalls.
Streptokokken – Chemotherapie allein wäre ja auch etwas langweilig
Schlaflosigkeit
Tonsillitis
Rachenschmerz
Erschöpfung
Pharyngitis
Temperatur
Ohrensausen
Kopfschmerz
Odynophagie
Kraftlosigkeit
Kehlkopfweh
Entzündung
Nasenlaufen
Um einmal ein paar der Symptome aufzulisten, die sich bei meiner diagnostizierten Rhinosinusitis abwechselnd die Türklinke in die Hand geben. Ab und zu drängen allerdings alle gleichzeitig durch die Tür.
Mal eben jemandem die Schau stehlen – 24. Januar 2026
Arne Tvervaag sprang 1968 aus dem Stand 3,71 m und damit direkt ins Guinness Buch der Weltrekorde. Klingt nicht wirklich beeindruckend. Etwas bildhafter wird die Angelegenheit, wenn man zwei deutsche Durchschnittsmänner hintereinander auf den Boden legt – Fußsohlen an Fußsohlen – und dann stellt man sich vor, aus dem Stand über die beiden Herren hinwegzuspringen. So fühlten sich meine Chemotherapie-Nebenwirkungen vorletzte Woche an: aus dem Stand 3,71 m. Applaus.
Die Rhinosinusitis klingt schon als reines Wort sehr viel sportlicher und ihre Nebenwirkungen sprangen – allerdings mit zwei Tagen Anlauf – Mike-Powell-mäßig direkt auf 8,95 m und ließen die 3,71 m alt aussehen. So sehen Sieger aus.
Obwohl meine Aufmerksamkeit seit 18 Wochen die Chemotherapie ist, brauchte Rhinosinu gerade mal 48 Stunden, um mein komplettes Augenmerk auf sich zu ziehen. Und nicht nur das, die Streptos haben auch die Pläne für die letzte geplante Chemosession auf Anfang Februar verschoben. John Lennon wusste das natürlich schon: „Life is what happens to you while you’re busy making other plans.“
Unverhofft kommt oft. Klingt fast wie ein weiterer Titel für einen Blog.
Also gut, die letzte Docetaxel-Infusion erhalte ich dann eben erst im zu kurz gekommenen Monat.
Nach rund 48 Stunden Amoxicillin hat meine Nase wieder ihre essenzielle Grundfunktion übernommen: Einatmen. Ausatmen. Auch die schmerzhafte Entzündung des Rachens ist etwas abgeklungen. Dafür fühlt es sich an, als hätte sich inzwischen ein kleiner Babyelefant auf meinem Brustkorb niedergelassen. Pochonder steht apathisch neben mir und flüstert die ganze Zeit nur: „Oh, Gott, oh Gott, oh Gott.“ Das hilft nicht wirklich.
Ich wünsche mir mal, dass das Antibiotikum ganze Arbeit leistet und das ganze Theater im Brustkorb gleich mit abtötet. Ich war mal Pazifist. Ist wohl aus der Mode gekommen.
Wenigstens hat mein ziemlich mitgenommener Körper jetzt eine Woche mehr Zeit, um sich von allem ein wenig zu erholen.
Always look at the bright side of life.
Weiter unten in den Lyrics von Monty Python heißt es dann:
Life’s a piece of shit
When you look at it
Life’s a laugh and death’s a joke, it’s true
In diesem Sinne. Es bleibt ja immerhin lustig.
Schluckmuskelprellung – 25. Januar 2026
Seit der Google-Online-Taschenrechner in meinen Alltag eingezogen ist, fristet mein Casio fx-991ES Taschenrechner ein Schattendasein. Und da mich auf der Zielgeraden meines Lebens – Pochonder mag es gerne etwas dramatisch – eine leichte Nostalgiewelle erfasst hat, war Entstauben angesagt. Anschließend gönnte ich meinem solarbetriebenen Abakus ein 10-minütiges Sonnenbad und schaltete ihn danach ein. Tadellos. 2,1 cm Länge mal 1 cm Breite mal 0,8 cm Höhe. Ergebnis: 1,68 Kubikzentimeter. Bei der Zahl fällt allerdings noch kein Groschen im Oberstübchen. Hier zum plastischen Vergleich: Ein handelsüblicher Würfelzucker hat ein Volumen von lediglich etwa 1 Kubikzentimeter.
Seit ich dreimal täglich die Amoxicillin-Tabletten schlucken muss, habe ich zwar keine Halsentzündung mehr, allerdings fühlt es sich so an, als hätte ich nun ein Prellungsgefühl und Blutergüsse im Mundrachen. Die 1,68 Kubikzentimeter Volumen einer Amoxicillin-Tablette fühlen sich so an, als müsste ich einen Legostein mit etwas Flüssigkeit runterschlucken. Mittlerweile habe ich zwölf von diesen Kaventsmännern eingenommen und zweimal hatte ich das Gefühl, dass die Tabletten am Schließmuskel der Speiseröhre hängengeblieben sind. Wie gesagt: Legosteinsymptomatik. Hochgradig unangenehm.
Seitdem habe ich eine ausgewachsene Tabletteneinnahmephobie und Pochonder hat einen gleichgesinnten Gesprächspartner. Ich bekomme kaum noch im ersten Versuch eine Tablette runter. Ich bin echt froh, wenn ich die letzte Tablette intus habe.
Allerdings – und dafür bin ich sehr dankbar – hat das Antibiotikum erstklassige Arbeit geleistet. Ein Hoch auf den Zufall. Und auf die Beobachtungsgabe von Alexander Fleming.
Nächste Woche werde ich meinen Magen-und-Darm-Trakt in Kefir einlegen und bis zur letzten Chemo darin liegenlassen.
Die Schluckmuskelprellung werde ich nach der Antibiotikumtherapie mit Vanilleeis und Sahne verwöhnen.
Alles Schlechte hat offenbar auch was Gutes.
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind – 26. Januar 2026
Im Zweifelsfall: Goethe. Das war während meiner Schulzeit unser Rettungsanker. Wenn Frau Dr. J. im Deutschunterricht irgendeine literarische Frage hatte – Goethe passte (fast) immer. Beeindrucken, ohne zu wissen, und trotzdem nicht sitzenbleiben. Wer keine Fehler macht, kommt durch.
„Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind“, lässt Goethe seinen Faust sagen. Unmittelbar nach dem berühmten Satz „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ Das ist einer dieser Momente, in denen ich kurz innehalte. Ich lese oder höre von Wundern. Ich kenne einige der Geschichten, und trotzdem bleibt dieses kleine, hartnäckige „Aber“. Die Restpräsenz der schulischen Naturwissenschaften. Falls davon überhaupt etwas hängengeblieben ist. Wer kennt noch die Ordnungszahl von zumindest einem chemischen Element?
Während der heutigen Post-Sinusitis-Radl-Spazier-Runde lauschte ich aufmerksam einem Beitrag im Onlineradio. Es ging um Wunder. Nicht die mit Blitz, Rauch und Heiligenschein, sondern die leiseren Varianten. Um Ereignisse, die plötzlich passieren, obwohl sie niemand ernsthaft auf dem Zettel hatte. Dinge, die vorher unmöglich waren und hinterher wie selbstverständlich wirken. Interessant war der Gedanke, dass Wunder oft erst im Rückblick welche sind.
Vor gut zwanzig Jahren verrichtete ich meine morgendlichen Papa-Pflichten. Nach dem Baggage-Drop-off im Kindergarten fuhr ich zum Lecker-Bäcker ums Eck und gönnte mir ein Buttercroissant und einen Milchkaffee. Damals gab es nur Kuhmilch und Croissants hießen Milchhörnchen.
Es war ein lauer Frühlingsmorgen und das piepmatzige Federvieh zwitscherte den Sonnenstrahlen entgegen. Ich nahm wieder hinter dem Lenkrad Platz und fuhr Richtung Tonstudio. Man kann links den Coffee-to-go-Becher und rechts das Croissant in den Händen halten und trotzdem mit den Knien lenken. Als ich dann gut gelaunt begann, einen Song im Radio mitzusingen, geschah es: Ich verschluckte mich und konnte nicht mehr atmen. Man sollte nicht zur selben Zeit essen und singen. Medizinisch nennt man das dann: Aspiration. Ich weiß noch ganz genau, was ich in den ersten Sekunden dachte. Keine Panik, Robert. Du kannst die Luft ja locker zwei Minuten anhalten. Du hast Zeit. Entspann dich. Ich dachte, ein großer Schluck aus dem Kaffeebecher wird den Blockadeur schon vom oberen Speiseröhrenverschluss spülen. Stattdessen prustete ich den Kaffee komplett zurück ins Fahrzeuginnere und über das gesamte Armaturenbrett. Der Aspirationsauslöser hatte sich allerdings keinen Millimeter bewegt.
Komplette Panik. Todesangst. Nein, damals gab es noch keinen Pochonder. Der kam erst später. Ich trat voll auf die Bremse. Stieg aus und rannte wild gestikulierend in Richtung Auto hinter mir. Ganz in Schwarz gekleidet, mit panikartigen Gesichtszügen, machte ich wohl keinen vertrauenserweckenden Eindruck auf die nachfolgenden Autofahrer. Sie fuhren alle kopfschüttelnd an mir vorbei. Ich war allein. Keine Menschenseele in meiner Nähe.
Ich sank auf die Knie und dachte „Wie absurd, du wirst wegen eines verschluckten Croissants sterben.“ Ich weiß selbst heute nicht, wie ich diesen Moment der Kapitulation beschreiben soll.
Plötzlich spürte ich eine Umarmung von hinten und wie mir jemand mit viel Druck den Brustkorb ruckartig eindrückte. Das Heimlich-Manöver. Ich spuckte das Croissantstück aus und holte gefühlt unendlich lang tief Luft. Als ich mich nach einer Weile umdrehte, um zu sehen, wer mir da geholfen hatte, konnte ich niemanden sehen. Da war keiner. Kein Scherz. Ich war weit und breit der Einzige auf der Straße.
Ich begann zu schluchzen – genauso wie jetzt beim Schreiben dieser Zeilen.
In einer Woche habe ich meine letzte geplante Chemotherapie. In sechs Wochen dann das Abschluss-PET-CT und die Schlussbesprechung mit der Chefurologin.
„Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder.“
– Albert Einstein
Mein Lebensrettungs-Engel von damals wäre dann wohl für „oder so.“
Auf der Zielgeraden – 29. Januar 2026
Nach gut 20 Kilogramm frisch ausgepressten Orangen, 2,5 Kilogramm entsafteten Ingwerwurzeln sowie frischem Zitronensaft – nein, sauer macht nicht lustig – hatte selbst die Sinusitis die Nase gestrichen voll und war aus den Nebenhöhlen ausgezogen. Eventuell lag es auch an den Sinupret-extract-Tabletten. Allerdings sagte ein guter Freund zu mir, wenn man die pflanzlichen Extrakte in Tablettenform einnehmen wolle, müsse man an deren Wirksamkeit glauben. Tat ich nicht. Die Rhinosinusitis ist trotzdem Geschichte. Aufatmen. Im Sinne des Wortes.
Auch die Schluckbeschwerden gehören der Vergangenheit an. Das Sahne-Vanilleeis hat ganze Arbeit geleistet. Zusatznutzen: Der kalorisch erworbene Rettungsring um meine Hüften sieht zwar nicht schön aus, allerdings schützt er meine Beckenkämme vor Türrahmen bei nächtlichen Toilettengängen im Dunkeln.
Jetzt bleiben mir noch vier Tage bis zur letzten geplanten Chemotherapie-Sitzung. Ich werde bei meiner körpereigenen KfW alle möglichen Kredite beantragen und meine Gesundheit so gut es irgendwie geht auf Vordermann – pardon – auf Vorderfrau bringen. Ja, die Gesundheit, weiblich. Ergo: Vorderfrau. Immer schön gendergerecht.
Als Erstes stand heute eine Massage auf dem Programm. Warum mich der Masseur vor der Behandlung fragte, worauf ich Wert lege, weiß ich nicht. Er hat nichts von dem, was ich gesagt hatte, bevorzugt behandelt. Dafür habe ich die Massage jedoch auch kaum gespürt. So ein paar Tropfen warmes Öl auf meiner Haut konnte ich noch wahrnehmen. Das war’s dann. Der Rest fühlte sich eher wie eine Reiki-Behandlung an. Wobei Jesus durch Handauflegen ja auch Menschen geheilt haben soll. Aber entspannend war das Ganze schon. Allerdings: Beim Chillen auf dem heimischen Sofa hätte ich mir die 85 Euro für die Pseudomassage gespart.
Gleich werde ich mir noch einen Wellnessnachmittag im Saunasanatorium gönnen und anschließend meinen Magen- und Darmtrakt verwöhnen. Auf dem Programm steht eine Quinoa-Brokkoli-Bowl, veredelt mit handmassiertem Grünkohl, bestreut mit gerösteten Chiasamen, Hanfprotein und einem Hauch Kurkuma, dazu ein Dressing aus Zitronensaft, Olivenöl und dem festen Glauben, dass es meinem Körper guttut. Dazu noch ein Glas lauwarmes Ingwerwasser. Genuss bedeutet heute vor allem sich nichts vorzuwerfen.
Meine Oma hätte mir früher eine selbstgemachte Hühnerbrühe mit Liebe zubereitet. Danach wäre ich gesund gewesen.
Ich vermisse sie.
Fast jeder. Und dann? – 31. Januar 2026
Headline heute in der FAZ: Fast jeder zweite Deutsche erkrankt im Leben an Krebs. Da hätte ich ja eigentlich Glück haben sollen. Der deutsche Pass fehlt ja in meiner Sammlung. Aber vielleicht haben sich ja die deutschen Gene mütterlicherseits etwas in den Vordergrund geschoben. Werde ich nie herausfinden.
Winston Churchill hat es sehr treffend formuliert: „Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe.“ Fast jeder Zweite – so steht es in den Statistiken. Eine dieser Zahlen: gelesen, zur Kenntnis genommen, weitergescrollt. Fast fünfzig Prozent. Das ist viel. Und trotzdem abstrakt. Eine Zahl ohne Gesicht. Ohne Vorstellungskraft.
Während meiner Zeit bei einer medizinischen Filmproduktionsfirma sagte ein Professor und wissenschaftlicher Berater einen Satz, der mir damals hängen geblieben ist. Sinngemäß meinte er – soweit ich mich erinnern kann –, dass im Grunde fast jeder Mensch irgendwann an Krebs sterben würde – wenn wir nur genau genug hinschauen würden. Das Problem sei weniger der Krebs als unsere Statistik. Wir obduzieren nicht jeden. Die Ärzte müssen allerdings am Ende entscheiden, welche Todesursache sie eintragen. Und was dann auf dem Totenschein steht, ist nicht immer die wirkliche Ursache.
Krebs ist sichtbarer geworden. Und Statistik ist ein Hinweis auf etwas sehr Menschliches: Ordnung schaffen, wo eigentlich Unordnung herrscht. Sie ist der Versuch, Komplexität erträglich zu machen. Sie sortiert, glättet, fasst zusammen. Sie sagt, wie viele. Was sie nicht sagt: wie sich das anfühlt. So wie in meinem Fall.
Kurz vor der sechsten und letzten geplanten Chemotherapie passiert etwas Merkwürdiges: Ich fühle mich so, als hätte ich gar keinen Krebs. Die Metastasen zerfallen, die Prostata ist wieder auf Originalgröße, der PSA-Wert fristet ein Schattendasein, der Doppel-J-Drahti ist auch Geschichte. Objektiv betrachtet läuft alles so gut, dass es fast irritierend ist.
Mein Alltag ist erstaunlich normal. Ich lebe, arbeite, treibe Sport. Wenn ich etwas spüre, dann vor allem die Nebenwirkungen der Medikamente. Testosteron und tschüss. Haare und tschüss. Aber der Krebs selbst? Den spüre ich nicht. Und nach knapp fünf Monaten taucht plötzlich diese steile, fast ungehörige Frage auf: Habe ich überhaupt Krebs? Oder habe ich ihn nur noch auf dem Papier? In Arztbriefen, Befunden, Bildern. Mein Körper fühlt sich längst wieder wie mein Körper vor der Diagnose an.
Vielleicht ist das das Paradox moderner Medizin: Sie wirkt so gut, dass die Krankheit unsichtbar wird, bevor sie verschwindet. Na gut, das passiert nicht immer. Ich lebe weiter, ziemlich normal – und trage trotzdem ein Wort mit mir herum, das alles verändert. Krebs. Als Diagnose, nicht als Gefühl. Als etwas Ungreifbares. Ein seltsamer Schwebezustand. Medizinisch krank, subjektiv gesund. Und vielleicht genau der Ort, an dem man merkt, wie wenig Zahlen und Begriffe darüber sagen, wie es sich wirklich anfühlt.
Die eigentliche Verschiebung liegt womöglich woanders. Weg vom Entweder-oder, hin zum Dazwischen. Nicht gesund, nicht tot. Sondern lebend. Mit Tagen, an denen alles erstaunlich normal ist. Und anderen, an denen ein Befund, eine Zahl auf einem Zettel das gesamte Denken übernimmt.
Statistik kann Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Sie kann Kurven zeichnen und Trends benennen. Aber niemand lebt statistisch. Niemand stirbt statistisch. Am Ende bleibt immer ein einzelner Körper, ein einzelner Mensch, ein einzelner Tag. Genauer gesagt: ich. Und mein Tag.
Vielleicht erklärt das auch, warum der Satz „fast jeder Zweite“ so wenig aussagt. Er ist richtig. Aber er hilft nicht. Was hilft, ist die Erkenntnis, dass zwischen Diagnose und Tod oft sehr viel Leben liegt. Ungeordnetes, widersprüchliches, manchmal überraschend helles Leben.
Ich hoffe mal, dass mir meine steile Frage nicht irgendwann auf meine Füße fällt.
Hinten kackt die Ente.
Nummer 6 – 02. Februar 2026
Die Zahl sechs gilt in vielen Kulturen als vollendet. In der jüdisch-christlichen Tradition vollendete Gott die Welt in sechs Tagen. Auch mathematisch ist die Sechs besonders: Sie ist die erste vollkommene Zahl, denn die Summe ihrer Teiler (1, 2 und 3) ergibt wieder sechs. Allerdings hat die Sechs auch eine dunkle Seite. Dreimal die Sechs – 666 – steht symbolisch für das personifizierte Böse. Fun Fact aus dem Roberto-Was-ist-Was: Addiert man beim Roulette alle Zahlen von 1 bis 36, kommt man ebenfalls auf 666. Daher wird das Spiel gern als Devil’s Game bezeichnet.
Ich bin schon wieder komplett abgeschweift und habe den Faden verloren. Passiert mir neuerdings öfter. Worüber wollte ich eigentlich nochmal schreiben?
Ach so, ja. Nummer 6. Heute ist also Chemotherapie Nummer 6 an der Reihe. Keine Magie. Kein Feuerwerk. Nichts Antichristliches. Ein hoffentlich auch vollendeter Abschluss. Die letzte geplante. Das klingt größer, als es sich anfühlt. Wenn ich es nüchtern betrachte, habe ich den größten Teil längst hinter mir. Fünf von sechs. Rechnerisch waren das bereits 83,3 Prozent. Die Versuchung ist groß, die letzte Runde als statistisches Anhängsel zu betrachten. Ein bisschen Kür. Oder, um es geringschätzend zu sagen: Es sind ja nur noch 16,6 Prozent.
So funktioniert die Chemotherapie laut meiner Onkologin allerdings nicht. Sie ist kein Kuchen, der in gleich große Stücke geschnitten wird. Sie ist eher eine Abfolge von Wellen. Die ersten treffen hart und sichtbar. Die Tumormasse schrumpft, Metastasen zerfallen, Werte verbessern sich. Später wird es unspektakulärer. Die Effekte sind leiser, manchmal kaum noch spürbar. Aber sie erklärte mir, dass es medizinisch interessant bliebe. Interessant ist das vor allem für Menschen, die es beruflich interessant finden müssen. Das beruhigt mich trotzdem. Ein bisschen.
Die letzten Zyklen sind nicht dafür da, noch einmal alles umzuhauen. Sie sind dafür da, übrig Gebliebenes zu erwischen. Krebszellen arbeiten nicht synchron. Manche sind schnell, manche langsam, manche machen Pause. Die späteren Chemos erhöhen die Wahrscheinlichkeit, auch jene zu treffen, die sich bislang entzogen haben. Es geht dann nicht mehr um Masse, sondern um Absicherung.
Kurz vor der sechsten Chemo geht es mir wie bereits gestern beschrieben erstaunlich gut. Mein Alltag ist wieder völlig normal. Vielleicht ist das der Moment, in dem moderne Medizin am schwierigsten zu verstehen ist: Wenn sie so gut funktioniert, dass man sie kaum noch spürt. Ich bin inzwischen an dem Punkt, an dem ich mich frage, warum ich die Darolutamid-Tabletten eigentlich noch schlucke – und ob diese sechste Session wirklich noch etwas tut. Meine Krebsfachärztin erläuterte mir, dass sie aus einem bis dato guten Verlauf einen noch besseren machen kann. Bitte.
Angefangen habe ich am 6. Oktober 2025. Insgesamt siebzehn Wochen für sechs Chemotherapien. Schon alles ein bisschen verrückt – und vor 120 Tagen für mich unvorstellbar. Bis auf nach Chemo fünf hatte ich erstaunlich wenig Nebenwirkungen. Hatte ich vielleicht Glück? Oder lag es an der kompetenten ärztlichen Beratung? Am medizinischen Fortschritt? Oder lag es an meiner Lebensweise?
Ja.
Was kommt als Nächstes? Nachsorge. Warten. Kontrolltermine. CTs. Gespräche. Die Medizin tritt einen kleinen Schritt zurück. Die sechste Chemo ist ein Punkt. Ende. Aber mein Leben geht weiter. Mal sehen, wohin.
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
– Rainer Maria Rilke
Ein bisschen wie Chariots of Fire – 03. Februar 2026
Ich habe keinen Streitwagen und musste gestern auch nicht gegen einen fliegenden Schotten antreten. Im gleichnamigen Film besiegen am Ende ohnehin die Schotten die US-amerikanische Equipe und holen sich Gold. Vielleicht sollte ich Analogien wählen, die am Ende auch Sinn ergeben und mich in einem besseren Licht zeigen.
Egal. Jetzt bitte laut mitsummen. Danach erläutere ich meinen CoF-Plot.
Für die Ewigkeit. Sozusagen. Auch schon wieder 45 Jahre her.
Ich fühlte mich heute etwas schottisch, als mir meine Onkologin eine schallende „High Five“ gab. Meine zarte rechte Flosse ist immer noch leicht gerötet. Ihr Kommentar zu meinen Blutwerten: „Besser geht es nicht“. Und sie ergänzte freudestrahlend, juchzend, das sei meine sechste Chemo. Meine Altersschwerhörigkeit machte daraus allerdings: Gemurmel. Gemurmel. SEX. Gemurmel. Tja, Herr, du hast mir das Können genommen, nimm mir auch das Wollen.
Ich hatte trotzdem leichtes Champagnerbläschenkribbeln in meiner Magengegend. Wer sagt denn, es gäbe keine guten Nachrichten mehr?
Der PSA-Wert liegt am Boden: 0,09. Und das Testosteron? Nicht vorhanden. Leberwerte, Nieren, Elektrolyte? Alles im Lot. Kurz gesagt: Die Therapie hat geliefert. Mein Körper ebenfalls. Also bitte der Schulmedizin Gold, Silber und Bronze um den Hals hängen und dabei Vangelis auf maximale Lautstärke stellen. Höre ich gerade ohnehin beim Schreiben dieser Zeilen. Tränen lügen nicht. Freudentränen.
Die letzte Chemo verlief ohne irgendwelche Komplikationen. Wie geschnitten Brot. Läuft. Die Bofrost-Schutzkleidung werde ich jetzt – mit gebührendem Dank – ganz tief hinten in den Schrank platzieren.
In vier Wochen das finale PET-CT. Danach alle vier Wochen Blutanalyse und alle drei Monate ein Kontroll-CT.
Mein neues Motto: Lebbe geht weiter.
Recht hast du, Stepi.
Wenn der Uro mit der Onko – 05. Februar 2026
Es gibt Gespräche, die klingen ein bisschen wie ein Tennismatch. Hin und her. Keiner haut daneben. So geht das eine ganze Weile. Beide beherrschen ihren Sport aus dem Effeff. Nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Auf der einen Seite die Urologie. Auf der anderen Seite die Onkologie. Das Finale lautet: Uro gegen Onko.
Diesmal geht es um die Trenantone-Spritze. Um diese unscheinbare Injektion, die alle drei Monate dafür sorgt, dass mein Testosteron zuverlässig im Keller bleibt. So zuverlässig, dass ich mich frage, ob ich dort unten nicht langsam mal eine Taschenlampe einschalten sollte. Vielleicht ist mein Testosteron ja ein Meister im Untertauchen.
Die Onkologin sagt: Diese Spritze muss alle drei Monate verabreicht werden. Punkt. Unabhängig davon, wie tief die Testosteronwerte gerade sind. Kalender schlägt Labor. Sicherheit schlägt Gefühl. Das ist der konservative, protokolltreue Weg. Studien wurden so gemacht. Also macht man es weiter so. Lieber eine Spritze zu früh als ein hormonelles Schlupfloch.
Die Urologie schaut sich dagegen meine Werte an und sagt sinngemäß: Warum jetzt schon? Das Testosteron ist praktisch nicht vorhanden. Der Körper ist maximal blockiert. Jede weitere Gabe bringt vor allem eines: Nebenwirkungen. Und davon hatte ich ja nun wirklich schon genug.
Beide Argumente sind allerdings überzeugend. Und beide haben ihre Berechtigung.
Die Onkologie denkt in Wahrscheinlichkeiten, Kurven und Sicherheitsnetzen. Sie mag keine Überraschungen. Die Urologie denkt stärker in Verläufen, im konkreten Menschen vor ihr. Sie mag keine unnötigen Belastungen. Das ist überhaupt kein Streit. Das ist schlicht deren Perspektive.
Was die Fachwelt dazu sagt, ist – wenig überraschend – nichts wirklich Eindeutiges. Alle sind sich einig über das Ziel: dauerhaft niedriges Testosteron. Uneinig ist man über den Weg dorthin. Fixe Intervalle oder individuelle Steuerung? Kalender oder Laborwert? Kontrolle oder Vertrauen?
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich, wie so oft, irgendwo dazwischen. Solange meine Werte stabil tief sind, eng kontrolliert werden und keine anderen Warnzeichen auftreten, ist Abwarten medizinisch vertretbar. Gleichzeitig ist die punktgenaue Gabe der maximal sichere Weg und bewährt.
Ich sitze also wieder zwischen zwei Fachrichtungen, die beide für mich das Beste wollen, und merke: Medizin ist kein Maschinenraum mit nur einem richtigen Knopf. Sie ist ein Aushandeln. Ein Abwägen. Ein Gespräch auf Augenhöhe.
Der Uro mit der Onko – das ist Teamarbeit. Mit leicht unterschiedlichem Spielstil. Wahrscheinlich gut so.
Und ich sitze derweil auf der Bank, trinke Salbeitee und bin ehrlich gesagt ganz froh, dass sie sich überhaupt Gedanken machen.
Nachdem die Chemotherapie jetzt beendet ist, werde ich wohl der Empfehlung der Onkologin folgen. Und sollte mein Körper sich mit übermäßigen Nebenwirkungen bemerkbar machen, werde ich die Laborwerte in Betracht ziehen und mir dann eventuell eine kleine Spritzenpause gönnen.
Eines will ich auf keinen Fall: partyfeiernde Metastasen – nur weil sie wieder Testosteron geschluckt haben.
Fällt aus. Dann lieber Nebenwirkungen.
Weltkrebstag – 05. Februar 2026
Heute ist Weltkrebstag. Ach. Ich habe seit dem 02. September 2025 jeden Tag Krebstag. Das ist kein Gedenktag, den ich mir rot im Kalender anstreiche. Vielleicht sollte man das allerdings tun. Am Muttertag ist man einmal im Jahr nett zu seiner Mutter und am Weltkrebstag ist man mal nett zu seinem Körper. 0,0027 % vom Jahr. Da geht was.
Ich habe heute einer Unterhaltung im Onlineradio gelauscht. Es ging um Zahlen und Fakten. Weltweit haben sich die Krebserkrankungen seit 1990 fast verdoppelt. Gleichzeitig sinken in Deutschland die Sterblichkeit und bei manchen Krebsarten sogar die Neuerkrankungen. Klingt erstmal widersprüchlich, ist es aber nicht. Wir werden älter. Deutlich älter. Krebs kommt gern später zur Party. Willkommen zum Ü50-Clubbing-Tanzcafé. Discofoxen bis zur Schnappatmung.
Rechnet man allerdings das Alter raus, wird es nüchterner. Dann sieht man: Vorsorge wirkt. Früherkennung wirkt. Therapie wirkt. Nicht immer, nicht bei allen – aber oft genug, um die Kurven ein kleines Stück zu glätten.
Und ja: Ein großer Teil der Krebserkrankungen hängt mit Dingen zusammen, die wir beeinflussen können. Rauchen ganz vorne. Alkohol auch. Ernährung, Bewegung, Gewicht. Alles bekannt. Nichts Neues. Prävention eben. Wichtig. Richtig. Sinnvoll.
Während ich zuhöre, merke ich, wie ich innerlich einen Schritt zurücktrete. Ich habe viel richtig gemacht. Sehr viel sogar. Seit über 40 Jahren vegetarisch. Nie geraucht. Nie Alkohol getrunken. Nie übergewichtig. Sport, Yoga, Bewegung immer Teil meines Alltags. Fast täglich Sauna.
Jetzt sitze ich hier – nach einer gut gelaufenen Chemotherapie, mit einer ADT, die hervorragend greift, mit Werten, die fast schon euphorisch stimmen könnten. Und dann höre ich im Radio aus dem Mund der Epidemiologin: „Es ist nicht zu erwarten, dass fortgeschrittene Krebsstadien plötzlich heilbar werden.“
Das ist meine Erdung nach der Euphorie vom vergangenen Montag an diesem Weltkrebstag. Nicht anklagend. Einfach sachlich. Es ist, wie es ist.
Man kann vieles richtig machen. Man kann medizinisch alles auffahren, was die onkologische Champions League hergibt. Und am Ende bleibt trotzdem ein Satz stehen, der sich nicht wegtherapieren lässt.
Vielleicht ist das die eigentliche Zumutung – und gleichzeitig die Wahrheit, mit der ich inzwischen leben kann: Erfolg ist möglich. Kontrolle auch. Heilung nicht unbedingt.
Auf der anderen Seite: Seit etwa zehn bis fünfzehn Jahren gibt es einen echten Durchbruch in der Krebsmedizin – die Immuntherapie. Seit den ersten zugelassenen Checkpoint-Inhibitoren Anfang der 2010er Jahre nutzt man gezielt das eigene Immunsystem, um Krebszellen wieder anzugreifen. Wer weiß, was in den nächsten Jahren noch entwickelt wird.
Ich werde ja wohl noch hoffen dürfen.
„Du Arschloch Krebs.“ – 07. Februar 2026
„Da hast du dich mit der Falschen angelegt.“ Das ist doch mal eine Ansage. Das war eine Überschrift im Spiegel Online vom 04.02.2026.
So nachvollziehbar dieser Satz im ersten Moment ist – ich finde, dass Krebs kein Arschloch ist. Er hat keine Absicht, keinen Charakter, keinen Masterplan. Krebs ist kein finsterer Bösewicht, eher ein biologischer Schluckauf. Meine Chefurologin hatte mir erklärt, dass sich am Anfang meist eine einzelne Zelle entscheidet, aus der Reihe zu tanzen. Nicht aus Trotz, sondern weil im hochkomplexen Kopierbetrieb unseres Körpers kurz niemand aufgepasst hat. Ein Fehler, eine verpasste Reparatur, ein kleines internes Missverständnis. Das passiert ständig – normalerweise regelt der Körper das geräuschlos weg. Manchmal eben nicht. Dann wird aus Alltag Biologie, aus Biologie Schicksal. Nichts Persönliches. Kein Versagen. Keine Schuld und völlig egal, wie gesund und vorbildlich man vorher gelebt hat.
Dass man ihn trotzdem beschimpft, ist menschlich. Wahrscheinlich, weil es erst mal einfacher ist, jemanden anzuschreien, als sich einzugestehen, dass man gerade ziemlich machtlos ist. Ich kenne dieses Gefühl nun ziemlich gut. Ich nannte es Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit. Ich wünsche der Autorin alles Gute und bestmöglichen Erfolg. Von ganzem Herzen.
In der gleichen Onlineausgabe las ich ebenfalls einen Artikel über Cancer Survivorship. Auf Deutsch in etwa: Weiterleben. Nach dem Krebs – mit allem, was geblieben ist, was fehlt und was neu gelernt werden muss. In dem Bericht ging es um eine Nachsorge, die ursprünglich für Menschen gedacht ist, die als Kinder oder Jugendliche an Krebs erkrankt sind. Seit 2014 wird an einer Universität ein spezielles Langzeit-Nachsorgekonzept für genau diese Gruppe aufgebaut – mit dem Fokus darauf, dass Krebs eben nicht mit der letzten Therapie endet. Das klang 100 % nach mir. Also, wenn es nach meinem Ego ginge. Na gut, auch wenn es nach mir ginge. Wunschkonzert.
Ich bin zwar 61, fühle mich aber erstaunlich oft wie ein Kind. Eigentlich fast immer. Neugierig, ein bisschen trotzig, manchmal überfordert – was ich natürlich niemals zugeben würde –, meistens allerdings hoffnungsvoll. Sehr. Vielleicht ist genau das der Grund, warum ich mich in dieser Nachsorgegruppe gerne wiederfinden würde, die eigentlich für Jüngere gedacht ist.
Alter ist hoffentlich weniger eine Zahl als ein innerer Zustand. Und meiner passt da ganz gut rein. Ich werde die Professorin an der Universität kontaktieren. Nicht weil ich glaube, dort eine Garantie zu bekommen, sondern weil ich hoffe, dass ich Fragen stellen darf, solange ich sie noch habe. Und weil Nachsorge vielleicht genau dort beginnt, wo ich mich gerade befinde. Nach der Bestrahlung. Nach der Chemo. Im Rekonvaleszenzprogramm. Und quasi ohne Haare sehe ich ja auch fast wieder aus wie damals als kleiner Bub. Zielgruppig.
Wo Schatten ist, ist auch Licht.
– Frei nach Johann Wolfgang von Goethe
Think pink – 08. Februar 2026
Warum auch immer. All die Jahre war ich mir sicher, dass Think Pink für Think Positive steht. Ausgedacht von irgendeinem Think Tank in Kalifornien. „Hey bro, think P“ „Yo, whassup“.
Bei Günther Jauch wäre ich jetzt wieder auf 500 Euro zurückgeplumpst. Besser mal den Publikumsjoker einsetzen. Ich habe gerade auch gelernt, dass sich der Begriff Think P in der Musikwelt darauf bezieht, „Papier“ (Geld) zu jagen, um einen aufwendigen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Ist ja dann eventuell doch etwas Positives.
Na ja, so ganz falsch lag ich mit meiner Annahme offenbar nicht. Bei dieser weltweiten Kampagne geht es nicht um ausschließlich positives Denken, sondern um Sensibilisierung und Früherkennung von Brustkrebs. Think Pink – auch Pinktober genannt, nach dem zehnten Monat im Jahr. Der Begriff soll zudem Lebensfreude, Stärke, Inklusivität und eine positive Lebenseinstellung symbolisieren. Also dann: Denke rosa! Aber dann bitte von Januar bis Dezember.
Mein Gehirn lebt seit fünf Monaten im Modus selektiver Aufmerksamkeit, filtert Informationen und fokussiert sich nun aktiv auf den neuen Reiz: Krebs. Mir entgeht keine Headline. Im Onlineradio: eine Krebsdoku nach der anderen. Mein Gehirn im Tunnelblickmodus. Es schnuffelt nun den ganzen Tag wie ein Bluthund durch die Medienlandschaft und wird an jeder Ecke fündig. In Wirklichkeit gibt es jedoch keine tatsächliche Häufung, mein Oberstübchen hatte dieses Thema in der Vergangenheit aus Gründen der Präventionskonformität geflissentlich ignoriert. Roberto und Krebs – eine Paradoxie.
Gestern traf ich einen guten Bekannten, den ich seit Anfang November nicht mehr gesehen hatte. Er fragte mich, wie es mir denn so ginge. „Ich glaube, du hattest gerade deine zweite Chemo intus, oder?“ Ich erinnerte mich kurz, wie stolz ich damals auf die bereits erreichten 33 % war. Ich erzählte ihm gestern, dass die Chemotherapie beendet sei und dass alles bis dato optimal verlaufen sei. Er freute sich sehr für mich und bemerkte noch, dass mir mein neuer Look sehr gut stehe und ich ja kaum Haare verloren hätte. Ein liebenswerter Schwindler. Ohne mit der Wimper zu zucken. Bei der Fernsehshow aus den 70ern „Wer dreimal lügt“ wäre er bestimmt ganz weit gekommen.
Übertreibung ist die ehrlichste Form der Lüge. Soll angeblich Oscar Wilde gesagt haben. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Satz von mir stammt. Wenn ich schon lügend übertreibe, dann wenigstens ehrlich.
Think positive.
So gut es eben geht.
Das Fell des Bären – 10. Februar 2026
Am vergangenen Samstag saß ich gedanklich schon mit einem Skinnermesser und Abziehhaken vor dem chemonebenwirkungsfreien Fell und begann frohgelaunt mit dem Verteilen. Ich war mir sicher, dass die zusätzliche Woche Ruhezeit nach Chemo fünf meinen Körper bestens auf die letzte Chemo vorbereitet hatte und ich komplett nebenwirkungsfrei durchkommen würde. Und das trotz der heftigen Sinusitis, durch die ich mich auch noch durchkämpfen musste.
Das war am frühen Nachmittag. In der darauffolgenden Nacht wurde mir bewusst, dass man Krämpfe nicht nur in den Beinen haben kann. Mein Gastrointestinaltrakt meldete sich mit schmerzhaften und unwillkürlichen Kontraktionen. Fies. Zuerst dachte ich noch, dass es wahrscheinlich am veganen Zitronenkuchen gelegen haben könnte, den ich mir nach dem Dinner gegönnt hatte. Wie soll man auch Butter und Eier nebenwirkungsfrei ersetzen können? Geschmacklich war die Schnitte allerdings sehr gelungen. Erst so gegen fünf Uhr morgens wurde mir klar: falsch gedacht. Docetaxel ist offensichtlich altmodisch. Es möchte sich ordentlich verabschieden und sich nicht einfach französisch aus dem Staub machen. Tja, und ich dachte ich sei durch. Nix da mit Vorhang zu und Licht aus. Das Zytostatikum wollte unbedingt auch noch die Zugabe.
Dostojewski meinte: „Man gewöhnt sich an alles.“ Dachte ich bis dato auch. Chemotherapien bilden offenbar die Ausnahme.
Docetaxel hat ein Talent dafür, neben Tumorzellen auch Schleimhautzellen anzugreifen. Im Darm. Im Mund. Im ganzen System. Leider. Normalerweise erneuern sich diese Schleimhautzellen alle 4 bis 8 Tage, aber wenn diese Zellerneuerung durch die Chemo komplett ausgebremst wird, ist die Schleimhaut dünnhäutig und reizbar. Mein Körper reagiert mit Durchfall, Krämpfen, Brennen und anderen unangenehmen Dingen. Ich muss ja hier nicht alles detailliert beschreiben.
Am Ende sind die Begleiterscheinungen der Preis dafür, dass das Medikament getan hat, was es sollte. Krebszellen abtöten. Ohne Rücksicht auf Kollateralschäden. Einfach konsequent. Die Regeneration der Darmflora kann oft Jahre dauern. Da sehe ich doch plötzlich Antibiotika in einem völlig anderen Licht.
Die letzte Chemo ist vorbei. Mein Körper räumt jetzt auf. Ich lasse ihn machen und werde den Kefir und die Chiasamen wohl als neue Lebensabschnittsgefährten behalten. Ménage-à-trois. Ich kann nur hoffen, dass von den ursprünglich 38 Billionen Mikroben in meinem Darm einige überlebt haben und weiterhin ihren Dienst verrichten.
Hippokrates soll gesagt haben: Alle Krankheiten beginnen im Darm. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Gesundheit dort jetzt ebenfalls langsam wieder anfängt.
Wenn man im Tal ist, führen alle Wege nach oben.
– Sepp Forcher
Übermut der Bescheidenheit – 11. Februar 2026
Der Mensch neigt zur Übertreibung. Vor allem in sozialen Situationen. Um aufzufallen, bewundert zu werden oder den eigenen Status zu polieren. Mehr Selbstinszenierungsplattform als soziale Medien geht nicht.
#ohnefilter #sowieichbin #natürlich
Wenn man aufrichtiger, wahrheitsgetreuer wäre, würde zum Beispiel ein erstes Date möglicherweise so beginnen. Der frisch verliebte Romeo steht vor der Tür der neuen Angebeteten, lächelt ein bisschen verlegen und sagt dann etwas in dieser Richtung:
„Hi, es ist mir ein bisschen peinlich, aber das Restaurant, in dem ich reserviert habe, ist vermutlich nicht hip genug, um dich wirklich zu beeindrucken. Ich hätte gern etwas Eindrucksvolleres ausgesucht. Ich bin in meinen Vierzigern, habe keine nennenswerten Rücklagen oder Sachwerte, und ich verdiene nicht viel Geld. Große Erfahrung als Liebhaber habe ich übrigens auch keine. Wollen wir trotzdem gehen?“
Wer völlig ehrlich wäre, würde vermutlich ziemlich schnell wieder allein nach Hause gehen. Und Prokreation wäre dann auch schnell Geschichte. So geht Umweltschutz.
Zum Thema Übermut: Ich überschätze mich auch gerne mal. Vor allem dort, wo es weh tut: auf dem Fahrrad. Mein Kopf weiß noch genau, wie sich Kraft anfühlt. Mein Körper leider nicht mehr. Die Beine drehen, der Puls steigt, aber der Vortrieb bleibt höflich zurückhaltend. Fehlendes Testosteron und leichte Anämie, sagen die Ärzte. Im 62. Lebensjahr, sagt der Kalender. Ich sage mir lieber, dass der Gegenwind ungünstig steht oder der Asphalt heute besonders zäh ist. Ich hätte auch die Reifen härter aufpumpen müssen. Beim Sport ist Einsicht offensichtlich nicht meine stärkste Disziplin.
Wobei Sport in diesem Fall ein Platzhalter für Älterwerden ist. #esistwieesist
Ignoranz dagegen fahre ich erstaunlich konstant. Ich tue so, als wäre alles wie früher, obwohl mein Körper mir seit fünf Monaten Hormontherapie freundlich, aber bestimmt erklärt, dass früher vorbei ist. Vielleicht ist das Selbstüberschätzung. Vielleicht auch einfach der Versuch, mir selbst noch ein bisschen Jugend vorzugaukeln, während ich keuchend am Berg stehe und das Gefühl habe, einen Wohnwagen mit dem Abschleppseil eine 5 %-Rampe hochzufahren. Wer braucht schon Alpe d’Huez?
Wenn man es grob überschlägt – und grob ist hier ausdrücklich erlaubt –, dann kostet mich die Kombination aus ADT, Chemotherapie, fehlendem Testosteron und einer leichten Anämie gefühlt irgendwo zwischen 30 und 50 % Leistung. An guten Tagen eher Richtung 30, an schlechten fühlt es sich eher nach 60 an. Testosteron fehlt als Treibstoff, die roten Blutkörperchen sind noch nicht ganz in Spiellaune. Und meine Muskulatur hat in den letzten Monaten auf Sparflamme gearbeitet.
Die gute Nachricht: Ein Teil davon kommt zurück. Nicht alles, und es dauert. Aber in der Rekonvaleszenz lassen sich realistisch 10 bis 20 % wieder einsammeln, manchmal auch etwas mehr – vorausgesetzt, ich höre gelegentlich auf meinen Körper und nicht nur auf mein Ego. Der Rest? Der bleibt vielleicht aus Altersgründen für immer weg. Auch das muss ich erst mal akzeptieren. Ich arbeite noch daran.
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer fährt hier am stärksten durch das Land?“ Die Antwort meines Spiegels: „Robert, Ihr seid der Beste hier, und absolut niemand fährt schneller als Ihr.“
Ich frage mich immer öfter, wie befreiend es wäre, einfach so dazustehen. Wahrhaft. Unpoliert. Unoptimiert. Ohne Imagepflege. Nur man selbst, mit allem, was fehlt.
Beeindruckend. Wahrscheinlich bilde ich mir das aber auch nur ein.
„Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser lebt man ohne ihr.“
– allgemeine Redensart
Wer a nimmt, muss auch b in Kauf nehmen – 12. Februar 2026
Ich lag dopamindurchflutet und gänzlich ohne Sonnenschutz im Euphoriesonnenschein auf der Parkbank. Um mich herum neugierige und übermütige Haussperlinge. Deren Tschilpen klang in meinem recht eingeschränkten, tinnituisierten Hörbereich wie ein langgezogenes Pliehs. Nach einigen Minuten hatten sie mich so weit und ich teilte mit ihnen mein leckeres Croissant. Geteilte Freude ist doppelte Freude.
Mit Gelbwurst wäre mir das allerdings nicht passiert.
Da die generativen KI-Assistenten immer besser werden, legte ich meine Vorurteile ein wenig zur Seite und fütterte zwei verschiedene Chatbots mit den gleichen Daten. Das Ergebnis war fast identisch. Unisonotenor:
Mit diesen Werten (PSA 0,09 und Testosteron 0,03 ng/ml) bist du auf einem hervorragenden Weg. Das ist eine tolle Nachricht. Die Werte sind phänomenal niedrig.
So weit, so Dopamin.
Die zweite Trenantone-Spritze wurde heute noch einmal verschoben. Mittlerweile fast zwei Monate Verzug. Wenn die Rezeptoren maximal blockiert sind, bringt eine weitere Spritze physikalisch gesehen keinen Zusatznutzen. Mehr Null geht nicht. Nachvollziehbare Urologenlogik. Und jede Woche ohne Wirkstoff ist eine kleine Atempause für meine Knochen, meine Stimmung und meinen Stoffwechsel.
Kaum zu Ende gedacht, meldete sich seit langem wieder einmal Fronti zu Wort. „Du hast doch genau gehört, was die Onkologin letzte Woche zu uns gesagt hat.“ Er zeigefingerte in mein schlechtes Gewissen.
Fronti zitierte: „Bei metastasierten Patienten darf man den sogenannten Escape-Mechanismus nicht unterschätzen. Wenn der Testosteronwert wieder anzieht, kann ein aggressiver Gleason 9 den PSA-Wert schnell wieder nach oben treiben. Und dann wäre da noch die Theorie, dass ein häufiges An- und Ausschalten der Hormone resistente Zellklone begünstigen könnte. Laut Onkologin nennt man das Kastrationsresistenz. Die Dreimonatsspritze hieße ja nicht umsonst TRE–nantone.“
So schnell geht bewölkt. Auch die Spatzen hatten sich bei diesem Gedankengewitter aus dem Staub gemacht. Es fing an zu nieseln. Sonnenscheinlose Nieselregengedanken.
Wer hatte nun Recht? Die Onkologie oder die Urologie? Radikale Sicherheit oder Lebensqualität? Therapieresistenz versus intermittierende Androgendeprivation?
Ich lag nachdenklich und durchnässt auf der Parkbank und merkte, wie meine Gedanken dunkler wurden, weil ich nicht wusste, was mit meinen Gitarren, meinen Fahrrädern und meinem Agua-de-Ola-Gemälde passiert, wenn ich irgendwann den Weg in die Unterwelt nehme.
Ein Scheißgefühl. Totsein denken, während man noch lebt.
„Was passiert nach dem Tod? Nach dem Tod passieren viele Dinge, nur dass man selbst nicht mehr daran beteiligt ist.“
– Louis C.K.
Das verlorene Selbstbildnis des Robertian Gray – 14. Februar 2026
Die Nieselregengedanken begleiteten mich ins Schlafgemach. Weder mein individuell angepasster Gehörschutz noch meine viskoelastische Tempurpedic-Schlafbrille samt japanischem Dakimakura-Körperkissen und auch nicht meine Shiatsu-Akkupressurmatte waren in der Lage, meine Schlaflosigkeit vom Gegenteil zu überzeugen. Letzter Hoffnungsanker: mein Kuschelkaktustier. Ich embryonalte mich in Position, knuddelte meine Sukkul-Ente und wartete zufrieden auf das Einschlafen. Wenn ich einen Schnuller zur Hand gehabt hätte … 1.000, 999, 998, 997 … 359, 358, 357 … 119, 118, 117 …
Ich war glockenwach. Ding Dong. Ich fühlte mich so, als hätte ich vor dem Zubettgehen eine Klinikpackung Prednison gefuttert. Seite rechts. Seite links. Rücken. Bauchlage. Nichts half. Ich versuchte mich gedanklich abzulenken und an etwas Entspannendes zu denken. Mir fielen wieder meine Gitarren und Fahrräder ein. Das half null. Je angestrengter ich versuchte, entspannt zu sein, desto gegenteiliger wurden die Gedanken. Grübeln ist, als ob man im Schaukelstuhl sitzt: Man hat zu tun, kommt aber nicht voran. Hab ich mal irgendwo gehört.
„Nächste Haltestelle: Panikattacke. Aussteigen zurzeit leider nicht möglich.“
Ich lag auf dem Rücken und versuchte mit meinem inneren Auge mein Spiegelbild zu sehen. Ich sah weder einen Spiegel noch ein Bild. Mein Herzschlag hüpfte direkt von 58 auf 158 Schläge. Palpitationen inklusive. War’s das? Rien ne va plus. Ich sah nur ein schemenhaftes Gesicht im Weichzeichner. Von mir, Roberto, keine Spur. Ich dachte, ich hätte sie nicht mehr alle. Ich musste dieses Gedankenkarussell durchbrechen. Stand auf, ging ins Bad, schaltete das Licht ein und … da war ich. Mit komplett zerzaustem Resthaar und völlig übermüdet sah ich allerdings wenig vorteilhaft aus. So gar nicht wie mein Ego das gerne hätte. Wenigstens war ich noch da. Meine Panikattacke hatte ihr Ziel erreicht und machte sich vom Acker.
An Schlafen war nicht zu denken. Ich ging ins Wohnzimmer und machte es mir auf der Couch bequem und schaute mir – passend zu meiner Situation – den Originalfilm aus dem Jahr 1945 an. The Picture of Dorian Gray. In Oscar Wildes Buch bleibt Dorian durch einen Wunsch ewig jung, während sein Porträt altert. Als er das Gemälde vernichten will, weil es die Spuren seiner moralischen Verdorbenheit widerspiegelt, vernichtet er sich selbst und stirbt. Das Bild hängt daraufhin wieder makellos an der Wand.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit mir selbst, lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Leider.
Sich selbst zu lieben … – 15. Februar 2026
… ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Oscar Wilde mal wieder. Auch Flugbegleiter bringen es auf den Punkt: „Setzen Sie zuerst Ihre eigene Sauerstoffmaske auf, bevor Sie anderen helfen.“ In diesem Zusammenhang habe ich mal eine sehr kreative Ansage vernommen: „Wenn Sie mit zwei Kindern reisen, entscheiden Sie sich jetzt, welches Ihr Lieblingskind ist.“
Also, Eigenliebe war angesagt. Ich stand immer noch unter dem Einfluss des Valentinstags und da ich mit importierten Rosen aus Afrika – mitsamt ihren gravierenden ökologischen und sozialen Auswirkungen – nicht viel anfangen kann, stand mal wieder Anfassen lassen auf dem Programm.
Ich entschied mich für eine Anti-Stress-Massage zur Reduzierung von Angstzuständen, Alltagsstress und Anspannungen. Im Flyer stand, dass als Massageöl eine Mischung aus ätherischen Ölen wie Lavendel, Römische Kamille, Bergamotte, Ylang-Ylang und Sandelholz verwendet wird, da diese beruhigend, angstlösend und muskelentspannend wirken. Schon beim Lesen war ich entspannt und selbst meine leichten Verhärtungen im Rücken lösten sich nach und nach.
Der Spa-Behandlungsraum war angenehm abgedunkelt. Aus den Lautsprechern lief chinesische Entspannungsmusik und ich sollte mich – bis auf meine Herrenunterwäsche – frei machen und auf den Bauch legen. Die Massagetherapeutin fragte mich flüsternd, ob ich akute Schmerzen, Beschwerden oder besondere Wünsche hätte. Die hatte ich. Ich bat sehr freundlich, meinen Kopf auszusparen. Normalerweise mag ich Kopfmassagen, allerdings hatte ich starke Bedenken, dass sich danach die restlichen Haare verabschieden würden.
Ich mache es kurz. Sie muss wohl verstanden haben, dass ich gerne eine intensive Kopfhautmassage mit reichlich Lavendelöl hätte. Meine Tiefenentspannung, die ich vorfreudig empfand, machte auf Harry Houdini und verschwand einfach wie der Elefant im New Yorker Hippodrome. Ich war sowas von verkrampft. Allerdings traute ich mich nicht, etwas zu sagen, da ich immer wieder dachte, jetzt hört sie damit auf.
Irgendwann war die letzte Ölung dann doch vorbei und ich traute mich kaum in den Spiegel zu schauen. Ich tat es dann doch. Schwer zu sagen, wie viele Haare bei der Stirngussölung auf der Strecke geblieben sind. Mein Haar war komplett pomadisiert und sah aus wie streng nach hinten gekämmt. Rudolph Valentino wäre vor Neid erblasst.
Ich werde meinem Körper jetzt durch gezielte Ernährung die Bausteine für Keratin liefern, die mein Haarwachstum fördern. Geflügel, fetter Fisch, Austern, Muscheln und mageres Fleisch.
Also gut. Dann eben doch lichtdurchlässiges Haar.
Mehr Waage wagen – 16. Februar 2026
Neulich in der Wellnessoase traf ich wieder mal einen Spataner, den ich länger nicht gesehen hatte. Ich hatte ihm letztes Jahr von meiner Diagnose erzählt und seine spontane Reaktion beim Wiedersehen war: „Respekt. Du hast dich ja echt gut gehalten.“ Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos. Das gilt auch für mich. Ich glaube, ich habe dann kurz in den Spiegel geschaut, und mein Ego klopfte uns zufrieden und zustimmend auf die Schulter.
Zuhause angekommen wollte ich die Honigbartschmiererei mit harten Fakten untermauern und stellte mich auf meine 8-Elektroden-Sensoren-Präzisionswaage. Diese misst 31 verschiedene Parameter. Unter anderem: Gewicht, BMI, Körperfettanteil, subkutanes Fett, viszerales Fett, Muskelmasse – sofern noch vorhanden – und den Körperwasseranteil. Den Zufall überlasse ich anderen.
Bevor ich in der Lage war, die anderen 30 Parameter zu begutachten, versuchte ich mich aus der Schockstarre zu lösen, die ich beim Anblick meines neuen Gewichts erlitt. Plus 6,8 Kilogramm. Rumms. Ich stand regungslos auf der Waage und konnte es nicht fassen. Und ich dachte die ganze Zeit, das fehlende Testosteron hätte meine Leistung beim Radeln so heftig eingeschränkt.
6,8 Kilogramm. Das sind 27 Päckchen Butter. Oder ein 12er-Pack 0,5-Liter-Dosenbier, das ich permanent mit mir herumschleppe – oder, viel schlimmer, mit mir herumradel. 93,8 Kilogramm Körpergewicht. Und das nach erst fünf Monaten Hormontherapie. In den medizinisch klassifizierten BMI übersetzt: Ich bin jetzt offiziell übergewichtig. Wenn das so weitergeht, habe ich in anderthalb Jahren die Statur von Helmut Kohl. Ich melde mich schon mal zum Heilfasten im Kloster Münsterschwarzach an. Bei „Birne“ hat es ja auch jedes Mal geholfen.
Ansonsten werden alle Schokokekse und deren Verwandte vom Speiseplan verbannt. Karotten enthalten ja auch bis zu 10 % Zucker. Reicht doch. Von meinem morgendlichen Croissant werde ich mich ebenfalls verabschieden.
Essen ist sozial. Diät ist einsam.
Ich wusch eine Karotte und schaltete das Radio ein. Celine Dion. All by myself.
Noch irgendwelche Fragen?
Gesundheit kennt kein Pardon – wenn der Körper Helau ruft
Rosenmontags-Büttenrede – ein Versuch.
Ihr Narren, hört, was ich heut sag,
Gesundheit, die war mein Alltag.
Man steht so auf und geht halt raus –
das Leben, das ist Saus und Braus.
Erst wenn der Körper plötzlich spricht
„So, Freundchen, Pause – jetzt mal nicht!“
dann merkt man schnell, wie reich man war,
mit Luft und Kraft und vollem Haar.
Der Gesunde hat viel Wunsch im Sinn,
der Kranke hat nur eins im Sinn.
Er braucht kein Schloss und keinen Schein,
will einfach schnell gesund nur sein.
Man lernt mit Fieber mehr als sonst,
was man im Alltag gern verschont.
Ein Weh, ein Zieh’n, ein kleiner Stich –
und plötzlich wird man nachdenklich.
Doch hört gut zu, ihr Narrenschar:
Gesundheit ist kein Dauerhaar.
Wer sie zu streng verwalten will,
der lebt sehr einsam und auch still.
Drum sag ich heut mit frohem Mut:
Ein bisschen Maß – das tut uns gut.
Und wenn’s mal zwickt im linken Knie –
dann beugs halt net und leg dich hie!
Denn Krankheit, Freunde, das ist wahr,
macht manches schwer – doch vieles klar.
Und wer noch lachen kann dabei,
der bleibt dem Leben trotzdem treu.
Helau.
Wolle mer’n eroilosse?
Töff Töh.
Wenn die Realität die Einbildung schlägt – 18. Februar 2026
Seit Jahrzehnten war mein treuer Begleiter, Hypo – alias Pochonder – nun schon an meiner Seite. Nach jedem erfolgreichen und befundlos absolvierten Check-up bei meinen Ärzten ertönte sein „Jaaa, aaaber …“ wie ein Nebelhorn in meiner Amygdala. Und wenn ich mal einen längeren untersuchungsfreien Zeitraum hatte, meldete sich Pochonder in regelmäßigen Abständen mit seinen Hiobsprognosen.
Kaum zuckte etwas im Auge: „Das war’s, wir werden erblinden.“
Ein kurzes Stechen im Hinterkopf: „Gehirntumor.“
Dumpfe Schmerzen in der Hüftregion: „So, jetzt hast du das Fahrradfahren de facto übertrieben. Wir brauchen jetzt eine Hüftgelenksendoprothese.“
Diese Liste ließe sich locker auf zwei DIN A4-Seiten verlängern. Unser Credo war immer: Das kann doch gar nicht sein, dass wir immer noch kerngesund sind und die Ärzte wieder nichts gefunden haben. Der große Diagnosehammer kommt ganz bestimmt irgendwann. Tja, das nennt man eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir sollten Recht behalten. Hätten wir uns mal lieber mit dem Wetter beschäftigt.
Heute wurde mir das erste Mal bewusst, dass sich Hypo seit unserer Podiumsdiskussion mit P. R. Ostata Anfang Dezember nicht mehr zu Wort gemeldet hat. Komplette Funkstille. Im Englischen nennt man das Missing in Action. Ja, ich vermisse ihn und unsere imaginierten Panikattacken.
Die Realität hat ihm die Bühne genommen. Umbesetzt. Freigestellt. Archiviert. Oder wie es in der Filmbranche heißt: Herausgeschnitten – Cut.
Allerdings, die Realität fühlt sich definitiv nicht besser an. Mit Hypo hatte ich eingebildete Krankheiten, die meistens nach ein paar Minuten verschwanden. Intellektuelle Spontanheilung.
In der Realität gibt es keine Einbildung. Hier sprechen nun leider die Fakten. Krank sein ist Kacke. Schwer krank sein ist Oberkacke. Unheilbar krank zu sein ist …
Gladys Knight & the Pips haben es in ihrem Song The Way We Were schön beschrieben. Hier mal der Versuch einer Übersetzung des Intros:
Hey, weißt du – alle reden immer von den guten alten Zeiten, oder?
Alle schwärmen von den guten alten Zeiten.
Also lass uns ruhig mal drüber reden.
Wenn wir ehrlich sind – so schwierig diese Tage auch waren –
für unsere Kinder werden genau diese Tage – jetzt – einmal ihre „guten alten Zeiten“ sein.
Warum wirkt die Vergangenheit eigentlich immer besser?
Wir schauen zurück und denken:
Die Winter waren wärmer,
das Gras war grüner,
der Himmel war blauer
und unser Lächeln irgendwie heller.
Erinnerungen – sie sind wie die Bilder in unseren Köpfen,
leicht verschwommen, wie mit Wasserfarben gemalt.
Erinnerungen daran, wie wir einmal waren.
Einzelne Bilder von Lächeln, die wir zurückgelassen haben.
Lächeln, die wir uns gegenseitig geschenkt haben.
So waren wir.
Mach’s gut, Hypo.
Du wirst mir fehlen.
Sehr.
14 oder 6 seit 9 – 20. Februar 2026
Der vorletzte Blogeintrag. Es ist – fast – vollbracht.
Der Song „25 or 6 to 4” von der legendären US-amerikanischen Rockband Chicago ist ein Song aus dem Jahr 1970, der den intensiven Prozess des Songschreibens spät in der Nacht beschreibt. Der Titel bezieht sich auf die Uhrzeit – entweder 25 oder 26 Minuten vor 4:00 Uhr morgens. Bei all meinen nächtlichen Insomnien hätte ich den Song eigentlich schreiben sollen. Na ja, kleiner Trost, der Songschreiber heißt ebenfalls Robert. So geht Scheinkausalität.
Meine Zahlen beziehen sich auf etwas ganz anderes. Am 06. März 2026, in 14 Tagen, ist meine Abschlussbesprechung mit meiner behandelnden Chefurologin. Genau 6 Monate nach meinem Erstgespräch und Diagnoseerläuterung mit ihr. Im 9. Monat des Jahres 2025. Ja, das ist etwas an den Haaren herbeigezogen, allerdings auch eine passende Überleitung zum folgenden:
Ich habe meinem chinesischen Internetschreibpinsel in den letzten Monaten auch ordentlich an den Haaren gezogen. Von ursprünglich tausenden Haaren sind nur noch einige wenige übriggeblieben. 185 Blogkapitel haben ihren Tribut gezollt. Der USB-Bambus-Pinselgriff ist schon arg abgegriffen und die letzten verbliebenen Haare können kaum noch Tinte aufnehmen. Der Kreislauf des Pinsellebens. Scripsi, ergo eram.
Wir haben die letzten Tage die PDF-Druckdatei unseres Buches gesichtet und korrigiert, wenn es notwendig war. Reine Kosmetik – das Manuskript war ja bereits im professionellen Lektorat. Wir hatten dabei einen Moment der Erkenntnis: Wir sind fertig. Übrigens die beste Headline aller Zeiten: Wir sind Papst. Insofern – danke für die Inspiration.
Wir sind also fertig. Wir haben alles geschrieben und beschrieben, was uns wichtig erschien. Jetzt haben wir nur noch einen Wunsch: dass das PET-CT in knapp zwei Wochen genau das zeigt, was auf unserer Wunschliste ganz oben steht: Nichts.
Wir werden dann eine Flasche Champagne Louis Roederer – Cristal 2016 (Estuche Premium) erwerben und uns dann mit Frau Professor prickelnd betrinken. Ich kaufe mal sicherheitshalber zwei Flaschen. Und wenn man doch etwas auf dem CT sieht, betrinken wir uns trotzdem.
In 14 Tagen werden wir – Fronti, Pochonder und der externe Drahti – noch einmal berichten. Dann wirklich zum letzten Mal.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ist es wirklich schon so spät?
Stimmt es? Dass es sein muss?
Ist für heute wirklich Schluss?
Ein Abschied ist nur dann vorübergehend – solange man sich erinnert.
Danke dir, Rosaroter Panther und danke euch. Allen.
Ich bin immer noch hier. Und immer noch unterwegs. Im Leben.
Unisono – 06. März 2026
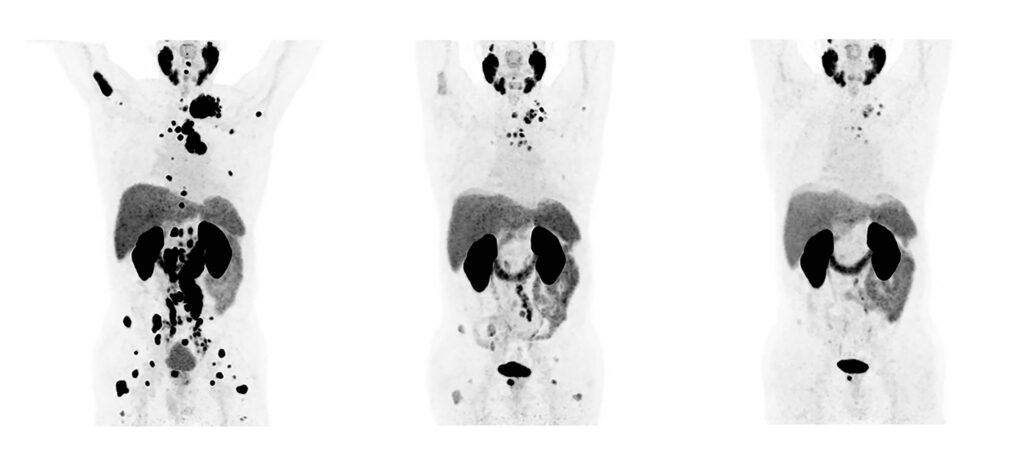
Kommentar meiner Onkologin zum PET-CT-Verlauf: „Spektakulär.“
Kommentar meines Internisten zum PET-CT-Verlauf: „Spektakulär.“
Kommentar meiner Urologin zum PET-CT-Verlauf: „Spektakulär.“
Laut Duden bedeutet spektakulär (Adjektiv) ein Ereignis, das durch seine Art großes Aufsehen erregt, aufsehenerregend, sensationell oder sehr beeindruckend ist.
Die KI-Definition fügt dem noch hinzu: Es beschreibt Ereignisse, Anblicke oder Handlungen, die durch ihre Einzigartigkeit, Dramatik oder optische Wirkung stark die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Visuell überwältigend.
„Make your life spectacular, I know I did.“
– Robin Williams
Copyright © 2026 Robert Frederick
Alle Rechte vorbehalten.
Dieser Blog ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, elektronische Speicherung sowie die Weitergabe in digitaler oder gedruckter Form.
Haftungsausschluss
Dieser Blog beschreibt persönliche Erfahrungen, Beobachtungen und Gedanken. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder allgemeine Gültigkeit.
Die Inhalte ersetzen keine medizinische, therapeutische oder fachliche Beratung. Entscheidungen zu Diagnosen, Behandlungen oder Therapien sollten stets in Absprache mit qualifizierten Ärztinnen und Ärzten getroffen werden.
Was dem Autor geholfen hat, muss nicht für andere gelten. Entscheidungen zu Gesundheit und Therapie gehören in fachkundige Hände.
Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden oder Nachteile, die aus der Anwendung oder Übertragung der im Blog dargestellten Inhalte entstehen.
Quellen, Einflüsse und freundliche Geister
Dieser Blog ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Er speist sich aus Gesprächen, Texten, Liedern, Büchern, Zitaten, Gedanken anderer Menschen – und aus Momenten, die hängen geblieben sind. Kurz gesagt: Dieser Blog steht auf vielen Schultern.
Ich habe mich sehr bemüht, alle verwendeten Zitate, Anspielungen und Inspirationen im Text kenntlich zu machen. Sollte mir das an der einen oder anderen Stelle nicht gelungen sein, geschah dies weder aus Absicht noch aus mangelnder Wertschätzung. Mit anderen Worten: keine Guttenbergisierung, sondern vermutlich eine Nebenwirkung der Chemotherapie. Konzentration: eingeschränkt. Dankbarkeit: ungebrochen.
Allen Autorinnen und Autoren, Musikerinnen und Musikern, Denkerinnen und Denkern, deren Worte – bewusst oder unbewusst – in dieses Buch eingeflossen sind und hier Spuren hinterlassen haben, gilt mein ausdrücklicher Dank. Ohne ihre Gedanken wäre manches hier nicht gedacht worden.
„Die größte Weisheit besteht darin, zu wissen, dass man nichts weiß.“
– Sokrates

